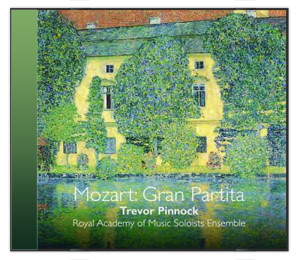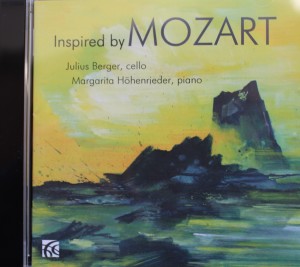Josef Vlach und das Tschechische Kammerorchester
Stanislav Duchoň, Oboe; Ilya Hurník, Klavier; Karel Patras, Harfe
Henry Purcell: Suite aus ‚King Arthur’ für Streicher
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento D-Dur KV 136, Eine kleine Nachtmusik KV 525, Adagio und Fuge c-moll KV 546
Pjotr Tschaikowsky: Andante cantabile aus dem 1. Streichquartett op. 11, Serenade C-Dur op. 48
Antonín Dvořák: Serenade E-Dur op. 22, Tschechische Suite op. 39
Claude Debussy: Danse sacrée et danse profane
Josef Suk: Serenade Es-Dur op. 6
Ottorino Respighi: Gli Uccelli
Igor Strawinsky: Apollon musagète
Benjamin Britten: Variations on a Theme of Frank Bridge op. 10
Jiří Pauer: Symphonie für Streicher (1978)
Ilya Hurník: Konzert für Oboe, Klavier und Streichorchester (1954/59)
Supraphon SU 4203-2 (4 CD-Box) (EAN: 099925420321)
Josef Vlach (1923-88) gilt den traditionsbewussten tschechischen Musikern als der legitime Fortführer einer authentischen Linie, die sich von Antonín Dvořák, Josef Suk und Václav Talich als seinem direkten Vorläufer bis heute zu Jiří Bělohlávek (heute Chefdirigent der Tschechischen Philharmonie) und dessen Schüler Jakub Hrůša (der jetzt im Herbst seine Stellung als Chefdirigent der Bamberger Symphoniker antritt) erstreckt. Das kann man hören! War Talich der bis heute bedeutendste Dirigent Tschechiens, so ist Vlach nicht nur in Bezug auf seine verfeinerte natürliche Muskalität der Nachfolger Talichs, er übernahm als hervorragender Geiger auch aus dessen Händen das Tschechische Kammerorchester, das er fortan vom Konzertmeisterpult aus leiten sollte (leider sind keine Mitschnitte des Streicherensembles unter Talich erhalten). Unter Vlach wurde das Tschechische Kammerorchester denn auch zu einem der weltweit anerkannt führenden Streichorchester, vergleichbar den Busch Chamber Players, dem Kammerorchester Edwin Fischers in der Schweiz, dem Niederländischen Kammerorchester unter Szymon Goldberg, der Salzburger Camerata unter Sándor Végh oder später dem finnischen Ostrobothnian Chamber Orchestra unter Juha Kangas – als einer jener unverkennbaren Klangkörper, die von einem herausragenden Künstler geformt und in jeder Hinsicht sowohl zu bestechender Makellosigkeit angehalten wurden als auch eine ganz spezifische Klang- und Ausdruckskultur verkörperten. Was ist typisch für Vlachs Tschechisches Kammerorchester? Der dunkel abgetönte Klang, der zwar die Oberstimmen sich wunderbar entfalten lässt, jedoch immer die Mittel- und Unterstimmen ebenso lebendig mitwirken und zur Geltung kommen lässt – gerade auch die Bratschen und Celli sind ganz wunderbar sowohl hinsichtlich der Gruppenhomogenität als auch der technischen und tonlichen Vollendung: also ein Fundament, das vital trägt und von den Geigengruppen umso höhere Qualität fordert – denn, wenn die Tiefe so sauber und klar ist, hört man umso unvermeidlicher jede Trübung und Unkultiviertheit in der Höhe. Das Ganze hat einen großartig geschlossenen Ausdruck, die Phrasierung jeder Stimme ist so einheitlich, als spielte jeweils ein großes Instrument. Hinzu kommt jene besondere Wärme, Empfindsamkeit und lyrische Leidenschaftlichkeit auch in den verträumtesten und introvertiertesten Episoden, und jene subtil beschwingte Musikanterie, wie sie den Tschechen wie keinem anderen Volk zu eigen ist – eine Süße auch, die etwas herber und viel unschuldiger ist als etwa jene des Wiener Stils. Über allem liegt ein unaussprechlicher Zauber, ein Geheimnis der Beseeltheit, ein wunderbar ausgeglichenes Verhältnis von immerwährendem Gesang und nie ins Mechanische umkippendem noch erlahmenden Rhythmus. Das Schnelle wird nicht hart und hysterisch, das Langsame badet nicht in haltlosen Emotionen – es ist also auch jener Schuss Nüchternheit dabei, der nichts mit sachlicher Kälte zu tun hat (dies beispielsweise eine Gefahr deutscher Ensembles), der aber die durchgehende Orientierung am strukturell Wesentlichen ermöglicht. Auch der Humor bleibt fein, und die Kunst der Übergänge zeugt von großer innerlicher Beweglichkeit und agogischer Flexibilität. Alles Zeichen einer Kultur im Höchststand.
Vlachs Mozart ist kraftvoll, vital, und dabei stets auch transparent, klar artikuliert ohne die auch bei den Wienern so übliche redundante Betonung der schweren Taktzeiten, und die Leichtigkeit ist weniger eine Sache des Klangs an und für sich als der Beweglichkeit der Gestaltung. Ganz großartig ersteht Adagio und Fuge in c-moll, man fühlt sich in die barocke Welt des Introitus und Kyrie aus Mozarts Requiem versetzt. Und auch von der Kleinen Nachtmusik kenne ich keine natürlicher und treffsicherer ausgeführte Aufnahme.
Bei Dvořák und Suk ist man ganz zuhause. Das kann nicht authentischer verstanden werden. Wie bei Dvořák wird es auch bei Tschaikowsky nie billig, langweilig, sentimental oder mechanisch, sondern fesselt mit einer Würde, Grazie und unaufgesetzten Tiefe der Empfindung, wie dies kaum irgendwo der Fall ist. Auch zeigt sich hier endlich einmal wieder, was für einmalige, in einer adäquaten Aufführung unübertreffliche Meisterwerke die beiden berühmten Serenaden von Dvořák und Tschaikowsky sind. So gespielt, wenn eine solche Fülle und Lebenskraft sogar noch auf einer antiquierten Aufnahme rüberkommt, kann man nur bedauern, dass man es nie wieder im Konzert wird hören können!
Henry Purcells King Arthur-Suite werden Verfechter der heute landauf landab eingesickerten ‚historischen Aufführungspraxis’, also einer philologisch aus dem Notenbild und schriftlich überlieferten Berichten und Anleitungen abgeleiteten hypothetischen Herangehensweise, in der hier zu hörenden Art und Weise entschieden ablehnen. Was sie dabei überhören, ist bei allen gewiss vorhandenen Relikten romantischer Tradition die wendige Phrasierung, die sich natürlich nicht in spritziger Kleinteiligkeit verzettelt, sondern stets den Blick aufs Ganze heftet, wie auch die beseelte Sanglichkeit und rhythmische Urkraft, die nicht gestelzt prätentiös von Höckchen zu Stöckchen hüpft, sondern aus dem zugrundeliegenden Momentum schöpft.
Von Ottorino Respighis ‚Gli Uccelli’ habe ich nie auch nur annähernd so zauberhafte und bis ins Zerbrechlichste vitale Aufführung gehört. Man achte zum Beispiel nur einmal darauf, wie unwiderstehlich sich das neobarocke Rustico in ‚La Gallina da Jean-Philippe Rameau’ artikuliert und entfaltet.
Auch Benjamin Brittens kapriziöse Frank Bridge-Variationen und Igor Strawinskys aparte Farben- und Gestenwelt ‚Apollon musagète’ erfahren mustergültig organische, in jedem Moment wunderbar feine und klar charakterzeichnende Darbietungen. Sehr schön auch, wenngleich nicht ganz so am Kern des Idioms, die beiden stilisiert schreitenden Tänze Debussys mit dem Harfensolisten Karel Patras.
Bleiben die beiden tschechischen Meister, die hierzulande heute kaum jemand kennt. Ilya Hurník (1922-2013) erweist sich als musikantischer Architekt eines dissonanzgewürzten, kurzweiligen, dabei aber in klarer Formgebung verankerten Neobarock mit einem spezifisch böhmischen Einschlag, wie wir das – in ornamentisch komplexerer Faktur – auch teilweise von Martinů kennen. Sein Konzert ist viersätzig, mit entschieden kontrastierenden Charakteren, mit einem spielerisch filigranen Element auch bei harter, kurz abgerissener Artikulation, und außer dem ausgezeichneten slowakischen Oboisten Stanislav Duchoň wirkt der Komponist selbst am Klavier mit, was uns natürlich auch ahnen lässt, wie sehr die Musik hier im Sinne des Komponisten erarbeitet wurde. Diese Musik mag nicht groß sein, doch sie bietet mehr als distinguierte Unterhaltung und einprägsame Gesten.
Ein anderes Kaliber freilich noch ist Jiří Pauer (1919-2007), dessen reife Symphonie für Streicher das Zeug hätte, auch heute noch eine effektvolle Bereicherung des Streicherrepertoires zu sein. Pauer knüpft an das Bartók’sche Barbaro an, mit wuchtigen, dissonanzfreudigen Akkordbildungen, sehr zielstrebig angelegten Steigerungen, couragierten Schichtungen und einer die Entwicklungen offenkundig gliedernden, klar formulierten Motivik, die an und für sich die geringste Leistung des Komponisten ist. Es sind eindeutig nicht die etwas unbedeutenden markanten Motive, die die Qualität dieser Musik ausmachen, sondern die Art ihrer Durchführung. Der große langsame Mittelsatz eröffnet eine andere, tragische Einsamkeit auslotende Welt – man kann hier gar an Schostakowitsch denken –, doch der originelle Aufbau beinhaltet einen plötzlichen Scherzo-Ausbruch, dem – zunächst wie ein Trio scheinend – eine äußerst leidenschaftliche, getragene melodische Entfaltung folgt, die sich zu höchster Spannung steigert. Überraschenderweise kehrt das Scherzando nicht wieder, sondern der Abbau der Spannung leitet direkt in das breite Haupttempo über, in welchem das ergreifende Stück endet. Auch im schnellen Schlusssatz sind es erhebliche Tempo- und Strukturkontraste, die unerwartet eintreten und das Werk mit ganz eigenem Leben erfüllen. Darüber sieht man gerne über einige vielleicht allzu oberflächliche Effektfolgen hinweg, die zunächst sehr animierend wirken können, sich jedoch bei öfterem Hören, wenn es nicht so fantastisch gespielt wird wie wir, auch schnell abnutzen könnten. Dieser Einwand gilt aber auch für eine Vielzahl von Musik, die regelmäßig in unseren Konzertsälen zu hören ist. Den Namen Pauer sollte man sich merken, denn es gibt nicht gar so viel Musik auf solchem Niveau in der tschechischen Musik seit Martinů.
Fazit: eine grandiose Box von einem der besten Ensembles in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, das mit einer Eindringlichkeit und charakterfesten Unbedingtheit, auch einem ausgesprochen fein geschulten Korrelationsvermögen und höchstkultivierter Abstimmung in allen Bereichen agiert. Jeder Streichorchesterleiter sollte diese Aufnahmen kennen. Auch die klangliche Aufbereitung der Aufnahmen aus den Jahren 1960-81, die davon profitiert, dass diese bereits damals exzellent verwirklicht wurden, ist sehr ansprechend, rund, brillant und natürlich. Und der Booklettext von Petr Kadlec erzählt in sehr anrührender Weise die Geschichte Vlachs und seines Kammerorchesters.
[Christoph Schlüren, August 2016]