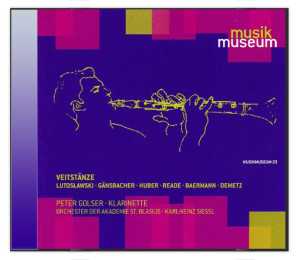Ondine, ODE 1332-5; EAN: 0 761195 133255

Hannu Lintu dirigiert das Finnish Radio Symphony Orchestra mit den Symphonien Nr. 2 und 3 von Witold Lutosławski.
Witold Lutosławski zählt zu den prominentesten Komponisten der zweiten Hälfte des Zwanzigsten Jahrhunderts, nicht zuletzt aufgrund seiner Eigenständigkeit und Originalität, mit der er versuchte, alten Formen neuen Geist einzuhauchen. Im Vordergrund der Aufmerksamkeit um ihn stehen seine vier Symphonien, das Konzert für Orchester und Jeux vénitiens. Die erste Symphonie besitzt noch (ebenso wie das Konzert für Orchester) einen neoklassizistischen Flair, den er spätestens in Jeux vénitiens ablegte. Dort wandte er erstmals aleatorische Techniken an, wenngleich auf eigene Weise: Lutosławski notierte zwar die einzelnen Stimmen voll aus, überließ aber das Zusammenspiel dem Zufall, indem das Tempo für jeden frei steht und der Dirigent pausiert; dies bezeichnete er als aleatorischen Kontrapunkt. Die zweite Symphonie steht voll im Zeichen dessen. Lutosławski konzipierte sie zweisätzig: Der erste Satz, Hésitant, besteht aus sieben durch Refrains gegliederte Episoden in freiem und suchendem Gestus ohne wahren Zusammenhalt, während der zweite, Direct, stringenter auf einen Höhepunkt zusteuert, mehr auf die Streicher baut und geballtere Dimensionen annimmt. Während diese Form doch recht sperrig wirkt und den Hörer gerade formal streckenweise vor den Kopf stößt, gelingt Lutosławski in der Dritten Symphonie ein verständlicherer und mitvollziehbarerer Gattungsbeitrag. Die Symphonie besteht aus sieben, bis auf das Finale recht kurzen Sätzen, deren Episoden durch knappe und vor allem wiedererkennbare Motive zusammengehalten werden. Zu Beginn stehen vier rasche Tutti-Schläge auf E, die sich durch das gesamte Werk ziehen, gefolgt von einem wiederkehrenden Anklang an die Eröffnung von Beethovens Fünfter Symphonie. Allgemein nimmt Lutosławski die Passagen mit aleatorischem Kontrapunkt zurück und setzt auf luzidere Harmonien, konzentriert sich auf bessere Durchhörbarkeit des Geflechts.
Die Musik von Witold Lutosławski spricht für sich, man kann sie als ausführender Musiker nicht „verschandeln“ im dem Sinne, wie man Mozart, Beethoven, Schubert oder Bach für den Hörer ungenießbar machen kann. Dennoch zeigt gerade der Vergleich verschiedener Aufnahmen deutliche Unterschiede. Die Zweite Symphonie nahm Lutosławski selbst auf (er spielte auch die vollständige Uraufführung, nachdem er Boulez zum offiziellen Premierentermin nur den zweiten Satz fertig lieferte), erweist sich dabei als fähiger, im Detail präziser, aber nicht unbedingt großformatig denkender Dirigent (EMI Classics). Am meisten schätze ich die Aufnahmen von Edward Gardner mit dem BBC Symphony Orchestra (Chandos; CHSA 5223(5)), in der er nicht nur klangliches Feingefühl beweist, sondern wahrlich in die Musik hineinhört und alle Substanz aus ihr herausholt. Das Stimmgeflecht übermittelt er plastisch an den Hörer, meißelt die Kontraste ins besondere der Besetzung minutiös heraus und versteht die formale Konzeption der Werke. Auch in den geballten Klangmassen findet sich Gardner zurecht und bringt eine seidene Eleganz in die Musik hinein. Genau hier liegt der Unterschied zu der vorliegenden Aufnahme mit Hannu Lintu: Der finnische Dirigent achtet nicht auf die Ästhetik des Gesamtklangs, lässt es gerne donnern und krachen, scheint gerade in unkontrolliert polterndem Getöse voll aufzugehen. Lutosławski mit der Brechstange. Die sieben Sätze der Dritten Symphonie scheinen sich bei Lintu in die Länge zu ziehen und im Finale gar nicht enden zu wollen, während die knapp dreißig Minuten bei Gardner im Fluge verstreichen und noch Lust auf mehr machen. Dagegen überrasche Hésitant aus der Zweiten Symphonie, das Lintu im Gegensatz zum Rest erstaunlich feinfühlig dirigiert und weitschweifende Bögen formt – Direct hingegen fällt erneut zurück in den gewohnten Gestus.
Aktuell findet sich der Name Hannu Lintu vielfach in den Neuerscheinungen von Ondine, und dazu stets mit schwieriger Literatur, die genauen Feinschliff verlangt. Vielleicht sollte er sich einmal auf wenige Programme konzentrieren und diese dafür voll ausarbeiten, anstatt rasch einstudierte und nicht ausgearbeitete Aufnahmen auf den Markt zu bringen.
[Oliver Fraenzke, März 2020]