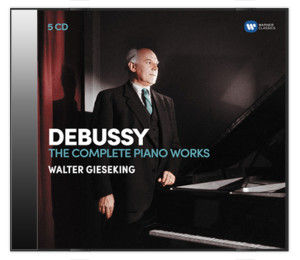Aldilà Records, ARCD 011; EAN: 9 003643 980112

Was ist ein richtiges Tempo? Eine erschöpfende Antwort auf diese Frage zu geben, über die im Laufe der Zeit eine gewiss nicht geringe Zahl Musiker und Hörer nachgedacht hat, soll im Folgenden nicht versucht werden. An dieser Stelle wollen wir uns darauf beschränken, die Sinne zu schärfen. Als Gegenstand der Betrachtung wähle ich eine einzelne Aufnahme, die mir besonders gut geeignet erscheint, ein Gespür für die Problematik des richtigen Tempos zu entwickeln: 2019 spielte Beth Levin in Baltimore Ludwig van Beethovens Große Sonate für das Hammerklavier B-Dur op. 106. Der Mitschnitt des Konzerts, in welchem die Pianistin neben Beethovens Werk auch Georg Friedrich Händels Suite d-Moll HWV 428 und Anders Eliassons Carosello (Nr. 3 der Stücke, die der schwedische Meister unter dem Gattungstitel „Disegno“ zusammenfasste) zu Gehör brachte, erschien rechtzeitig zum 250. Geburtstag Beethovens 2020 unter dem Titel Hammerklavier Live bei Aldilà Records.
Bekanntlich versah Beethoven den ersten Satz der Großen B-Dur-Sonate mit der Metronomisierung Halbe = 138, und ebenso bekanntlich haben nur wenige Pianisten den Versuch unternommen, den Satz in dieser Geschwindigkeit zu spielen. Arthur Schnabel, Walter Gieseking und Michael Korstick kamen dabei am nächsten an das von Beethoven notierte Tempo heran. Aber sie blieben Ausnahmen. Die meisten anderen wählten ein mäßigeres Zeitmaß. Der Aussage Hermann Kellers, dass „nach [Beethovens Metronomisierung] der erste Satz in einem so unsinnig schnellen Tempo zu spielen wäre, daß dieses Tempo nicht nur kaum ein Spieler erreichen kann, sondern daß dadurch auch der musikalische Inhalt des Satzes völlig zerstört werden würde“ (Hermann Keller: „Die Hammerklavier-Sonate“, Neue Zeitschrift für Musik 1958), hat die Mehrheit der Pianisten vielleicht nicht verbal, wohl aber in der musikalischen Praxis zugestimmt. Da sich das Problem der Realisierbarkeit der Metronomangaben Beethovens auch in anderen Fällen einstellt, wurde oft vermutet, er habe ein defektes Metronom besessen. Auch erscheint es möglich, er habe das Metronom schlicht falsch abgelesen (wie Almudena Martín Castro und Iñaki Úcar Marqués in einer Studie plausibel gemacht haben). Es verhalte sich mit dem Metronom wie es wolle; interessanter dürfte sein, dass Schnabel, Gieseking und Korstick das Ritardando, das Beethoven im achten Takt des Satzes vorschreibt, bereits im vorangehenden Takt vorbereiten, sie mithin also alle empfinden, die Verlangsamung solle nicht plötzlich erst da stattfinden, wo sie tatsächlich laut Notation verlangt wird. Darin bloß eine körperliche Entspannungsreaktion auf die im „korrekten“ Tempo vorgetragenen, vollgriffigen Anfangstakte zu sehen, wäre zu kurz gedacht, schließlich zeigt sich das gleiche Phänomen auch bei Pianisten, die deutlich langsamer spielen (etwa bei Daniel Barenboim, der den Satz in rund 12 ½ Minuten, einschließlich Expositionswiederholung, darbietet). Die Notwendigkeit einer allmählichen Verlangsamung stellt sich bei den Musikern gleichsam von selbst ein. Warum ist das so? Betrachten wir die Takte 7 und 8, so bemerken wir, dass die Musik hier auf eine Dominantharmonie zusteuert und auf dieser kurz inne hält (Fermate). Die Bewegung hin zu dieser Dominante zeichnet sich in Takt 7 bereits deutlich ab. Harmonisch bringt der Takt 8 zu Ende, was sich im Takt 7 (und den vorangehenden Takten) angedeutet hat. Die Pianisten empfinden diesen Zusammenhang und setzen ihn um in Form eines Ritardandos, das an Länge das vom Komponisten vorgeschriebene übertrifft.
Damit ist die Frage aufgeworfen, was sich eigentlich in Notenschrift festhalten lässt. Will Beethoven, dass im Takt 8 des Allegros von op. 106 ein Ritardando gemacht wird, oder will er, dass nur an dieser Stelle ein Ritardando gemacht wird? Spielen die Pianisten richtig, wenn sie bereits in Takt 7 leicht und dann in Takt 8 deutlich verlangsamen, oder spielen sie richtig, wenn Takt 7 im raschen Tempo des Anfangs gespielt und erst in Takt 8 verlangsamt wird? Und wie stark soll das Ritardando in Takt 8 sein? Dazu steht in den Noten nichts. Außer den Ritardandi und den ihnen folgenden A-Tempo-Vorschriften enthält der Satz keine weiteren Angaben zur Gestaltung der Zeitmaße. Damit scheint die Frage geklärt, welches Tempo als das Maßgebliche für den ganzen Satz anzusehen ist, nämlich offiziell Halbe = 138. Aber ist dieser Schluss zwingend?
Sehen wir uns ein Stück aus späterer Zeit an: Die Vierte Symphonie von Jean Sibelius, ein Werk, das einer Epoche entstammt, die zu Tempi und Vortrag stärker differenzierte Angaben anzubringen pflegte als dies zu Beethovens Zeit üblich war. Berühmt ist die Coda des Finalsatzes dieser Symphonie, in der ein Zerfallsprozess auskomponiert wird. Metronomangaben enthält die Partitur nicht, für den ganzen Finalsatz gilt (wie für Beethovens Sonatenkopfsatz) eine einzige Tempovorschrift: „Allegro“. Soll die Coda also gleich schnell gespielt werden wie der Satzanfang? „Nein“, sagt – Jean Sibelius! Nachträglich wiederholt um Metronomangaben gebeten, schrieb der Komponist zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Zahlen auf. Die Coda des Finales bezeichnete er mit einer vom Rest des Satzes abweichenden Metronomisierung. Wer nur die Partitur kennt, kann das nicht wissen. Es entzieht sich meiner Kenntnis, wie viele Dirigenten um Sibelius‘ Metronomisierungen wussten. Es findet sich aber kaum einer, der am Ende der Vierten Symphonie das Tempo nicht wenigstens minimal verlangsamt.
Interessant erscheinen in diesem Zusammenhang auch die unterschiedlichen Auffassungen der Dirigenten vom Schluss des Kopfsatzes der Achten Symphonie Anton Bruckners (zweite Fassung). Bruckner selbst beschrieb ihn als Sterbeszene: Es sei, als wenn einer einer im Sterben liege, und gegenüber hänge die Uhr, die, während sein Leben zu Ende gehe, immer gleichmäßig fortschlage. Es ist wiederholt darauf aufmerksam gemacht worden, dass eine Uhr kein Ritardando mache. In dieser unerbittlichen Gleichmäßigkeit bringen beispielsweise Hans Rosbaud und Jascha Horenstein den Satz zum Abschluss. Hat dann Wilhelm Furtwängler Unrecht, wenn er diese Takte als lang gezogene allmähliche Verlangsamung spielen lässt, oder Sergiu Celibidache, wenn er das Gleichmaß bis kurz vor Schluss durchhält und beim letzten Erklingen des Motivs ein Ritardando anbringt? Muss ein Dirigent, weil der Komponist selbst die Musik so beschrieb, sich verpflichtet fühlen, das Bild von der tickenden Uhr umzusetzen? Man sollte auch bedenken, dass Bruckners Worte aus einem Brief an den jungen Felix Weingartner stammen, den er um eine Aufführung des Werkes bat, und der damals noch ein leidenschaftlicher Anhänger der Programmmusik war. Ein echtes Programm hat Bruckner seiner Symphonie nie beigelegt.
Aber kehren wir zu Beethovens Sonate op. 106 zurück und widmen uns der Einspielung Beth Levins! Ihre Aufführung des Werkes kann man ohne zu untertreiben eine besondere nennen – ich möchte sagen: eine besonders mutige. Die Pianistin vermeidet nämlich metronomisch normierte Tempi und absolut festgelegte Geschwindigkeiten, was vor allem im Kopfsatz zu mitunter sehr starken Temposchwankungen führt. Beethovens Vorgabe „Allegro“ scheint sie aufzufassen als: „ein Stück im Allegro-Charakter“, offensichtlich bedeutet sie ihr nicht, dass ein einzelnes Tempo über den ganzen Satz hinweg durchgehalten werden muss. Würde Levins Aufnahme sich durch nichts anderes als ständige Tempowechsel aus der Masse der Einspielungen herausheben, so wäre sie nicht weiter interessant, ja man würde sie vielleicht als Dokument selbstherrlicher Interpretenwillkür wahrnehmen. Aber das ist sie gerade nicht! Levins Tempi sind keineswegs willkürlich gewählt, sondern lassen sich durchweg aus dem Verlauf der Musik heraus legitimieren. Wir haben oben anhand der Aufnahmen Schnabels, Giesekings und Korsticks feststellen können, dass auch Pianisten, die nach metronomischer Genauigkeit streben, ihr Tempo vorübergehend abwandeln, weil die harmonische Beschaffenheit der Musik ihnen dies als angemessen erscheinen lässt. Beth Levins Tempowahl speist sich aus keiner anderen Quelle. Sie orientiert sich an den tonalen Schwerpunkten der Musik. Die einzelnen Phrasen lässt sie sich auf ein temporäres harmonisches Ziel hin entfalten bzw. von einem Ausgangspunkt weg. Die Geschwindigkeit ergibt sich dabei aus der jeweiligen Situation heraus. So, wie sie unter Levins Händen zu hören sind, haben bestimmte Geschehnisse von der Pianistin eine Beschleunigung oder Verlangsamung des Tempos geradezu gefordert, um besonders deutlich in ihrer Eigenart wie in ihrer Funktion im Zusammenhang des Ganzen erfassbar zu werden. Sei es das Ansteuern eines harmonischen Zentrums oder das Wegstreben von ihm, eine Veränderung in der Beschaffenheit des Tonsatzes, die Darstellung der Wechselwirkung polyphoner Linien: Immer besteht für Beth Levin ein triftiger Grund, das Zeitmaß so zu gestalten, wie sie es tut.
Anhand der ersten Takte des Kopfsatzes soll nun verdeutlicht werden, wie Levin im einzelnen vorgeht. Die akkordisch gesetzten ersten vier Takte nimmt sie nicht sehr schnell, aber vergleichsweise rasch. Dem erstmaligen Durchschreiten harmonischer Zwischenstufen in den nächsten vier Takten widmet sie mehr Zeit, betont die Sequenz, achtet auf die gleichmäßige Viertelbewegung im Bass, und wird, wie ausdrücklich in der Partitur gefordert, noch einmal langsamer, wenn sich die Musik kurz auf der Dominante niederlässt. Wenn die Musik von Takt 5 in Takt 9 eine Oktave höher noch einmal ansetzt, geschieht dies wieder Tempo von Takt 5. Ab Takt 12, wo die eintaktigen Phrasen sich zu zweitaktigen weiten, spielt Levin etwas rascher. Das damit verbundene Crescendo lässt sie vorrangig in der absteigenden Basslinie stattfinden, dadurch deren Sonderstellung gegenüber den anderen Stimmen betonend. Das Periodenende wird mit einem kleinen Ritardando markiert. Die in Takt 17 mit dem Wiedereintritt der Tonika beginnende neue Periode bewegt sich anders als die vorigen. In der rechten Hand wechselt je ein Takt in Halben mit einem in Vierteln (mit verschiedener Begleitung in der linken Hand). Levin hebt dies hervor, indem sie die Takte in Halben geringfügig langsamer nimmt als die Takte in Vierteln; somit ergibt sich von selbst eine Beschleunigung, wenn sich in Takt 25 die Viertel-Bewegung durchsetzt. Ist diese Steigerung in Takt 27 auf ihrem melodischen Höhepunkt angelangt, so beschleunigt Levin noch etwas, wenn die Musik nun in die Tiefe stürzt um ab Takt 31, wenn sie, auf der Domiante angelangt, ohne Harmoniewechsel wieder in die Höhe steigt und dabei leiser wird, deutlich langsamer zu werden. Man könnte, so weitermachend, jede Seite der Partitur mit der Aufnahme abgleichen und fände die Tempowahl der Pianistin stets in der musikalischen Struktur begründet. Das feine Herausarbeiten der Einzelheiten, oft in Verbindung mit verbreitertem Tempo, und der dabei durchweg gewahrte Überblick Beth Levins über den Fortgang der Handlung lassen die ungeheuren Spannkräfte der Musik erst recht hervortreten. Zu jedem Augenblick möchte man sagen: „Verweile doch, Du bist so schön!“, und doch herrscht faustischer Vorwärtsdrang. Selten hört man das Ringen zwischen Rubato und Momentum in einer solchen Deutlichkeit wie hier!
Über die Proportionen des Werkes in Levins Aufnahme mögen hier noch die Spieldauern der einzelnen Sätze Auskunft geben:
Allegro: 12:04 (ohne Expositionswiederholung)
Scherzo: 03:11
Adagio: 17:10
Finale: 14:11
Beth Levins Album Hammerklavier Live ist übrigens nicht nur wegen Beethovens op. 106 empfehlenswert. Auch die Werke der anderen beiden Großmeister laden, abgesehen davon, dass sie größtes Hörvergnügen bereiten, dazu ein, über die Wiedergabe von Musik nachzudenken. Wie geht man damit um, dass Händel seine Klavierwerke nur äußerst spärlich mit Vortragsbezeichnungen versehen hat? – Eliassons Carosello aus dem Jahr 2005 wird weitgehend von einer Drei-Achtel-Bewegung getragen. Die Harmonik prägt klare tonale Zentrierungen aus, ohne dass je sich eine Tonika eindeutig durchsetzt. Beth Levin gibt der Darstellung dieser harmonischen Schwebezustände den Vorzug vor einer konsequenten Umsetzung mechanischer Karussellrotation. Man hört sozusagen ein imaginäres, unwirkliches, erträumtes Karussell, dessen Reiz gerade darin besteht, dass es sich gar nicht gleichmäßig drehen will. Übersteigt hier nicht die Kunst den Trott der profanen Welt? Und gilt nicht letztlich für Levins Beethoven-Darbietung das Gleiche?
[Norbert Florian Schuck, Dezember 2021]

 Troldhaugen, Villa von Edvard Grieg (Foto von: Oliver Fraenzke)
Troldhaugen, Villa von Edvard Grieg (Foto von: Oliver Fraenzke)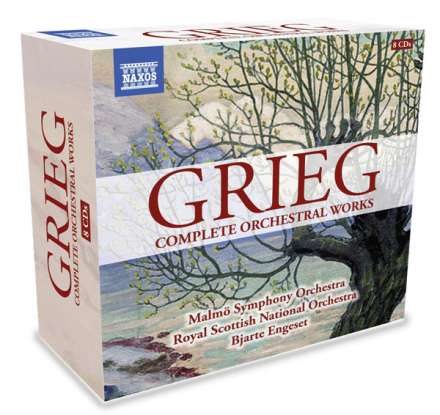 Grieg Orchesterwerke bei jpc bestellen
Grieg Orchesterwerke bei jpc bestellen Griegs Lyrische Stücke bei jpc bestellen
Griegs Lyrische Stücke bei jpc bestellen