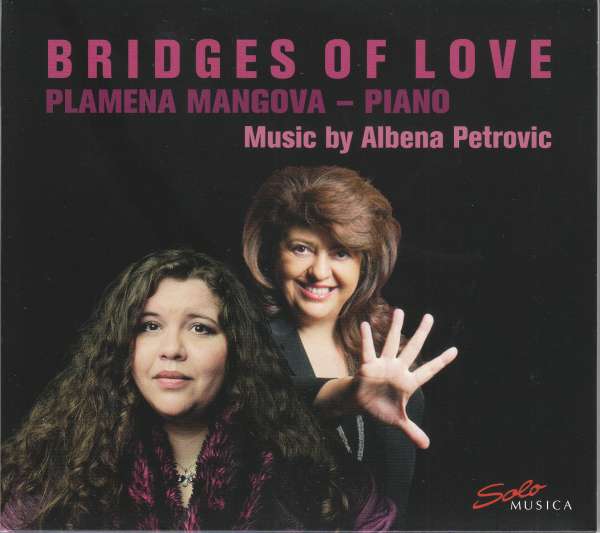Solo Musica, SM 424, EAN: 4 260123 644246

Der slowenische Gitarrist Aljaž Cvirn legt auf seinem Album Duality ein Programm vor, das ganz der deutschen Romantik gewidmet ist. Zusammen mit Jure Cerkovnik (Gitarre), Sebastian Bertoncelj (Violoncello) sowie Tanja Sonc (Violine) präsentiert er Bearbeitungen von Klavier- und Kammermusik von Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy und Franz Schubert.
Über Jahrhunderte hinweg war die Gitarre (ebenso wie ihre Vorgänger) ein Instrument, dessen Originalrepertoire sich in erster Linie aus den Werken komponierender Gitarristen zusammensetzte – in großem Stil hat sich dies erst im 20. Jahrhundert geändert. Und so besteht auch die Gitarrenliteratur des 19. Jahrhunderts überwiegend aus den Werken etwa von Sor, Giuliani, Aguado, Coste, Mertz und dann (nach längerer Pause) Tárrega, typischerweise also zudem aus dem südwesteuropäischen Raum, wo sich die Gitarre besonderer Popularität erfreute. Mit deutscher Romantik wird man die Gitarre kaum in Verbindung bringen, und dies ist der Punkt, an dem die neue CD des jungen slowenischen Gitarristen Aljaž Cvirn ansetzt. Bereits vor ein paar Jahren hat Cvirn Schuberts Arpeggione-Sonate in einer Bearbeitung für Violoncello und Gitarre eingespielt, seinerzeit als Teil eines Albums von Sonaten für Cello und Gitarre gemeinsam mit der Cellistin Isabel Gehweiler. Seine neue CD, „Duality“ genannt, ist zur Gänze der deutschen Romantik gewidmet von Franz Schubert über Felix Mendelssohn Bartholdy bis hin zu Johannes Brahms, naturgemäß in Bearbeitungen, die dieses Repertoire und seine Klangwelt der Gitarre „erschließen“.
Von den drei genannten Komponisten ist Brahms sicherlich derjenige, dessen Musik man am wenigsten auf einer CD mit Gitarrenmusik erwarten würde, und nicht von ungefähr stammen diese Transkriptionen aus jüngerer Zeit, namentlich von den Gitarristen Ansgar Krause (*1956) sowie Hubert Käppel (*1951). Bei den Vorlagen handelt es sich um eine Auswahl von Brahms’ späten Klavierstücken: Krause hat die Intermezzi op. 116 Nr. 2 & 6 und op. 118 Nr. 2 sowie die Romanze op. 118 Nr. 5 für zwei Gitarren übertragen (Cvirns Duopartner ist hierbei Jure Cerkovnik), und Käppel das Intermezzo op. 117 Nr. 2 für (eine) Gitarre. Natürlich ist es – zumal bei Musik dieses Bekanntheitsgrades – nicht ganz einfach, diese Werke unabhängig vom pianistischen Original zu hören. Dennoch: für sich betrachtet ergeben die fünf Stücke eine insgesamt reizvolle, ansprechende, angenehm zu hörende Folge, eher sacht timbriert und zurückgenommen als schwerblütig-melancholisch. Am besten, fast schon im Sinne einer kleinen Preziose, funktioniert vielleicht das Intermezzo op. 118 Nr. 2, dessen zarte, vergleichsweise lichte Introspektion sich in den Klängen der beiden Gitarren sehr gut wiederfinden lässt. Dem anderen Extrem begegnet man in den Trillerpassagen vor Wiederholung des ersten Teils der Romanze op. 118 Nr. 5, die sich auf den Gitarren schlicht nicht überzeugend darstellen lassen; hier stößt die Transkription an ihre Grenzen. Wenn überhaupt, wäre vermutlich ein entschiedenerer Eingriff in den Notentext vonnöten, wobei eine schlüssige Lösung freilich alles andere als auf der Hand liegt.
Ansonsten liegt vieles – und hier stellt sich am Ende doch mindestens teilweise die Frage nach dem Vergleich zum Original – in der Mitte. Sicherlich sind diese Stücke erst einmal vom Klavier her gedacht, und nicht jede klangfarbliche Schattierung (wie etwa der Registerwechsel im Mittelteil von op. 116 Nr. 2 oder die im Pedal gehaltenen Akkordbrechungen in op. 117 Nr. 2) erfahren wirkliche Entsprechungen. Mit dem Verzicht auf die Kontraoktave geht der Musik speziell in den akkordisch geprägten Passagen ein wenig ihre herbstliche Note verloren, dagegen gewinnen etwa die triolischen Figuren, die Brahms u. a. gerne in den Nebenstimmen einsetzt, in der Bearbeitung eine Bedeutung, die sie auf dem Klavier nicht haben; hier besteht zuweilen die Gefahr, dass sie die Melodielinie ein wenig überdecken. Am Ende steht also ein Balanceakt, der aber unter dem Strich Gewinn bedeutet, der Gitarrenliteratur Ausdruckssphären hinzufügt; dass man dieser Musik mit Vergnügen lauschen kann, steht ohnehin außer Frage.
Auf Brahms’ späte Klaviermusik folgen auf der CD zwei Stücke von Felix Mendelssohn Bartholdy. Sein Venetianisches Gondellied, das sechste des ersten Hefts seiner Lieder ohne Worte op. 19, hat bereits Francisco Tárrega (1852–1909) für Gitarre bearbeitet, und zwar in rundum geglückter Manier. Fast erwartungsgemäß – angesichts der feinen, gedämpften Melancholie des Originals – funktioniert das Stück auf der Gitarre vorzüglich, Flageoletts sorgen für ein gewisses zusätzliches schwärmerisch-atmosphärisches Moment. Neben den bekannten Klavierstücken hat Mendelssohn Bartholdy auch ein Lied ohne Worte für Violoncello komponiert, nämlich das Lied ohne Worte D-Dur op. 109, ein ganz bezauberndes, melodisch äußerst attraktives Werk, das 1845 für die junge Cellistin Lisa Christiani entstand. Der kroatische Cellist Valter Dešpalj (1947–2023; Bruder des Dirigenten und Komponisten Pavle Dešpalj) hat es für Violoncello und Gitarre arrangiert, eine Bearbeitung, die sich grundsätzlich eng am Original orientiert, abgesehen von einigen wenigen Stellen im Mittelteil, an welchen der Dialog zwischen Cello und Klavier so nicht realisiert werden kann. Cvirn wird dabei vom Cellisten Sebastian Bertoncelj unterstützt (auch er übrigens aus einer Musikerfamilie – der bekannte slowenische Pianist Aci Bertoncelj war sein Vater).
Ein zweites Mal wird die Gitarre in Schuberts Sonate für Violine D-Dur D 384 mit einem Streichinstrument kombiniert (nun mit Tanja Sonc an der Violine); die Bearbeitung stammt aus der Feder des schwedischen Gitarristen Mats Bergström (*1961). Schubert auf die Gitarre zu übertragen ist im Grunde genommen eine recht naheliegende Idee, es ist belegt, dass dies (im Falle seiner Lieder) bereits zu seinen Lebzeiten und auch in Anwesenheit des Komponisten geschah. So verwundert es vielleicht nicht, dass sich Bergströms vor rund 25 Jahren entstandenes Arrangement der (im Original ja ohnehin ebenso hinreißend charmanten wie äußerst populären) D-Dur-Sonate ganz offenbar einer nicht unbeträchtlichen Beliebtheit erfreut, jedenfalls erscheint es hier bereits zum dritten Mal auf CD. Dabei ist die Kombination Violine und Gitarre nicht einmal ganz unproblematisch (obwohl sie bereits im frühen 19. Jahrhundert u. a. von Giuliani oder Paganini mit Repertoire bedacht wurde), und an einigen wenigen Stellen – nämlich dann, wenn forciert wird – tendiert die Balance etwas zu sehr in Richtung Violine. Insgesamt aber ist dies eine reizvolle Bearbeitung (die sich zum Original ähnlich verhält wie Dešpaljs Mendelssohn-Arrangement).
Bereits 1845 gab der Wiener Gitarrenvirtuose Johann Kaspar Mertz (1806–1856) seine Sechs Schubert’schen Lieder heraus, Arrangements von Schubert-Liedern für die Gitarre also, teilweise übrigens unter Einbeziehung von Liszts Klaviertranskriptionen (vgl. etwa die Echoeffekte in der zweiten Strophe des Ständchens). Cvirn hat drei dieser Bearbeitungen ausgewählt und ans Ende seines Programms gestellt, und zwar Nr. 1 nach dem Lob der Tränen D 711 sowie Nr. 3 und Nr. 6 jeweils nach Vorlagen aus dem Schwanengesang (Nr. 4 Ständchen bzw. Nr. 10 Das Fischermädchen). Mertzs Arrangements sind ausgezeichnet gelungen, weil sie in sehr geglückter Manier Tonfall und Geist Schubert’scher Lieder mit der Idiomatik der Gitarre kombinieren; Mertz lässt die Gitarre auf mannigfaltige und im Detail bemerkenswert einfallsreiche Art und Weise regelrecht „singen“. Trotz auch hier relativ enger Orientierung am Original sind diese Stücke also nicht nur Bearbeitungen, sondern auch ein Stück weit poetische Nachschöpfungen von Schuberts Liedern.
Cvirns Plädoyer für diese Repertoireerweiterungen gerät insgesamt überzeugend. Besonders hervorzuheben sind seine Interpretationen von Mertz’ Schubert’schen Liedern. Hier ist Cvirn hörbar ganz in seinem Element und wartet mit beseeltem, sanglichem Spiel und viel Sinn für allerhand Details und Nuancierungen wie kleineren Rubati, Smorzandi oder delikatem Dolce-Spiel auf. Insofern ist es eigentlich zu bedauern, dass er nicht den gesamten Zyklus eingespielt hat (Platz genug wäre auf der CD gewesen – vermutlich eine Entscheidung im Sinne der Balance des Programms). Gut gelungen auch die Brahms-Adaptionen, in denen Cvirn und Cerkovnik immer wieder Sensibilität für kurze Momente des Innehaltens, des Zögerns beweisen. Hier und da wäre allerdings etwas mehr musikalischer Fluss möglich, vielleicht durch eine Spur zügigere Tempi (was dem naturgemäß rascheren Verklingen der Töne auf der Gitarre ein wenig entgegenwirken würde).
Mendelssohns Lied ohne Worte erfährt im Zusammenspiel mit Bertoncelj eine solide Interpretation; hier wäre allerdings noch mehr Differenzierung möglich, um die Eleganz, den Schmelz und die weiten kantablen Linien dieser Musik zu voller Geltung kommen zu lassen. Ansprechend ist die Lesart von Schuberts Sonate durch Sonc und Cvirn. Hier und da wäre noch etwas mehr Differenzierung möglich, etwa beim Rondothema des 3. Satzes, bei dem man zugleich etwas stärker ins Piano zurückgehen und der Musik mehr Esprit verleihen könnte. Im Vergleich musizieren Sparf/Bergström selbst dezidiert historisch informiert, während Migdal/Kellermann (auf BIS) in dieser Hinsicht einen Mittelweg gehen; ihre Lesart wirkt in Bezug auf Sonc/Cvirn sicherlich eleganter, feiner nuanciert und in der Balance (Fortissimo zwischen Ziffern B und C im ersten Satz) etwas überzeugender, allerdings immer wieder in puncto Agogik und auch Artikulation (gleich zu Beginn, wenn die Halben in der Violine immer wieder arg verkürzt werden) mit gewissen Eigenheiten, sodass Sonc/Cvirn hier als eine solide, unmanierierte Alternative gelten können. In der Totalen eine schöne Veröffentlichung.
[Holger Sambale, Dezember 2023]