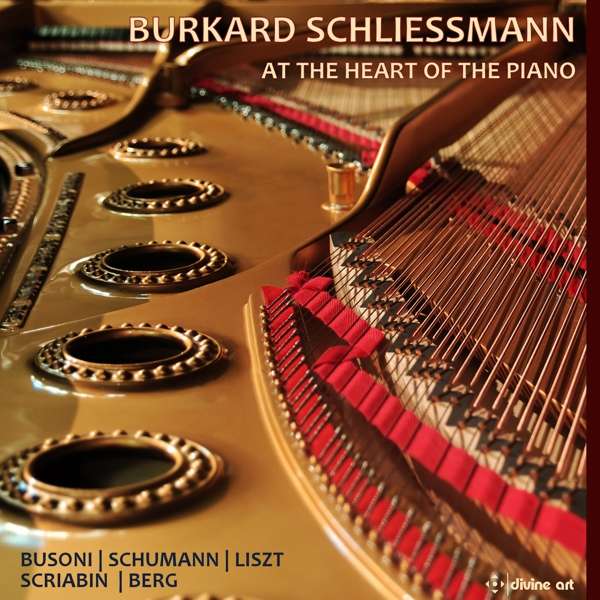Das Wiener Publikum hat am letzten Dienstag [30. Juli] die Möglichkeit gehabt und leider teilweise verpasst, einem außergewöhnlichen Klavierabend beizuwohnen. Es ist durchaus entschuldbar: es ist Sommer, und man hält sich großteils auf dem Land oder in der Ferne auf; alles macht Pause, während die Touristen mit Touristenkonzerten in Perücke und Kostüm abgespeist werden. Andererseits ist es aber vollkommen unentschuldbar, da es hier wenigstens zwei Entdeckungen zu machen gab, und einem Konzert zu lauschen, wie man es nicht oft zu erleben das Glück hat.
Die erste Entdeckung betrifft den Konzertort. Man kennt das etwas renovierungsbedürftige, aber gerade dadurch sehr charmante Jugendstiltheater im Otto-Wagner-Areal mehr vom Hörensagen. Dem Publikum ist es hauptsächlich durch die Wiener Festwochen bekannt, und zur Zeit finden dort die Konzerte der Wiener Meisterkurse statt.
Die Geschichte des Areals, erbaut zwischen 1905 und 1907, umfasst einerseits die Absicht, einen echten Fortschritt für die Patienten in der Psychatrie zu erreichen, andererseits war das Areal aber auch Schauplatz der NS-Euthanasie-Morde am Spiegelgrund, denen Hunderte von Kindern zum Opfer fielen, an die das Mahnmal aus einem zarten Meer von Lichtstelen vor dem Jugendstiltheater erinnert. Diese Gegenwärtigkeit der Vergangenheit verleiht dem schönen Ort einen Ernst, dem sich die Konzertbesucher vor allem beim Verlassen des Theaters in der Dunkelheit nicht entziehen können
Der kleine Saal des Jugendstiltheaters verfügt über eine schöne Akustik dieses kleinen Saals. Im ersten Eindruck etwas überakustisch, verwandelt sich der Saal im Konzert in einen Resonanzraum für feinste musikalische Details.
Diese waren an diesem Abend, und das ist die zweite und eigentliche Entdeckung, dem Pianisten Martin Hughes zu verdanken, der dem Publikum in Wien vor allem als ehemaliger Vorstand der Klavierabteilung der Musikuniversität mdw ein Begriff ist. Dass er selber ein außergewöhnlicher Pianist und Musiker ist, ist ein vielleicht allzu gut gehütetes Geheimnis, das sich jedoch dem mit Staunen zuhörenden Publikum sofort offenbarte.
Das Konzert begann mit der 1. Klaviersonate op. 2 Nr. 1 von Ludwig van Beethoven, die Martin Hughes mit größter Klarheit und Unmittelbarkeit zu Gehör brachte. Man horcht auf, weil alles, was man vom Pianisten an dem hervorragenden Bösendorfer-Flügel hörte, einfach und richtig war, man folgt der erhellend selbstverständlichen Bewegung der Musik: frei von interpretatorischer Über-Absichtlichkeit der Darstellung geschieht ein natürliches Sich-Entfaltenlassen der Musik durch den Pianisten, dem das Publikum gebannt lauschte.
Alles war an seinem Platz, jede Note, jede Phrase, jede Gestalt, und nicht zuletzt der Raum selber: dass dieser mit seiner Akustik immer ein Teil der klanglichen Realität ist, und damit einen Einfluss auf Spiel und Tempo hat, ist eine Erkenntnis, die sogar unter Musikerinnen und Musikern nicht selbstverständlich ist, sich an diesem Abend aber als ein Aspekt der absoluten Meisterschaft von Martin Hughes zeigte.
Die pianistische und kompositorische Brillanz der Intermezzi op. 4 von Robert Schumann entfalten sich unter seinen Händen frei und umstandslos. Doch lief alles an diesem Abend auf die Sonate in B-Dur, op. posth. D960, von Franz Schubert hinaus.
Diese spielte Martin Hughes auf eine Weise, dass man Angst hat, sie jemals wieder anhören zu müssen, weil es schwer vorstellbar ist, dass es mehr als einmal im Leben möglich ist, dieses Werk in seiner Schönheit, Tiefe und geistigen Klarheit so vollkommen wiedergegeben zu hören.
Dabei folgt Martin Hughes einem scheinbar einfachen Ansatz; einem, der streng genommen keiner ist: er hört dem Stück zu und sich selber, während er spielt. Es scheint banal und wie eine Selbstverständlichkeit, es ist aber keine. Und in welche seelische Tiefe sich der langsame Satz damit ausbreitet, wie die Dinge, die man einfach nicht beim Namen nennen kann, erscheinen und entstehen, ist eine wunderbare und schlüssige Konsequenz aus dieser Musizierhaltung.
Die Idee, dass man als Musiker oder Musikerin sich selber ausdrückt durch das Werk, dass man es interpretiert, dass man eine persönliche Art der Darstellung, also eine eigene Interpretation, formt, wird auf diese Weise obsolet und löst sich ganz in Luft auf, weil es bei Martin Hughes nur noch um das freie Spiel der Kräfte geht, die Schubert auf dem Notenpapier gebunden und niedergeschrieben hat.
Man kann diese Sonate natürlich auch anders spielen, da sich das Spiel der Kräfte unter anderen Bedingungen vielleicht auch anders entfalten mag, aber an diesem Abend war die Sonate so wahrhaftig und vollkommen wie nur möglich, und wie sie komponiert wurde.
Die Schönheit der Musik existiert ja tatsächlich nur im Moment des Erklingens; also in einer Zeitspanne, die so jenseits der gemessenen Zeit ist, dass sie ohne Zeit wahrgenommen wird, also nicht eigentlich als Zeit wahrgenommen wird. Das ist nun nicht neu, aber der Zeit auf diese Weise als Maß des Vergehens zu entkommen, ist immer wieder eine besondere, schöne, und vor allem plötzliche Erfahrung, der man erst gewahr wird, wenn sie gerade wieder vorüber ist. Und mit dem Verklingen des Werkes ist der Moment, das Momentum des musikalischen Erlebnisses vorbei und unwiderruflich vergangen. Und so klingt die Musik in den Konzertbesuchern noch lange nach. Denn es ist ja nicht nur die Musik, die nachklingt, sondern ihr Wesen, dem wir in Konzerten wie diesem begegnen und lauschen.
Nur Menschen, die ihr Leben damit verbringen, in das Wesen der Musik einzudringen, sind in der Lage, solche seltenen Ewigkeitsmomente zu erschaffen. Michelangeli sagte einmal, dass ein Leben gerade so dazu ausreicht, eine Sache gut zu machen. Dies ist das Niveau, auf dem sich Martin Hughes pianistisch, musikalisch, und vor allem geistig bewegt, und das ist das eigentliche, das das Publikum in diesem Konzert erleben konnte.
[Jacques W. Gebest, August 2024]