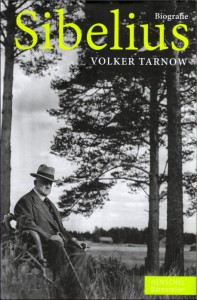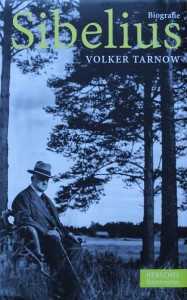ISBN: 978-3-89487-941-9 (Henschel), 978-3-7618-2371-2 (Bärenreiter)
Der Musikkritiker und Journalist Volker Tarnow verfasste anlässlich des 150. Geburtstags von Jean Sibelius, stattfindend am 8. Dezember 2015, die aktuellste Biographie, erschienen beim Henschel Verlag.
Eine biographische Würdigung des wohl bedeutendsten finnischen, aber schwedisch aufgewachsenen Komponisten Jean Sibelius ist eine sehr zu begrüßende Unternehmung, allein schon angesichts der immer noch spärlichen Literatur und Forschung zu dieser faszinierenden Persönlichkeit im deutschsprachigen Raum. Umso erfreulicher ist es dann auch, wenn Volker Tarnow auch bislang unübersetzte finnische Quellen wie beispielsweise Tagebucheinträge mit einbezieht. Herausgekommen sei dabei, so die Verlagsinformation, eine „Biografie, die ebenso den Menschen wie den Künstler im Fokus hat und zugleich eine ganze Epoche skizziert.“
Im Großen und Ganzen betrachtet erfahren hier tatsächlich ein Künstlerleben und dessen Zeitumstände eine eingehende Betrachtung, teilweise um kleinste Details und um literarisch-künstlerische wie historische Aspekte des damaligen Europa und Skandinaviens bereichert. Mehr noch, Tarnow versteht es, in einem Stil zu schreiben, der alles andere als trocken wirkt und den Leser in einem clever inszenierten Drama um den einzigartigen Künstler und Menschen Sibelius mitzureißen versteht.
Dabei mutet es jedoch etwas befremdlich an, dass viele Stellen (vor allem zeittypische Rezensionen) mit Belegen gespickt sind, während wiederum andere Passagen es scheinbar nicht nötig haben, nachgewiesen zu werden. Anders gesagt: Tarnow spart nicht damit, Behauptungen aufzustellen, die der nachvollziehbaren Grundlage entbehren. So lautet ein Beispiel von S. 127: „Dass der Geförderte (…) drei Monate lang in Berlin blieb und Sauern mit Persiko trank, (…) schockierte Freund Carpelan und Frau Aino doch ziemlich.“ Gewitzt konterkariert Tarnow dann in Bezug auf weitere Geldspenden, die Sibelius erhielt: „(…) niemals davor und danach tätigte Finnland eine bessere Investition.“
Sätze von solcher Art finden sich immer wieder, es fängt bereits beim Inhaltsverzeichnis der chronologisch aufgebauten Biographie an, wo romantisierende und modische Begrifflichkeiten wie „Karelische Träume“ und „Beethoven-Matrix reloaded“ einzelne Abschnitte aus Sibelius‘ Leben zu versinnbildlichen scheinen. Das sind allerdings nur sprachliche Kleinigkeiten, die ins Auge fallen. Tarnow gibt sich hinter seiner plakativen Inszenierung sehr wohl alle Mühe, ein differenziertes Bild von Jean Sibelius zu zeichnen, was ihm zum guten Teil auch gelingt. Es wirkt sogar ziemlich sympathisch, einen im Grunde eher egomanischen Komponisten zu skizzieren, der es trotz aller Tiefen und Abstürze im Leben am Ende zu etwas gebracht hat. Gleiches gilt für andere gewichtige zeitgenössische Kollegen Sibelius’ und deren Haltung zu ihm. Ein überraschendes Beispiel hierzu liefert Gustav Mahler, dessen Vorurteile gegen skandinavische Musik – für einen Weltkomponisten! – hier schonungslos präsentiert werden (vgl. S.160). Was dabei immer wieder unterschwellig ins Auge fällt, ist eine recht tendenziöse Art, die immer wieder Kopfschütteln auslöst. Es geht gar nicht so sehr um den häufig kolportierten Alkoholismus des Komponisten; der Autor möchte, trotz aller literarischen Raffinesse und Reflexion, Sibelius doch als den einzig ganz großen Musiker des 20. Jahrhunderts darstellen, während alle Musiker seinerzeit, trotz aller Würdigung, diesen Status niemals erreichen können. Warum sonst sollte Tarnow solche Sätze äußern wie ganz am Ende auf S. 277: „Irgendwann wird es sich herumsprechen, dass mit ihm die wahre Avantgarde begann, die Musik der Zukunft.“ Sicherlich war Sibelius eine singuläre Erscheinung und sowohl seinerzeit als auch in der Folge einflussreicher, als es manch deutschsprachiger Musikwissenschaftler eingestehen wollte. Dennoch könnte man bei Sätzen wie dem eben zitierten meinen, es handle sich mehr um einen Anti-Adorno-Reflex als um ein differenziertes Künstlerporträt.
Auch wenn es sich hier um keine wissenschaftliche Arbeit handelt, so hat diese Biographie doch deutlich ehrgeizige intellektuelle Ansprüche. Nun werden die daraus resultierenden Erwartungen, wie man vielleicht meinen könnte, keineswegs regelmäßig enttäuscht. Stimmig etwa beschreibt Tarnow den inneren Identitätskonflikt des Komponisten, was seine schwedischen und finnischen Wurzeln anbelangt, wodurch zumindest einige Charakterwidersprüche erklärt werden können. Besonderen Wert legt der Autor auch auf Seismogramme wichtiger Freundschaften, die der Komponist Zeit seines Lebens pflegte, wie zum Dirigenten Robert Kajanus. Doch sind auch diese Versuche nicht gänzlich frei von Überzeichnungen, zumal auch hier oftmals von einem Sibelius die Rede ist, der sich aller Förderung zum Trotz als undankbarer, zugleich auch eifersüchtiger Künstler und Freund erwies, wohingegen Kajanus offenbar von unendlicher Gutmütigkeit war (siehe etwa S. 165).
Erwähnenswert sind auch die musikalischen Analysen seiner Symphonien sowie zahlreicher anderen Opera. Besonderes Augenmerk legt der Autor auf Gelegenheitswerke, Kammermusik sowie Bühnen-Auftragswerke wie Kuolema oder die vielgespielte Karelia-Suite. Nicht zu vergessen sind die Beschreibungen seiner zahlreichen Liederzyklen, wobei Tarnow gerne das literarische Milieu der Liedtexte in Augenschein nimmt, dabei auch kompetente Einblicke in skandinavische Lyrik gibt. Sieht man auch hier von dem Eindruck, Sibelius immer wieder alleingültig zu glorifizieren, sowie der ziemlich blumigen Wortwahl ab, so kommen doch auch für gestandene Sibelius-Experten einige neue Erkenntnisse ans Tageslicht. Gerade in den Beschreibungen der Symphonien verfolgt Tarnow einen roten Faden, an dem sich Sibelius’ künstlerischer Werdegang ablesen lässt, und liefert informatives, aber niemals langweilendes Wissen beispielsweise zur Fassungs- und Deutungsproblematik der 5. Symphonie in Es-Dur Op. 82. Gleichzeitig findet sich auch hier wieder das oben beschriebene Problem: Tarnow behält seinen fantasievollen, ja kapriziös interpretierenden Erzählstil auch in den Analysen bei, wodurch bisweilen ein religiös verbrämter Beigeschmack entsteht (vgl. S. 227: „Sie [die Sinfonie Nr.5] verweist auf Kräfte, die größer sind als der Mensch, von ihm aber geahnt und ehrfürchtig bewundert werden können.“).
Als Fazit ist zu vermerken, dass die vorliegende Lektüre in ihrem Inhalt mit Bedacht zu genießen sei. Doch ist Tarnows schillernder Beitrag zum Jubiläumsjahr im Großen und Ganzen lohnend und verdienstvoll und möge die Beschäftigung mit Sibelius sowie dessen wissenschaftliche Würdigung gerade auch nach dem Jubiläum noch weiter vorantreiben!
[Peter Fröhlich, Dezember 2015]