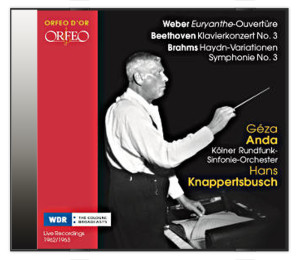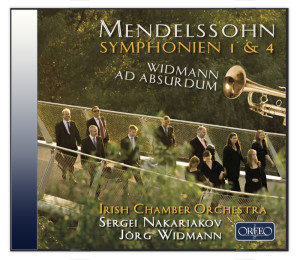Orfeo C260352; EAN: 4 011790 260228

Fast 90 Jahre nach ihrer Fertigstellung war die Uraufführung von Eugen Engels (1875–1943) Oper „Grete Minde“ im Februar 2022 am Theater Magdeburg unter Leitung von Generalmusikdirektorin Anna Skryleva schon eine kleine Sensation, die auch überregional hohe Beachtung fand. Ein erstaunliches Beispiel für bislang im Verborgenen schlummerndes Opernschaffen; hier eines der Öffentlichkeit bis dato völlig unbekannten deutsch-jüdischen Hobbykomponisten, der 1943 von den Nazis ermordet wurde, dessen einziges Bühnenwerk jedoch als Partitur überlebte, die erst von der Enkelin ihres Schöpfers ans Licht gebracht worden war. Der Live-Mitschnitt der Premiere auf Orfeo ist zumindest eine hörenswerte Rarität.
Nicht ganz zu Unrecht wurde bei der Wiederentdeckung und Uraufführung von Eugen Engels „Grete Minde“ hinterfragt, ob angesichts der Unmengen an Opern, die es bislang nie auf eine Bühne geschafft haben, nicht allein das persönliche Schicksal des Komponisten die entscheidende Rolle gespielt haben dürfte. Eugen Engel – geboren 1875 im masurischen Teil des damaligen Ostpreußens, später hauptberuflich Kaufmann in Berlin – war als engagierter deutsch-jüdischer Bildungsbürger insbesondere der Musik zugewandt. Privat hatte er Kompositionsunterricht bei Otto Ehlers genommen, war aber anscheinend weitgehend Autodidakt. Nach 1905 wurden zwar einige Werke von Laienmusikern aufgeführt – eine abendfüllende Oper war allerdings schon ein anderes Unterfangen. Dass Engels Wahl des Stoffes hier ausgerechnet auf Theodor Fontanes Novelle „Grete Minde“ fiel, der ein historisches Ereignis zugrunde liegt, erscheint zunächst merkwürdig, da die typische, distanzierte und lakonische Sprache des Dichters wenig Opernhaftes bietet. Engels Librettist Hans Bodenstedt – der später als überzeugtes NSDAP-Mitglied der Nazi-Propaganda zuarbeitete und nach dem 2. Weltkrieg Karriere beim NWDR machte – verfasste den Operntext bereits 1914, und der Komponist arbeitete somit bald 20 Jahre an seinem Projekt. Nach der Vollendung 1933 war natürlich an eine Aufführung in Deutschland nicht mehr zu denken, und auch die Korrespondenz mit Bruno Walter, Leo Blech und Edwin Fischer ebnete keine neuen Wege außerhalb der Heimat. Während Engels Tochter Eva 1935 nach Amsterdam floh und 1941 in die USA gelangte, wurde Eugens geplante Ausreise über Kuba im letzten Moment vereitelt: Sein Schicksal endete 1943 in der Mordmaschinerie des Vernichtungslagers Sobibor.
Eva Lowen versuchte kurz, den Namen ihres Vaters bekannt zu machen, aber erst Eugens Enkel beschäftigten sich ab 2006 intensiver mit dessen kompositorischen Hinterlassenschaften. Der Weg bis zur Uraufführung von „Grete Minde“ in Magdeburg ist einigen glücklichen Umständen geschuldet, hauptsächlich der Tatsache, dass die neue Generalmusikdirektorin, die Russin Anna Skryleva, von dem Stück absolut überzeugt war. Das Theater scheute dann keine Kosten und Mühen, das Werk auf die Bühne zu bringen. Einige Qualitäten von Engels Arbeit werden sofort deutlich: Zunächst einmal funktioniert – unerlässlich für eine Oper – das richtige Timing. Bodenstedt hat die Handlung klug gerafft, behielt die in Fontanes Fassung enthaltenen „Volkslieder“ bei, und bietet in den Szenen gelungene, essenzielle Psychogramme der Protagonisten. Die Geschichte der Margarete von Minden, die durch Fontane stark abgewandelt wird, soll hier nicht dargestellt werden. Engels Musik, inspiriert einerseits durch Werke wie Wagners Meistersinger oder Leoncavallos Verismo in I Pagliacci, andererseits durchaus noch von Carl Maria von Weber, wechselt geschickt zwischen Massenszenen, die oft heiter und gezielt volkstümlich wirken, und recht bewegenden Auseinandersetzungen der Hauptfiguren. Musikalisch erstaunt vor allem Engels versierte Instrumentation, die zumeist Richard Strauss, Humperdinck – mit dem der Komponist in Kontakt stand – und Schreker als Vorbildern folgt, teils (Glockenspiel etc.) Korngold-nah klingt. Skryleva hat das Orchester leicht ausgedünnt – etwa vier statt sechs Hörner –, erreicht so ein hohes Maß an Durchsichtigkeit und ermöglicht ihrem Sängerensemble immer adäquates Durchkommen.
Wollte Engel hier eine Art spätromantische „Volksoper“ schreiben? Die dafür aufgewandten Mittel erscheinen eher naiv und sind Anfang der 1930er schon klar aus der Zeit gefallen. Trotzdem gelingt, die stets unterschwellig vorhandenen Religionskonflikte kurz vor dem Dreißigjährigen Krieg durchgängig zu thematisieren. Wirklich berühren dann etliche Dialog-Momente, so der Tod von Gretes Partner Valtin oder die Zuspitzungen im dritten Akt. Etwas übernommen hat sich der Komponist leider in der rein dramaturgisch durchaus zwingenden Schlussszene. Wenn Grete Tangermünde abfackelt und mit ihrem Sohn schließlich im brennenden Kirchturm als eine Art Fanal zu Tode kommt – die historische Figur endete auf dem Scheiterhaufen –, will die Musik dann trotz erkennbarer Rückgriffe auf Wagners „Feuerzauber“ der Walküre nicht so recht zünden. Sowas beherrschten etwa Schreker oder Strauss doch um Klassen besser.
Die Leistungen der Magdeburgischen Philharmonie und des Chores sind fast makellos. Skryleva schafft es, die heterogenen Momente dieser leicht querständigen Oper unter einen Hut zu bringen. Bei der Sängerriege zeigen sich die Damen den männlichen Protagonisten deutlich überlegen, allen voran die großartige Raffaela Lintl in der Titelrolle: emotional mitreißend, dabei immer mit klanglich ausgewogener Sopranglut. Auf gleichermaßen hohem Niveau bewegt sich Kristi Anna Isene als Trud. Von den Herren begeistern allenfalls Marko Pantelić als Gerdt sowie Benjamin Lee als Hanswurst, wo hingegen Zoltán Nyári (Valtin) ziemlich blass agiert. Bei den kleineren Rollen hört man teils nicht deutlich genug akzentuiertes Deutsch – sei’s drum.
Der Live-Mitschnitt – eine Co-Produktion mit Deutschlandradio Kultur – ist aufnahmetechnisch ohne Tadel, mit den üblichen Einschränkungen einer Bühnenaufnahme. Nur hätte man für eine CD-Veröffentlichung auf gute fünf Minuten (!) Schlussapplaus gerne verzichten können. Die Booklet-Infos der Dramaturgin Ulrike Schröder sind ausführlich, das Libretto ist komplett abgedruckt. Was bleibt? Zündende Melodien oder gar Ohrwürmer hat „Grete Minde“ nicht zu bieten; die Dramatik hält sich in Grenzen. Bruno Walter lobte zwar Eugen Engels solides Handwerk, vermisste dabei jedoch jegliche Individualität. Dem darf man zustimmen, muss dabei aber anerkennen, dass diese Oper zumindest funktioniert – wenn die Beteiligten mit so viel Herz an die Sache herangehen wie in Magdeburg. Einmal mehr reift die Erkenntnis, wie groß doch die Zahl ungehobener, hörenswerter Opernschätze tatsächlich sein mag. Auf CD eine willkommene Rarität – die es schon in die Vierteljahresliste des Preises der deutschen Schallplattenkritik schaffte –, muss sich die Repertoirefähigkeit dieser Entdeckung erst noch erweisen.
[Martin Blaumeiser, Dezember 2023]