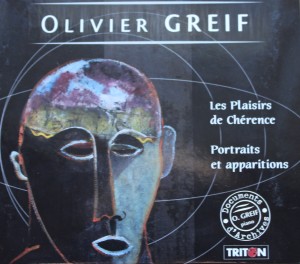Lucy Jarnach spielt am 24. September 2016 um 20 Uhr
im Kleinen Konzertsaal im Gasteig: Schubert, Grieg, Jarnach, Greif
Wenn es in der Welt richtig zuginge, müssten alle Menschen einen ebensolchen Weltblick besitzen wie Bismarck, ein ebensolches Gehirn wie Kant, einen ebensolchen Humor wie Busch, ebenso zu leben verstehen wie Goethe und ebensolche Lieder singen können wie Schubert. (Egon Friedell 1878-1938)
Und es ging in der Welt richtig zu an diesem Samstag-Abend im Kleinen Konzertsaal im Gasteig in München, als die Pianistin Lucy Jarnach sich an den Steinway-Flügel setzte und die ersten Akkorde der G-Dur-Klaviersonate D894 erklingen ließ. Denn was Egon Friedell uns in seiner Kulturgeschichte der Neuzeit über Franz Schubert so hellsichtig beschreibt, das stimmt ja. Diese auch heute noch immer wieder überraschende und berührende Sonate aus Schuberts letzten Schaffensjahren, sie ist und bleibt ein Mysterium – wenn der spielende Musiker sie so erlebbar werden lassen kann, wie uns das die junge Lucy Jarnach besonders eindrucksvoll vom ersten bis zum letzten Ton vorspielte, nein, besser, vorlebte, „vorsang“. Denn Schuberts himmlische Melodien und höchst überraschende Harmonien – seiner damaligen Zeit genau so voraus wie die seines hochverehrten Kollegen Beethoven, wenn auch von völlig anderen Ideen und Möglichkeiten geschöpft – müssen erst einmal zusammenhängende Gestalt gewinnen und singen und klingen, wenn sie uns erreichen sollen. Mit aller geheimnisvollen Neuartigkeit, die auch heute, 250 Jahre später so in Bann schlagen kann, wie sie Lucy Jarnach mit verzaubernder Kantabilität und wohllautendstem Klang auf dem Steinway-Flügel hervorspielte. Drei langsame Sätze und ein schnellerer vierter, dann war der erste Teil des Abends in seiner Verzauberung vorüber. (Wieder einmal musste ich daran denken, dass Schubert viele Jahre lang nur ein abgespieltes Tafelklavier zur Verfügung stand, was würde der wohl heute für Ohren machen (können)!)
Der zweite Teil begann mit einer kurzen Erklärung der Pianistin zu Edvard Griegs Ballade g-moll op. 24 von 1878, einem Stück, was sehr vielen Zuhörern noch immer ziemlich unbekannt sein dürfte. Ein melancholisches, an ein norwegisches Volkslied angelehntes Thema wird im Lauf der Komposition in 14 Variationen abgewandelt: sowohl harmonisch als auch melodisch, in allen Klangregistern des Flügels.
Was mich an Griegs Klaviermusik schon immer fasziniert , ist seine weit in die Zukunft weisende Harmonik, eine Tonalität und Klanglichkeit, die teils sogar den Impressionismus eines Debussy schon vorweg zu nehmen scheint. Und auch bei den viel bekannteren Lyrischen Stücken ist für mich wieder und wieder erlebbar, dass Grieg eben nicht nur der leicht fassliche „Unterhaltungs-Komponist“ kleiner Formen war, sondern in vielen seiner Werke – wie das auch Lucy Jarnachs Spiel sehr überzeugend zum Ausdruck brachte – ein durchaus in der Entwicklung vorausschauender Künstler und Komponist war.
Im Anschluss daran folgte eine Sonatine über eine alte Volksweise, op. 33 (eigentlich ist es eine Komposition von Leonhard Lechner (1553-1606), die dem Stück zu Grunde liegt) von Philipp Jarnach, dem Großvater der Pianistin, der von 1892-1982 lebte und seine entscheidenden Impulse von Ferruccio Busoni (1866-1924) bekam. Diese Sonatine spielte Lucy Jarnach mitnichten aus einer verwandtschaftlichen Verehrung für ihren Großvater, sondern zeigte uns, was für ein wunderbares Stück Musik da unter ihren Händen zu uns sich entfaltete, durchaus tonal und melodiös, aber doch ein Stück zeitgenössische Musik aus dem 20. Jahrhundert.
Das letzte Stück des Abends des frühverstorbenen französischen Komponisten Olivier Greif – dürfte den allermeisten Konzertbesuchern sicher völlig unbekannt gewesen sein, wie die Musik dieses aberwitzigen Franzosen leider bei uns bis heute so gut wie gar nicht auftaucht. Er wurde 1950 als Sohn eines jüdisch-polnischen Neurochirungen geboren, der die Gräuel in Auschwitz überlebte. Diese Tatsache beeinflusste die Musik seines Sohnes, der mit 9 Jahren anfing zu komponieren. Aus «Le Rêve du monde» (1993)
Spielte Lucy Jarnach den dritten Satz «Wagon plombé pour Auschwitz». Das Thema ist eine jiddische Melodie, die allerdings nach kurzer Zeit durch gewalttätige „Schüsse“ zerrissen wird, darstellend die Horrorszenen, denen die in den Viehwagons Eingesperrten dann in Auschwitz ausgesetzt waren. Das unfassbare Grauen so auf einem Klavier darstellen zu können, ist eigentlich unvorstellbar, trotzdem ist es dem Komponisten und auch der Pianistin gelungen, in diesem kompakten Stück all das auf sehr eindrückliche Weise den Zuhörern zu vermitteln.
Großer, verdienter Beifall für die Pianistin und ein Programm, das so sicherlich im ach so konservativen München – noch dazu zur Wiesn-Zeit – noch nie zu hören war.
Mit einer kurzen Zugabe (‚Fast zu ernst’ aus Schumanns op. 15, den „Kinderszenen“) entließ uns Lucy Jarnach in einen sehr nachdenklichen Abend.
(Auch die „Gräuel“ dieses Abends seien ganz am Rande erwähnt, also der vollendete Amateurismus des lokalen Veranstalters, der das Konzert miserabel beworben hatte und sowohl dem unterzeichnenden Kritiker eine Pressekarte als auch der Künstlerin Blumen verweigerte. Sein Mangel an Professionalität wurde jedenfalls mit einem fantastischen Auftritt belohnt.)
Oder, um mit Egon Friedell abzuschließen:
„Es gibt Menschen, die selbst für Vorurteile zu dumm sind.“
[Ulrich Hermann, September 2016]