Zum zweiten Mal hatte ich das Glück, den Festspielen in Bergen beiwohnen zu dürfen. Drei Tage verbrachte ich in Norwegens zweitgrößter Stadt, besuchte Proben und Konzerte. König Haakon VII eröffnete 1953 die ersten Festspiele, welche sich auf Edvard Griegs „Musikkfest i Bergen“ von 1898 beriefen. Mittlerweile gelten sie als größtes Musikfest Nordeuropas, welches einmal jährlich im Lauf von 15 Tagen mehr als 200 Veranstaltungen bietet. Mehrere Bühnen und Festzelte zieren Bergen in der Zeit der Festspiele und auch die Häuser der Komponisten Edvard Grieg (Troldhaugen), Ole Bull (auf der Insel Lysøen) und Harald Sæverud (Siljustøl) öffnen ihre Pforten für mehr oder weniger kleine Wohnzimmerkonzerte. Besonders fällt dabei die Intimität auf, die sich das Festival trotz des enormen Besucheransturms gewahrt hat: Die Musiker interagieren mit dem Publikum und sitzen, wenn sie gerade nicht auf der Bühne stehen, oft selbst im Zuschauerraum. Schnell kommt man ins Gespräch mit anderen Hörern oder den Musikern, man fühlt sich sofort aufgenommen.
Die Anreise von München am 23. Mai dauerte mit Stopp in Oslo etwa vier Stunden und mit der Byban (Stadtbahn) braucht man etwa eine dreiviertelte Stunde direkt zum Bypark (Stadtpark). Schon hier begegnete mir Musik: Bei jeder der 26 Stationen erklingt eine andere Melodie, beim Ausstieg zu Siljustøl natürlich ein Klavierstück Sæveruds und bei Troldhaugen Griegs Klavierkonzert.
Direkt nach meiner Ankunft eilte ich bereits ins erste Konzert: Das Concerto Copenhagen spielte alle sechs Brandenburgischen Konzerte Bachs in der Håkonshallen, geleitet von Lars Ulrich Mortensen am Cembalo. Das imposante Gebäude mit seinen düsteren Steinwänden und den kunstvoll verzierten Fenstern wurde 1247-1261 vom König Håkon Håkonsson im Königshof als Festsaal errichtet und im späten 19. Jahrhundert grundlegend restauriert und wiederhergestellt. Der große Saal eignet sich ideal beispielsweise für Chorkonzerte, ist jedoch deutlich zu groß für Auftritte mit historischen Instrumenten aus der Barockzeit, wie ich bei den Brandenburgischen Konzerten bemerkte. Selbst bei mir in der achten Reihe kam kaum Dynamik an, die Musik verlor sich nach oben zur hohen Decke hin. So lässt es sich schwer sagen, ob es den Musikern oder rein der Akustik der Halle zu verschulden war, dass die erste Violine die anderen Streicher vollkommen überdeckt hat und noch weniger vor den Flötistinnen Katy Bircher und Kate Hearne Haltmachte, deren kunstvolle Soli im vierten Konzert sich fast zur Unhörbarkeit auflösten. Die im F-Dur-Konzert hinzukommende Oboe kam etwas besser zum Vorschein. Neben der ersten Geige trat meist auch das Cembalo überlaut auf, besonders das fünfte Konzert wurde mehr zum Solokonzert als zum Concerto Grosso, die Flöte verblasste vollkommen und selbst die Geige fiel teils hinter dem Clavier zurück. Am besten gelang das B-Dur-Konzert mit den phänomenalen Bratschensolisten John Crockatt und Simone Jandl, die enorme Fülle und Farbe aus ihren Instrumenten lockten. Man muss dem Concerto Copenhagen zugutehalten, dass sie mit größter Leidenschaft und Spielfreude musizieren, die wirklich ansteckend auf das Publikum wirkte – schade hingegen, dass sie darüber hinaus den Bezug zu stimmigen Tempi missachteten. Gerade bei einer so gewaltigen Halle mit für diese Besetzung schwieriger Akustik, hätten ruhigere Tempi sich wohltuend auf den Gesamteindruck ausgewirkt; statt dessen rasten die Musiker durch die Randsätze, überspielen so zahllose harmonische und kontrapunktische Finessen, und nahmen selbst die mit Adagio überschriebenen Sätze zügigen Schrittes.
Nachdem ich den folgenden Tag hauptsächlich Proben des bevorstehenden Hvoslef-Konzerts beiwohnte, hörte ich am Abend eine erfrischende Gegendarstellung, was man aus der Akustik der Håkonshallen herausholen kann. Der Edvard Grieg Kor (Hilde Hagen, Ingvill Holter, Turid Moberg, Daniela Iancu Johannessen, Tyler Ray, Paul Robinson, Ørjan Hartveit und David Hansford) sang die Fire salmer op. 74 von Edvard Grieg (Arr. Tyrone Landau), Sæterjentes søndag von Ole Bull und Aften er stille von Agathe Backer-Grøndahl (Arr. Paul Robinson), sowie drei Sätze aus Griegs Holbergsuite arrangiert von Jonathan Rathbone für Chor.
Der Bariton Aleksander Nohr sang das Solo in Griegs Salmer mit einfühlsamer und sonorer Stimme, ging klanglich auf den erweiterten Edvard Grieg Kor, hier geleitet von Håkon Matti Skrede, ein und verschmolz mit ihnen zu einer Einheit. Beim letzten Psalm, Im Himmel, stieg er zur gläsernen Rosette auf und ließ seine Stimme feinfühlig von oben aufs Publikum herunterregnen. Zwischen den vier Psalmen trat Silje Solberg an der Hardingfele (Hardangerfiedel) auf, zauberte echt norwegischen Flair in den Saal, in enormer stilistischer Fülle der markanten, dissonanzgeladenen Tonsprache nordischer Folklore. Die folgenden Werke sang das Oktett des Chors alleine, wobei sich die Stimmen vortrefflich mischten. Leicht und frisch klangen sie, durchdrangen die polyphonen Strukturen und stimmten die einzelnen Melodielinien genauestens aufeinander ab. Zuletzt gab es drei Sätze aus Griegs Holberg-Suite, wobei sich das Arrangement vor allem auf die Streichorchesterfassung stützt, sich jedoch den menschlichen Stimmen anpasst – eine wirklich funktionierende Bearbeitung!

Direkt im Anschluss fuhr der Bus nach Troldhaugen, dem Wohnsitz von Edvard Grieg, wo sich auch dessen Grab sowie sein Komponierhäuschen befinden. Mittlerweile steht neben dem Haus ein Konzertsaal und ein Museum, doch das heutige Konzert findet in Griegs Wohnzimmer auf seinem Steinway von 1892 statt: Paul Lewis spielt die Diabellivariationen op. 120 Ludwig van Beethovens. Vorletztes Jahr durfte ich selbst feststellen, wie anders sich Griegs Steinway im Vergleich zu heutigen Klavieren spielt und welch enorme Flexibilität vom Pianisten verlangt wird, dem Anschlag, Pedal und Klang die volle Substanz zu entlocken. Paul Lewis fiel dies leicht, problemlos differenzierte er in Anschlag und Pedalisierung, holte aus jeder der 33. Veränderungen Beethovens eine eigene Klangwelt. Die einzelnen Variationen setzte er deutlich voneinander ab, was ihnen einerseits für sich betrachtet Kontur verlieh und ihre Besonderheiten unterstrich, andererseits jedoch die zwingende Finalkonvergenz unterminierte. Den Akkorden gab Lewis Kern und Griff, ohne sie donnern zu lassen, die Gedanken der jeweiligen Veränderung meißelte der Pianist deutlich heraus. Vor allem die Rhythmik bedachte Lewis, fokussierte sich auf die punktierten Noten und ließ sie deutlich hervorstechen. Nachher gab es sogar noch eine kleine und beschauliche Zugabe, eine Seltenheit nach solch einem Koloss – leider handelte es sich bei dieser nicht wie erhofft um Bachs Goldbergvariationen.

Der folgende Tag drehte sich für mich in erster Linie um die Familie Sæverud; zunächst ging es zum Haus von Harald Sæverud, Siljustøl, und am Abend gab es ein Konzert ausschließlich mit Werken seines jüngsten Sohns, Ketil Hvoslef. Eine Alm, norwegisch Støl, sei das Zentrum der Welt, sprach der Komponist Harald Sæverud einmal, und so bezeichnete er auch sein Haus, wenngleich das gewaltige Gebäude auf dem 176.000 Quadratmeter großen Grundstück zunächst einmal wenig wie eine Sennhütte wirkt. Erst wenn man hineingeht in das Anwesen, erkennt man den lieblichen und naturverbundenen Charme: wir finden vorwiegend recht kleine und liebevoll detailliert eingerichtete Zimmer, die hauptsächlich aus Stein und Holz bestehen. Alles wurde so gelassen, wie Sæverud es im Jahr seines Todes 1992 hinterließ. Jeder Gegenstand hat eine Geschichte und wenn man einmal die Angehörigen des Komponisten nach ihnen befragt, so sprudeln sie förmlich über vor Anekdoten über alle noch so unscheinbaren Einzelheiten. Fertiggestellt wurde Siljustøl 1939 im Geburtsjahr Ketils, ermöglicht durch die wohlhabende Familie von Haralds Frau Marie Hvoslef, und umspannt eine gewaltige Parkanlage mit urtümlich wirkenden Wäldern und einen riesigen See, den Sæveruds Familie einen ganzen Sommer lang ausgehoben hat – mittlerweile befindet sich auch ein Golfplatz auf dem Grundstück, wenngleich ich mir nicht vorstellen kann, dass dies in Sæveruds Sinne gewesen ist, der ja doch die Natur und die Natürlichkeit jeder Künstlichkeit vorzog.

Heute stand das Wohnzimmer in Siljustøl voll: Der steinerne Anbau an das Zimmer, in dem Sæverud seine Gäste empfing, wurde nun wie das restliche Zimmer auch mit Stühlen vollgepfropft, um genügend Hörern das Konzert zu ermöglichen. Zwei Nachwuchskünstler gaben ihr Debut im Rahmen der Festspiele: der Tenor Eirik Johan Grøtvedt und der Pianist Eirik Haug Stømner. Auf dem Programm standen fünf Lieder von Edvard Grieg, die ersten zwei Lette Stykker op. 18 von Harald Sæverud, Schumanns Dichterliebe op. 48 und fünf frühe Lieder aus op. 10 und 27 von Richard Strauss. Mit den jungen Musikern haben die Festspiele zwei aufstrebende Talente entdeckt, die es zu fördern wert ist. Enormes Potential steckt in der Stimme des Tenors Eirik Johan Grøtvedt, der eine enorme Vielfalt an Emotionen glaubhaft und mitfühlbar vermittelt, dabei angenehm weich bleibt und ein wunderbares Timbre besitzt. Mich erstaunte, wie dialektfrei Grøtvedt deutsch sang, man erkannte fast keine nordische Färbung des Tonfalls. Einmal mehr spielte leider die Akustik gegen die Hörer, denn der Raum war diesmal zu klein für eine starke Stimme im Forte, wenn sie direkt vor der ersten Publikumsreihe abgefeuert wird und an den Steinwänden vielfach zurückklingt. Der Flügel des Komponisten ist natürlich genauestens auf den Raum abgestimmt und kann sich gut entfalten. Eirik Haug Stømner konnte vor allem in Schumanns Dichterliebe überzeugen, die er dynamisch, fließend und vielseitig begleitete, sich minutiös auf den Tenor einrichtete. Auch bei Strauss kamen diese Eigenschaften zum Tragen, und lediglich in den zwei fragilen Sæverud-Miniaturen fehlte es ihm noch an Kontrolle über den Anschlag, Abstimmung der Akkorde in sich und zwingender Stringenz der Linien. In Griegs Liedern schwelgten beide Musiker miteinander in den reichen Ausdruckswelten, ohne diese zu überziehen.

Das Highlight und einer der wichtigsten Beweggründe für diese Reise war das am Abend stattfindende Konzert anlässlich Ketil Hvoslefs 80. Geburtstags (auch wenn dieser erst im Juli liegt). Am Vortag hörte ich bereits bei den Proben zu und sprach die restliche Zeit mit Ricardo Odriozola und Glenn Erik Haugland um Leben und Musik des Komponisten. Programmiert waren die Streichquartette Nr. 1 (1969) und 4 (2007; rev. 2017) [gespielt von: Ricardo Odriozola, Mara Haugen, Ilze Klava und Ragnhild Sannes], welches heute erstmalig aufgeführt wurde, das Trio für Sopran, Alt und Klavier (1974; rev. 1975) [Mari Galambos Grue, Anne Daugstad Wik und Einar Røttingen], Octopus Rex für acht Celli (2010) [John Ehde, Finlay Hare, Markus Eriksen, Tobias Olai Eide, Ragnhild Sannes, Marius Laberg, Carmen Bóveda, Milica Toskov] und das Konzert für Violine und Pop Band (1979) [Ricardo Odriozola, Einar Røttingen, Håkon Sjøvik Olsen, Benjamin Kallestein, Peter Dybvig Søreide, Thomas Linke Lossius und Sigurd Steinkopf]. Ketil Hvoslef wurde 1939 in Bergen geboren und wuchs in Siljustøl in Frieden und Harmonie auf; anfangs wollte er Maler werden, gab diesen Traum allerdings auf, als sein Lehrer ihm vorwarf, zu wenig Aussage zu vermitteln. Seine Laufbahn als Komponist beschritt er eher durch Zufall, indem er, nur für sich selbst, ein kleines Klavier-Concertino schrieb. Als dies sein Vater Harald Sæverud bemerkte, übertrug er ihm sogleich einen Auftrag für ein Bläserquintett, zu welchem er keine Zeit hatte – oder keine Lust. Als Ketil sich dazu entschied, sich dem Komponieren zu verschreiben, nahm er den Namen seiner Mutter an, um nicht zwei Sæveruds als Komponisten zu haben und diese immer zu verwechseln. Vater und Sohn unterscheiden sich deutlich in ihrer Musik, nicht nur in den präferierten Genres (Sæverud verehrte die Symphonie und eher klassische Besetzungen, Hvoslef schreib nicht eine Symphonie und widmete sich ungewöhnlichen Instrumentalkombinationen), sondern auch musikalisch: Sæveruds Inspiration lag bei Mozart und den Klassikern sowie in der Natur, die er regelmäßig in Töne bannte; Hvoslefs Zugang ist abstrakter, er nennt beispielsweise Strawinsky als Idol und bringt immer ein technisch-mechanisches Element in seine Werke. Die Musik Hvoslefs lebt von Kontrasten und unerwarteten Überraschungen: Nur selten finden wir eine Melodielinie oktaviert in gleicher Dynamik und Ausdrucksweise, viel eher trennt sie eine kleine Non, eine Stimme ist laut und eine leise, eine gebunden und eine abgesetzt. Es gibt Platz für Lyrik und Sinnlichkeit, aber sie wird schnell unterminiert von anderen Elementen, plötzlich ad absurdum getrieben oder direkt von Anfang an immer wieder gestört. Das Material reduziert Hvoslef so weit wie möglich, er beschränkt sich in jeder Hinsicht auf das Wesentliche und sieht eben darin den Reiz. Dabei funktionieren seine neuartigen Formen jedes Mal aufs Neue. Als ich ihn danach fragte, wie er denn eine Form schaffe beim Komponieren, antwortete er: „Ich denke nicht an Form. Ich schreibe ein Thema, und das Thema gibt dann vor, wie es weitergehen muss.“ Hier findet sich eine Ähnlichkeit zu seinem Vater: Beide sehen das Thema als Knospe, aus der dann eine Pflanze erwächst. Ist die Knospe eine Sonnenblume, so muss auch eine Sonnenblume daraus sprießen, wobei jede Blume natürlich anders aussieht; aus einem Ahornkeim gedeiht ein Ahorn. Hier liegt der Instinkt des Komponisten. Tatsächlich kann man Hvoslefs Kompositionsprozess als Gegenteil jedes Akademismus‘ bezeichnen, dieser scheint ihm teils gar zuwider zu sein – was nicht bedeutet, dass er nicht hoch intelligent und zutiefst reflektiert arbeitet. Ein Gespür besitzt Hvoslef auch dafür, wie lange er einen Gedanken verfolgen kann, ohne dass er öde wird, ohne dass etwas Neues kommen muss. Er strapaziert die Idee so lange wie möglich, dann erst verwirft er sie; oder er unterbricht sie vorzeitig für einen vollkommen anderen Einfall, dem er sich gerade widmen will. Auch hier finden wir eine Gemeinsamkeit zu seinem Vater: Beide lassen sich gerne einnehmen von einem interessanten Detail und fokussieren dieses für eine gewisse Zeit, wobei sie alles andere vergessen. Beim Vater geschieht dies in seiner Musik durch plötzliche Einwürfe, die das Stück unterbrechen, ohne einen Grund dafür zu haben und ohne noch einmal wiederzukehren. Hvoslef bindet sie teils mehr in den formalen Verlauf ein, bleibt aber ebenso fasziniert von ihnen. In den Proben achtete er hauptsächlich darauf, dass die Partitur genauestens und vor allem deutlich eingehalten wird; er notiert äußerst präzise und besteht dann auch auf das, was dort geschrieben steht.
Die Werkeinführungen gestaltete der Komponist bei seinem Ehrenkonzert selbst. Zum 1. Streichquartett sagte er, sein damaliger Lehrer bat ihn, nie wieder so zu komponieren wie bisher, und als Trotzreaktion schuf er, während er fror (erneut solch ein Detail, dass nur durch die Absurdität so viel Beachtung findet), dieses konturlose und zutiefst komplexe Werk voller Effekt und beinahe komischer Abstraktheit. Das Trio für zwei Sängerinnen und Klavier bedient sich keiner existierenden Sprache – ich hörte es heute zum ersten Mal auf war hingerissen von den sanften Reibungen zwischen den Stimmen und der dynamischen Bandbreite, die Hvoslef hier entfaltet. Man kann diese Musik nicht entspannt hören, sondern horcht immer auf, gespannt, was als Nächstes kommt. Octopus Rex für acht Celli (der Titel wurde entliehen von Strawinskys Oper Oedipus Rex) verfolgt den Gedanken einer einzigen Kreatur mit acht Armen, die zwar an sich flexibel ein Eigenleben führen können, doch aber als Einheit zusammengehalten werden. Hvoslef lässt die Celli teils alle die gleichen Melodien von acht unterschiedlichen Starttönen aus spielen, teils spaltet er sie auf in zwei bis drei Gruppen, die vollkommen verschiedene und scheinbar unabhängige Ideen spielen, aber doch irgendwie in Kontext miteinander stehen. Erst im allerletzten Ton vereinen sich alle acht Tentakelarme auf die Schlussnote D. Nach der Pause folgt die Uraufführung des vierten Streichquartetts, dem der Komponist noch einen Tag zuvor zwei kleine Revisionen mitgab; herbe Kontraste durchziehen das Quartett und die Pausen erhalten großen Stellenwert, dynamisch teilen sich die Musiker oft in zwei Gruppen ein, von denen eine Pianissimo und eine Fortissimo spielt, während sie völlig anderes Material gegeneinander aufbringen. Die Keimzelle ist ein betonter Rhythmus auf die Noten f“ und g“: Sowohl die rhythmische Figur als auch der Doppelton gestalten die gesamte Form des einsätzigen Quartetts. Als letzten Programmpunkt hören wir das Konzert für Violine und Popband, welches als Auftragsstück auf einem Rockfestival uraufgeführt wurde und damals mehr als fehl am Platz wirkte. Auch heute lässt das Werk durch die skurrile Besetzung aufmerken, dabei gehört es musikalisch gesehen zu den klassischsten und gradlinigsten Werken Hvoslefs. Der Komponist beruft sich auf mehrere „Patterns“ die immer und immer wiederkehren, dabei allerdings die Taktstruktur immer wieder auf die Probe stellen, da sie meist aus 7 oder 13 Achtelnoten bestehen – und dies bei klarem Viervierteltakt. Eine Dreitonfigur mit chromatischer Fortführung bildet den Ausgangspunkt und beinahe jedes Motiv lässt sich auf diesen zurückführen – teils ganz deutlich, teils unmerklich (wie das Blatt schwer auf den Stamm schließen lässt, obwohl es klar dazugehört). Ursprünglich wurde das Konzert für Trond Sæverud geschrieben, den Sohn Ketil Hvoslefs, heute spielt Ricardo Odriozola den Solopart, doch wie Trond nahm auch er sich verschiedene Musiker aus der Klassik- und Jazz/Pop/Rock-Szene für seine „Band“. Das Violinkonzert wurde tontechnisch vollständig abgenommen und in den Raum projiziert, was ebenso gewissen Rockflair verlieh und jedes Instrument zur Geltung brachte. Im Grunde genommen spielt nämlich jeder ein Solo in diesem Konzert für nur sieben Musiker, weshalb ich es sogar eher als Concerto Grosso betiteln würde. Den ganzen Abend über spielten die beteiligten Musiker, 19 an der Zahl, durchgehend auf höchstem Niveau. Ricardo Odziozola und Einar Røttingen leiteten die einzelnen Stücke jeweils an und setzten Hvoslefs Partituren minutiös um, ohne dabei das lebendige Musizieren zu vernachlässigen. Alles wirkte frisch, spannend und neuartig, dabei trotz (für ein Konzert mit ausschließlich zeitgenössischer Musik erstaunlich) großem Publikum intim und familiär. In Hvoslefs Kammermusik geht es derartig stark um das Miteinander, dass den Einzelnen herauszupicken und zu betrachten keinen Gewinn bringen würde: Und die Gemeinschaft war phänomenal bei den anwesenden Musikern, die so präzise hörten und interagierten.
Am nächsten Tag ging mein Flieger bereits in der Früh: doch zuvor blieb die ganze Nacht hell, da sich die Sonne nach einigen verregneten Tagen endlich blicken ließ. Und so konnte ich noch einmal die Beschaulichkeit von Bergen genießen mit seinen vielen Holzhäusern, Grünanlagen, historischen Gebäuden und den zahlreichen Musikbühnen, die für die Festspiele aufgestellt wurden.
[Oliver Fraenzke, Mai-Juni 2019]

 Troldhaugen, Villa von Edvard Grieg (Foto von: Oliver Fraenzke)
Troldhaugen, Villa von Edvard Grieg (Foto von: Oliver Fraenzke)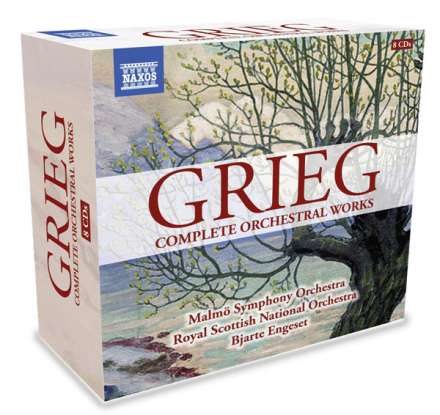 Grieg Orchesterwerke bei jpc bestellen
Grieg Orchesterwerke bei jpc bestellen Griegs Lyrische Stücke bei jpc bestellen
Griegs Lyrische Stücke bei jpc bestellen Festspiele in Bergen; Lysøen von außen (Foto von: Oliver Fraenzke)
Festspiele in Bergen; Lysøen von außen (Foto von: Oliver Fraenzke) Festspiele in Bergen; Lysøen von innen (Foto von: Oliver Fraenzke)
Festspiele in Bergen; Lysøen von innen (Foto von: Oliver Fraenzke)

 Das Instrumentenmuseum Ringve von außen
Das Instrumentenmuseum Ringve von außen
 Die Eismeerkathedrale und Tromsø nach Mitternacht
Die Eismeerkathedrale und Tromsø nach Mitternacht