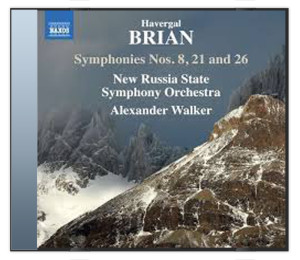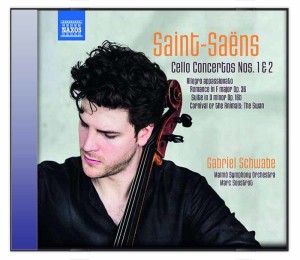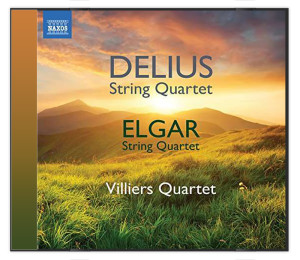Havergal Brians Symphonien-Zyklus auf Tonträger komplettiert
Havergal Brian: Symphonien Nr. 8, 21 und 26; New Russia State Symphony Orchestra, Alexander Walker
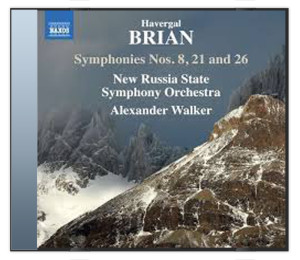
Naxos CD 8.573752 (EAN: 747313375271)
Diese CD ist ein Paukenschlag außer Hörweite des Mainstreams. Mit der Aufnahme der 1966 im Alter von 90 Jahren komponierten 26. Symphonie (es sollten noch sechs weitere folgen!) sind nunmehr sämtliche 32 Symphonien von Havergal Brian (1876-1972) auf kommerziellen Tonträgern erschienen. Brian ist natürlich aus mehreren Gründen ein Unikum. Mit seiner im Alter von mehr als 50 Jahren vollendeten ersten Symphonie, der legendären ‚Gothic Symphony’, schuf er ein Richard Strauss gewidmetes Mammutwerk, das bezüglich Größe der Besetzung und Gesamtdauer ins Guinness-Buch der Rekorde einging. Seine 1949 komponierte einsätzige Achte Symphonie, die auf vorliegender CD auch enthalten ist, wurde per Zufall im BBC-Archiv von Robert Simpson (der sich zu jener Zeit selbst anschickte, einer der führenden Symphoniker der Nachkriegszeit zu werden) entdeckt, und Simpson traute seinen Augen nicht. Er versprach daraufhin dem Komponisten, jede weitere Symphonie, die er vollende, als verantwortlicher Produzent zur Aufführung zu bringen, und so war die Achte 1954 die erste Symphonie, die Brian, nunmehr bald achtzig Jahre alt, zu hören bekam. Von Simpson und der allgemein frappierten Resonanz ermutigt, komponierte Brian tatsächlich noch 21 weitere Symphonien im Alter von über 80 Jahren. Und so ist er eben auch bezüglich der Anzahl vollendeter Symphonien zum Rekordhalter unter jenen Komponisten geworden, bei welchen zugleich auch von so etwas wie symphonischer Substanz die Rede sein kann (dass uns Leif Segerstam vielleicht noch mit 500 ‚Symphonien’ beglücken mag, steht auf einem anderen Blatt – orchestrale Improvisationen wäre da wohl der einleuchtendere Titel…).
Hier also gibt es, gespielt vom Neuen Russischen Staatlichen Symphonieorchester in Moskau unter der Leitung von Alexander Walker, zunächst jene schicksalhafte Achte zu hören, die nicht nur mit einem unerhörten Tonfall gefangen nimmt, sondern auch mit einer zugleich äußerst freien und auf die kurze Strecke eventuell zusammenhangslos scheinenden Formentwicklung, deren unmittelbarstes Merkmal komplette Unvorhersehbarkeit ist (das erste Markenzeichen Havergal Brians schlechthin – alles ist ein Abenteuer, sei es in überwältigenderen oder harmloser auftretenden Varianten). Doch mit konzentriertem Hören wird man feststellen können, wie hier alles aufeinander bezogen ist, wie die Musik mit einer fast schon beispiellosen Courage Risse, Zerklüftungen, Fragmentierungen, Befremdlichkeiten in den Raum stellt, und diese getrennt scheinenden Welten untereinander aus der Distanz, wie in fernem Magnetismus, ein Beziehungsnetz aufspannen, das wie von Geisterhand einen großen Zusammenhang entstehen lässt. Das ist natürlich eine äußerst riskante Methode, und man kann nicht davon ausgehen, dass das 32 mal auch geklappt hat (Brian hat übrigens noch sehr viel weitere Musik, darunter große Opern, geschrieben, deren Grundhaltung bis auf ein paar unterhaltendere Genrewerke eigentlich stets die selbe ist).
Allerdings weisen seine Alterswerke (also nach Überschreiten der Achtzig) eine unbestreitbare Veränderung auf: Nun tendiert er zur Kürze, oftmals schon in fast aphoristischer Weise. Dadurch wird die Situation für die Ausführenden nicht einfacher, denn das Ausmaß der Kontraste und der scheinbar fremd nebeneinander gestellten Elemente wird damit keineswegs geringer – nur ist eben jetzt nicht mehr so viel Zeit, um etwas entstehen zu lassen, und wenn man selbst nicht so recht erfasst hat, was man da spielt, fühlt sich der Hörer ein wenig, als würde er in einem Oktoskop rotieren.
Die 21. Symphonie von 1963 ist da keine Ausnahme, außer in der Hinsicht, dass sie ausnahmsweise noch einmal viersätzig ist und – als umfangreichste der späten Symphonien – ungefähr eine halbe Stunde dauert. Ein sehr anspruchsvolles Werk, das man eigentlich einige Male im Konzert gespielt haben müsste, um als Musiker eine Chance zu haben, bei der Aufnahme zu kapieren, welche Funktion man gerade innerhalb der zusammenhängend gebauten Form innehat. Dazu kommt es denn auch hier nicht, und das sind wir ja leider gewohnt. Ein Orchester ist eben zu teuer, um sich mit Werken so auseinander zu setzen, wie dies für seriöse Kammermusikvereinigungen selbstverständlich ist.
Nicht anders ist die Problematik bei der nun zum ersten Mal aufgenommenen 26. Symphonie, dem endlich eliminierten Missing Link in Brians symphonischem Schaffen. Entstanden in seinem 90. Lebensjahr, als er endlich einmal alters-sensationshalber mit Ehrungen überhäuft wird und die ’Gothic Symphony’ unter Adrian Boult die erste professionell repräsentative Aufführung erfährt, ist diese Nr. 26 ein zwar sehr knapp gefasstes, doch zugleich bei unzusammenhängend erfasster Darstellung scheinbar wirr zusammengestelltes Werk in drei Sätzen mit einer Dauer von 18 Minuten. Ein Problem, das mir auch schon vorher auf die Nerven gegangen ist, macht das Hören hier zunächst zusätzlich mühsam: Brian macht ausgiebigen und nicht immer ausgesprochen subtilen Gebrauch vom Schlagzeug, und die Schlagzeugsektion müsste insgesamt viel zurückhaltender, unaufdringlicher agieren, um dieser eigentlich so elegant empfundenen Musik nicht eine gewisse Primitivität und Redundanz aufzupfropfen. Das ist vor allem beim umfangreichsten ersten Satz sehr störend. Die beiden folgenden Sätze gehen attacca ineinander über, und hier kann man – wenn man in der Lage ist, von der etwas naiven Orientierungslosigkeit des Orchesterspiels zu abstrahieren – die höchst faszinierenden Charakteristika von Brians einmaliger Musiksprache studieren (nochmal: das ist nicht die Schuld des Orchesters, und auch der Dirigent hat nur geringste Chancen, während der Aufnahmen hier ein auch nur rudimentäres Verständnis zu kreieren, das nicht da sein kann, wenn die Tonsprache neu, die Faktur heikel und die Zeit für makellose technische Ausführung knapp ist!). Man darf Brian nicht mit dem Klischee folgend aufgedonnerter spätromantischer Emphase spielen, das rächt sich schon, wenn man nur für ein bis zwei Phrasen in das veristische Klangbad fällt, in Mahler’sches ‚Verweile doch, du bessere Vergangenheit’ einstimmt oder auf den Tschaikowskyzug aufspringt. Auch Elgars Lost Empire Glory ist die falsche, wenn auch näherliegende Verbindung, und Brians grotesker Humor, der ihn sich als geborener Underdog instinktiv von der britischen Weltmachtherrlichkeit distanzieren lässt, liegt eben nicht im Deftigen, allzu Offensichtlichen, sondern in feinen und feinsten Nuancierungen. Auch das Fortissimo braucht in der Regel noch eine gepflegte Distanz, und mit es krachen lassen und die Zügel schießen lassen ist hier nichts Sinnvolles auszurichten. Man muss Brian mit einem wachen Bewusstsein der konkreten Klangentstehung spielen, wie das bei Debussy oder Ravel erwartet wird, und zugleich muss man es sich erarbeiten, die nebeneinander gestellten, immer wieder unglaublich neuartig in Wechselbeziehung (oder eben im gewohnt ungünstigen Fall beziehungslos) sich begegnenden kurzen Episoden, die oftmals nicht länger dauern als eine einzige Phrase, in ihrem Zusammenhang zu empfinden, und zu erleben, welche Gewichtungen, welche Akzentuierungen und Auflösungen der Spannung es jeweils braucht, damit sich eine erfahrbare Beziehung überhaupt einstellen kann. Denn diese Musik ist ein wunderbar geistreiches Spiel, das seine ganz eigene Geschichte jenseits der Gewöhnlichkeiten des konventionellen musikalischen Denkens entfaltet. Im vorliegenden Fall muss man dafür – wie so oft – ‚hinter’ das hören, was aufdringlich und zusammenhangslos auf einen einstürzt. Dann kann man eine Ahnung bekommen, was alles noch möglich wäre. Es ist bedauerlich, dass der große Brian-Forscher Malcolm MacDonald die diskographische Vollendung des symphonischen Zyklus nicht mehr erleben durfte. Und es ist ein immenser Vorzug vorliegender Scheibe, dass den exzellenten und sich an keinen Autoritäten festhaltenden Booklettext mit John Pickard einer der führenden Symphoniker unserer Tage verfasst hat. The exploration goes on…
[Christoph Schlüren, Februar 2018]
Bestellen bei jpc
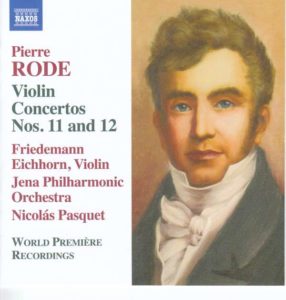

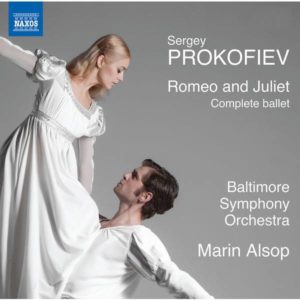



 Bestellen bei jpc
Bestellen bei jpc