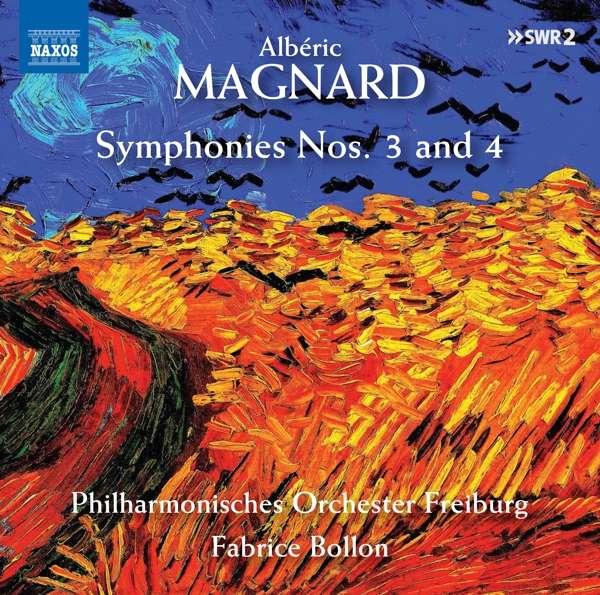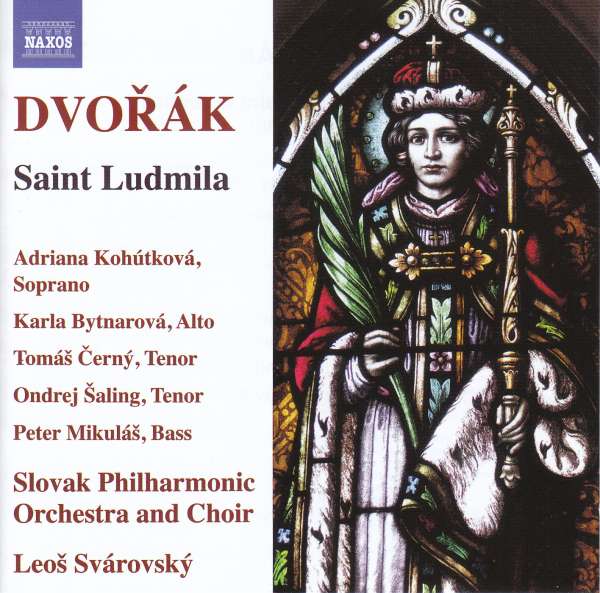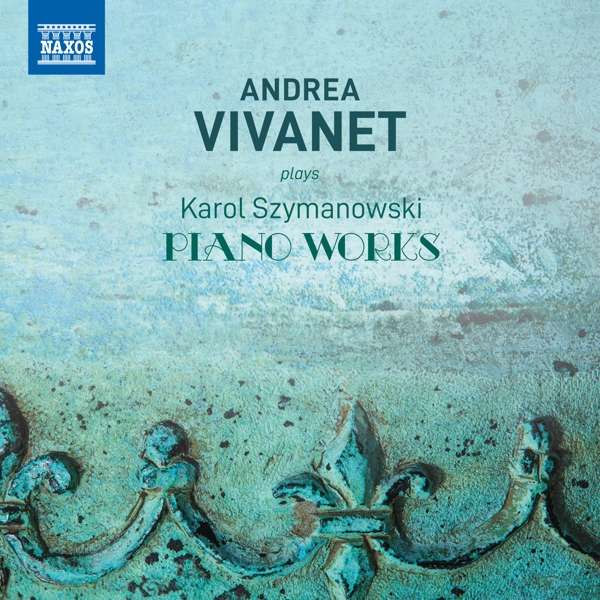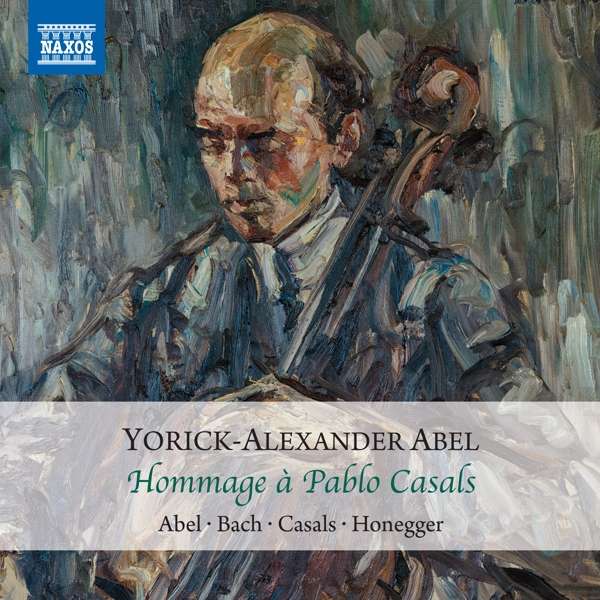Trio Cremeloque: Beethoven – Klaviertrios Op. 1, Nr. 3 und Op. 11 „Gassenhauer-Trio“ – Arrangiert für Oboe, Fagott und Klavier
EAN: 730099149836 / Katalog-Nr.: 8.551408

Das Trio Cremeloque ist in Lissabon beheimatet, setzt sich aber zusammen aus Künstlern dreierlei Nationalitäten. Savka Konjikusic, Luís Marques und Franz-Jürgen Dörsam sind somit ein paneuropäisches Trio, und als wäre das nicht schon etwas Besonderes, spielen sie zudem noch in einer äußerst ungewöhnlichen Besetzung.
Bei der Einspielung zweier populärer Klaviertrios von Ludwig van Beethoven ersetzt beim Trio Cremeloque die Oboe von Luís Marques die Violinstimme und das Fagott von Franz-Jürgen Dörsam das Cello. Und so klingt das populäre „Gassenhauer-Trio“ Op. 11 B-Dur einmal ganz anders. Die warmen Holzbläser-Klangfarben tun der Qualität dieser Musik keinerlei Abbruch, und so darf man dieses Experiment wohl als durchaus gelungen bezeichnen.
Dass die Musiker, die in diesem Trio nun einmal in der Besetzung Oboe, Fagott, Klavier musizieren, diese Stücke zum „Beethoven-Jahr“ so für sich eingerichtet haben und damit sicherlich eine reizvolle Alternative für Konzertveranstalter darstellen, ist unbenommen. Ob man die Ergebnisse dieser Bemühungen auch für Tonträger einspielen musste, steht auf einem anderen Blatt. Denn abgesehen von der Änderung der Klangfarben, kann man hier schwerlich einen „Mehrwert“ erkennen. Gleiches gilt für das Klaviertrio Op. 1, Nr. 3 c-Moll. Mit dem „Allegretto für Klaviertrio“ WoO 39 B-Dur gibt es außerdem noch eine kurze Zugabe obenauf, sodass das Album alles in allem eine knapp einstündige Spielzeit aufweist.
Zusammengefasst ist dieses tadellos gespielte, wenngleich von der Klangtechnik her nicht ganz optimale Album eher ein „nice to have“ als ein „must buy“, kurz: Für den Konzertverkauf der Künstler sicherlich optimal, für den allgemeinen Beethoven-Fan vielleicht eher „nebenbei“ interessant.
[Gilbert Praetorius, Januar 2020]