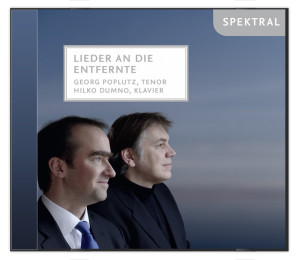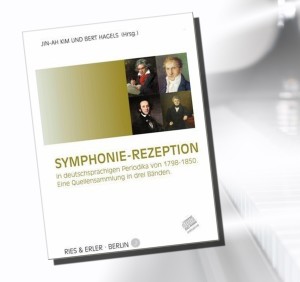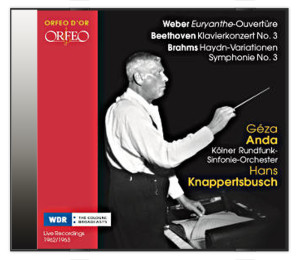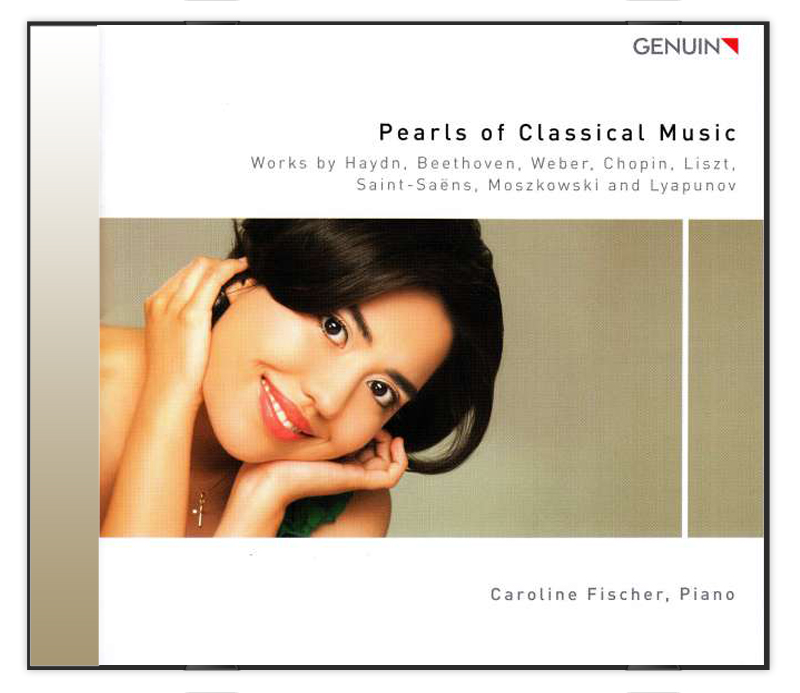Das Bruckner Akademie-Orchester unter Jordi Mora spielt im Herkulessaal der Münchner Residenz Felix Mendelssohn Bartholdys ‚Ruy Blas’-Ouvertüre, Beethovens 3. Klavierkonzert und Gustav Mahlers 4. Symphonie. Solistin ist Ottavia Maria Maceratini.
Einige meiner wenigen wirklich glaubhaften Informanten aus München haben mich in den letzten Jahren immer wieder auf die italienische Pianistin Ottavia Maria Maceratini hingewiesen, haben mir von ihren seltenen pianistischen und musikalischen Gaben berichtet, und ich muss gestehen, dass ich skeptisch war. Schon wieder so ein junges Sternchen der geistig verdorrenden Klassikszene, noch so eine ‚Hoffnungsträgerin’ der jungen Generation – wie oft schon sind wir dann von der klingenden Realität bitter enttäuscht worden, wie oft hat man versucht, uns Blech als Gold zu verkaufen. Diesmal aber war ich fest entschlossen, die lange Anreise auf mich zu nehmen, denn der katalanische Dirigent Jordi Mora hatte Frau Maceratini eingeladen, mit seinem Bruckner Akademie-Orchester im Münchner Herkulessaal aufzutreten, und erstens ist Mora ein wahrhaft fundierter Erarbeiter der musikalischen Struktur und phänomenaler Orchestererzieher, und zweitens lässt er sich nach meiner Erfahrung keine gehypten Jungstars aufschwatzen und schlägt sich nicht freiwillig mit hohlen Tastenvirtuosen herum. Hier zählt die Substanz.
Um es vorweg zu nehmen: ich habe diese Reise bei keinem Ton bereut, und es dürfte im erfreulich zahlreich erschienenen Publikum kaum jemand gewesen sein, dem es anders ergangen wäre.
Das Konzert begann mit der vielleicht formal bezwingendsten – und zweifellos einer der dramatischsten, erfindungsreichsten, dichtesten und feurigsten – Ouvertüre von Felix Mendelssohn Bartholdy: der 1839 entstandenen Konzertouvertüre zu Victor Hugos ‚Ruy Blas’. Mora verstand es vorzüglich, die opponierenden Charaktere charakterstark zu entfalten und dabei stets den Zusammenhang des Ganzen im Auge zu behalten, wodurch sich eine unwiderstehliche Entwicklung vom majestätisch-furiosen Beginn bis zum triumphalen – jedoch zugleich elegant und biegsam bleibenden – Ende mit einer Klarheit offenbarte, die den Hörern das Innerste der Musik offen darlegte. Die subtile Beschleunigung der Schlussphase ist dabei einer jener intuitiv überzeugenden Kunstgriffe, die nicht um des momentanen Effekts willen inszeniert werden, sondern der inneren Notwendigkeit der harmonischen Entwicklung entspringen. Das Orchester spielte mit Verve, Reaktionsschnelligkeit, fein schattierter Zärtlichkeit und gesanglicher Anmut auf – gerade auch in den strahlend-machtvollen Tuttiauftürmungen –, dass es ein Fest der organischen Gestaltwerdung war.
Dann Beethovens Drittes Klavierkonzert in c-moll op. 37. Man kann das musikalisch nicht besser erfassen. Das gemessene Tempo des untergründig feierlichen Kopfsatzes mit seiner machtvollen Konfrontation der beiden opponierenden Themenwelten, der aus tiefster Versenkung sich aufbauende Largo-Mittelsatz in himmlischer Innigkeit, und das Finale diesmal nicht als grimmiger Parforceritt, sondern vor allem mit all dem Schalk und wagemutigen Humor, den die wenigsten Klang werden zu lassen verstehen! Ottavia Maria Maceratini spielt all dies nicht nur mit phänomenaler pianistischer Meisterschaft, die uns keine technische Klippe spüren lässt und den Klang sowohl im markigen Fortissimo als im delikatesten Pianissimo immer als Ganzes formt (kein Moment eindimensionaler Oberstimmendominanz!), immer Platz für plastische Phrasierung der Melodie hat (das Klavier singt unentwegt); sie ist vor allem eine unerhört reife Musikerin, deren Aufmerksamkeit der unaufhaltsamen Durchdringung des Gesamtverlaufs gilt und damit zu einer Einheit der großen Gestalt vordringt, die auf der bewusst gerichteten Mannigfaltigkeit der divergierenden Elemente beruht. Auch die fesselnde Kadenz im Kopfsatz (Original-Beethoven) dient in keinem Moment der Zurschaustellung pianistischer Attitüden und ist mit unerschütterlicher symphonischer Kontinuität durchgestaltet als Teil eines Ganzen, das so unausweichlich korreliert ist, als könne es gar nicht anders sein. Und das alles fern jedem bitteren Ernst, jeder didaktischen Gelehrsamkeit, wie ein spontanes Naturereignis, stets auf des Messers Schneide gespielt mit dem Mut zum vollen Risiko. Kein Moment interpretatorischer Willkür, nebulösen Fabulierens oder billiger Kraftmeierei findet sich in diesem Spiel, das zugleich völlig organisch dem Wechselspiel mit dem Orchester und seinen Solisten eingegliedert ist. So großartig die Solistin ihr Metier beherrscht, agiert sie doch nie selbstherrlich, sondern ist immer bewusster Teil des Ganzen, das sie ebenso begreift und gestaltet wie der Dirigent und seine Musiker. Das ist echte Hingabe von allen Seiten. Ist eine andere Stimme wichtiger, so tritt sie dezent zurück. Und doch ist das nie eine bloße Begleitung, sondern stets wache Gegenstimme, jederzeit bereit, wieder für einen Moment hervorzutreten. Das ist nicht einfach ein souveräner Auftritt, der Sicherheit, Brillanz und Kompetenz bewiese, sondern das ist wirklich Dienst am Werk, am Komponisten, an der Gemeinschaft, an der Musik, in der alle Mitwirkenden völlig aufgehen, ohne sich in Stimmungen zu verlieren, denn innere Balance und das unbestechliche Bewusstsein dafür, an welchem Punkt der musikalischen Entwicklung wir uns gerade befinden, liegen dem zugrunde. Es war ein echter Triumph nicht nur für Ottavia Maria Maceratini, sondern für alle Beteiligten, und wer dabei war, dürfte nicht vergessen, welche durchgehende Spannungslinie im ersten Satz gestaltet wurde, wie still es im Publikum wurde, welch ein erfülltes Aufatmen nach dem letzten Ton durch die Reihen ging. Solche Konzerte belohnen alle ernsthaft suchenden Hörer unverhofft für unzählige Stunden des Durchhaltens in gepflegtem Mittelmaß, in billiger Ekstase, in virtuosem Geklingel. Als Zugabe spielte sie in diesem insgesamt dramaturgisch exzellent konzipierten Programm die Miniatur ‚Persian Love Song’ von John Foulds, dem wohl originellsten britischen Meister der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – ein Wunderwerk, den Préludes eines Debussy oder Miniaturen eines Bartók ebenbürtig, in ganz und gar eigenem Ton, und pianistisch höchst anspruchsvoll mit den tiefen pianissimo-Tremoli und dem melancholischen Gesang, der sich darüber erhebt und uns aus dem alltäglichen Zeitempfinden in eine entrückte Welt entführt. Ottavia Maria Maceratini hat alles, um als eine der ganz Großen auf den Bühnen der Welt ein- und auszugehen.
Nach der Pause dann Gustav Mahlers Vierte Symphonie. Und auch hier: nie habe ich eine Aufführung dieses Werkes gehört, wo ein durchgehender Zusammenhang so zum Greifen nahe schien wie hier. Besonders ergreifend der unendlichem Fluss ausmusizierte langsame Satz. Alles ein unendlicher Gesang. Herrlich musiziert auch der Kopfsatz mit seiner untergründig stets vorhandenen Rubato-Geschmeidigkeit, die sich dann immer wieder in offenkundigen Tempoverwandlungen niederschlägt. Hier zeigt sich auch seltene dirigentische Meisterschaft, alles in freiem Wechselbezug bis in die feinste Detailgestaltung durchzuformen und ohne Rigidität synchron zu halten und den Rhythmus zu „atmen“, und das Orchester geht mit wie ein zusammenhängendes Wesen. Nicht weniger charakteristisch wurde die Bizarrerie des Scherzos erfasst. Das Schlusslied sang Mireia Pintó. Wohl auch hier, in der ganzen Mahler-Symphonie, kaum ein Hörer, der nicht tief ergriffen war von der Poesie und dem Drama dieser innerlich so zerrissenen Musik, die den Bogen so gerne überspannt, deren große Herausforderung darin besteht, das Episodische zum Zusammenhang zu bündeln, indem sie eben nicht auf Sicherheit getrimmt, nicht unpoetisch strikt gestrafft wird, aber auch nicht wie so oft tränenrührig zerfließt, sondern unsentimental ausgekostet wird in allen Fasern ihres vielschichtigen Daseins. Jordi Mora erwies sich hier einmal als einer der feinsten, vornehmsten und bewusstesten Meister seiner in grundsätzlichen Fragen so uneinigen Zunft. Dazu muss man kein Star sein, und das wäre auch das Letzte, was er wünscht. Besonders hervorzuheben aus dem exzellent einstudierten und mit verfeinerter Leidenschaft musizierenden Orchester ist der exzellente Konzertmeister Joel Bardolet, der ebenso an der Spitze unserer besten Orchester sitzen könnte. Eines der besten Konzerte der letzten Jahre.
[Annabelle Leskov, April 2018]


 Bestellen bei jpc
Bestellen bei jpc