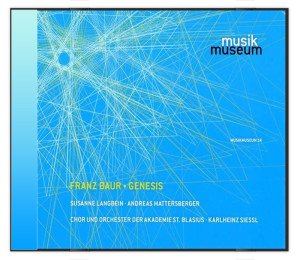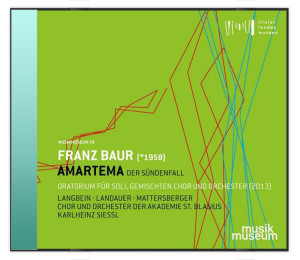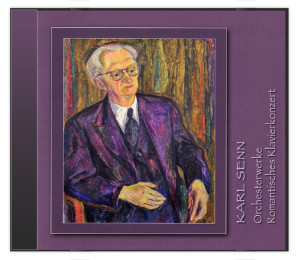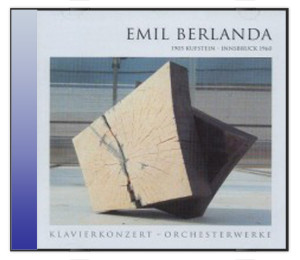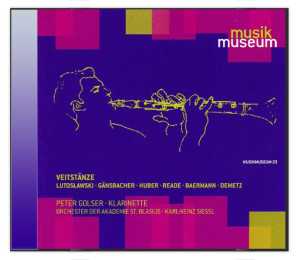MusikMuseum 73, CD 13072; EAN: 9079700700696

In der Reihe MusikMuseum ist der Mitschnitt des Tiroler Weihnachtskonzerts 2023 herausgekommen. Chor und Orchester der Akademie St. Blasius musizieren gemeinsam mit den Gesangssolisten Stefanie Steger, Eva Schöler, Johannes Puchleitner und Stefan Zenkel unter der Leitung von Karlheinz Siessl Werke von Karl Pembaur, Robert Führer, Carl Santner, Richard Wagner und Franz Xaver Gruber.
Das Tiroler Weihnachtskonzert der Akademie St. Blasius kann mittlerweile als Traditionsveranstaltung gelten. Seit 2012 ist jedes Weihnachtskonzert des in Innsbruck ansässigen Chor- und Orchestervereins mitgeschnitten und auf CD veröffentlicht worden. (Nur 2020 konnte infolge der Covid-19-Restriktionen kein Konzert stattfinden.) Bestanden die ersten dieser Konzerte ausschließlich aus Weihnachtsliedern, die von einem Vokalquartett vorgetragen wurden, so gesellten sich 2014 erstmals Chor und Orchester der Akademie St. Blasius unter ihrem Dirigenten Karlheinz Siessl hinzu, von denen die Konzerte seit 2016 durchgängig bestritten werden. Seit 2019 erscheinen die Mitschnitte in der CD-Reihe MusikMuseum der Tiroler Landesmuseen.
In den Programmen der Tiroler Weihnachtskonzerte zeigt sich nahezu jedes Jahr ein anderer Schwerpunkt. So sind mehrere Alben dem reichen Musikleben der Tiroler Klöster gewidmet und stellen jeweils Werke vor, die im Bestand der betreffenden Klöster überliefert sind. 2019 stand der böhmische Komponist Johann Zach (1713–1773) im Mittelpunkt, der enge Kontakte nach Tirol pflegte und in zahlreichen Kirchen- und Klosterarchiven seine Spuren hinterlassen hat. 2019 kamen mit Franz Baur (*1958) und Elias Praxmarer (*1994) erstmals zeitgenössische Tiroler Komponisten zu Wort.
Das Weihnachtskonzert 2023, dessen Aufzeichnung vor kurzem als Folge 73 des MusikMuseums herausgekommen ist, präsentiert – abgesehen von Franz Xaver Grubers Stille Nacht, heilige Nacht, mit welchem die Konzerte traditionell schließen – Werke aus dem mittleren 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die Auswahl ist weniger auf Tirol zentriert als in früheren Veröffentlichungen, sondern betont eher den kulturellen Austausch der Region mit dem übrigen Österreich bzw. mit Deutschland. Bezeichnenderweise entstand die einzige Komposition eines gebürtigen Tirolers, Karl Pembaurs Weihnachtsmesse G-Dur op. 18, in Dresden.
Zwei kurze Stücke mit Orchesterbegleitung machen mit der kirchlichen Gebrauchsmusik bekannt, wie sie um 1850 in ganz Österreich gepflegt wurde. Die beiden Komponisten, der Salzburger Carl Santner (1819–1885) und der in Prag geborene Robert Führer (1807–1861), der nach einem Wanderleben durch Bayern und Oberösterreich in Wien starb, gehörten zu den seinerzeit beliebtesten Schöpfern gut gesetzter, einfach auszuführender Kirchenmusik. Führers Chor Mit süßem Freudenschalle und Santners Sopransolo mit Chorrefrain Jesus an der Krippe orientieren sich deutlich an Mozart, den erst der Cäcilianismus aus seiner Stellung als allgemein anerkanntes Vorbild der österreichischen Kirchenkomponisten drängte. Bei Führer kommt noch ein starker Einfluss alpenländischer Pastoralmusik hinzu. Führer und Santner sind übrigens durch eine biographische Konstellation verbunden, die in der Musikgeschichte nicht allzu häufig sein dürfte: Nachdem Führer seine Stellung als Domkapellmeister in Prag wegen eines Betrugsvorfalls verloren hatte, kam er, zunehmend verarmend, immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt und saß 1859 im oberösterreichischen Garsten eine Haftstrafe ab. Carl Santner, im Brotberuf Staatsbeamter, wirkte dort als Gefängnisdirektor und nutzte die Gelegenheit, sich bei seinem prominenten Gefangenen im Tonsatz weiterzubilden.
Das umfangreichste Werk des Programms ist die bereits erwähnte Weihnachtsmesse für Soli, Chor, Orchester und Orgel von Karl Pembaur aus dem Jahre 1915. Als Sohn des Komponisten Josef Pembaur und Bruder des gleichnamigen Pianisten gehörte der 1876 geborene Karl Pembaur zu einer der bedeutendsten Musikerfamilien Tirols. Wie Vater und Bruder studierte er in München, dann ging er 1901 nach Dresden, wo er zunächst als Hoforganist, ab 1913 als Direktor der Hofkirchenmusik wirkte. Bis zu seinem Tode 1939 blieb er in der sächsischen Hauptstadt, wo auch seine bedeutendsten Werke entstanden. Pembaur komponierte nahezu ausschließlich Vokalmusik, widmete sich auf diesem Gebiet allerdings den verschiedensten Gattungen und Besetzungen vom Klavierlied bis zum Oratorium. Unter seinen größeren Werken befinden sich mindestens sechs Messen, die sich hinsichtlich des Umfangs und der Besetzung teils deutlich voneinander unterscheiden. Die Weihnachtsmesse ist nicht nur dem Namen nach für Weihnachten bestimmt: Pembaur verwendet hier neben den Texten des Ordinariums auch das weihnachtliche Proprium, wobei er Introitus und Kyrie als ein zusammenhängendes Stück vertont und damit das Proprium untrennbar mit dem Ordinarium verknüpft. Das Orchesternachspiel der Communio, das den Anfang des Introitus zitiert, unterstreicht den zyklischen Gedanken. Mit einer Aufführungsdauer von rund einer halben Stunde ist das Werk relativ kurz. Es enthält auch keine Fugen. Allerdings denkt Pembaur durchaus polyphon, behandelt Chor und Soli abwechslungsreich und hüllt die Singstimmen in vielfarbig schimmernde Orchesterklänge. Oboensoli, Blechbläserchöre, hohe Violinen und eine sanft registrierte Orgel sorgen für weihnachtliche Stimmung. Der Stil der Messe lässt deutlich werden, dass Wagner und Bruckner für den Komponisten keine Unbekannten sind. Insbesondere im Qui tollis des Gloria und im Crucifixus des Credo zeigt Pembaur sich als inspirierter, spätromantischer Harmoniker. Zwischen Gloria und Graduale wurde bei der hier festgehaltenen Aufführung ein weiteres Werk Pembaurs eingeschoben: das kurze Duett Vor der Krippe für Sopran und Alt mit Orgelbegleitung, das mit seiner volksliedhaften Melodik zu einem pastoralen Intermezzo wird. Zur Aufführung selbst lässt sich nur ein Einwand anführen: Warum wurden im Gloria und Credo nicht die traditionellen Intonationsformeln gesungen, mit denen Pembaur doch sicherlich gerechnet hat?
Vor dem abschließenden Stille Nacht erklang ein reines Instrumentalwerk, das mit Weihnachten nur indirekt verknüpft ist, aber mit seiner anmutigen Tonsprache sehr gut in ein solches Programm passt: Richard Wagners Siegfried-Idyll. Diesen symphonischen Nachtrag zum dritten Teil der Ring-Tetralogie hatte Wagner für seine Frau Cosima komponiert und anlässlich ihres Geburtstags am 25. Dezember 1870 erstmals dirigiert. Siegfried ist nicht nur der Name der Oper, aus der das thematische Material der Tondichtung entlehnt wurde, sondern auch der des Sohnes von Richard und Cosima Wagner, der ein Jahr zuvor zur Welt gekommen war. Mithin wird, wie im Falle des Weihnachtsfestes, auch mit dem Siegfried-Idyll der Geburt eines bestimmten Kindes gedacht.
Karlheinz Siessl lässt Wagners Werk in festen Tempi musizieren, kostet die Ruhepunkte aus ohne sich in ihnen zu verlieren und betont die feine Polyphonie, die sich durch die ganze Komposition zieht. Der Kontrast zwischen der spannungsvollen Harmonik und dem „Verweile doch, du bist so schön!“ der freundlichen Themen kommt trefflich zur Geltung. Mit der gleichen Sorgfalt werden die Vokalwerke dargeboten, für die hochmotivierte Chorsänger und ausgezeichnete Solisten (Stefanie Steger, Eva Schöler, Johannes Puchleitner und Stefan Zenkel) zur Verfügung standen. Wer sich zu Weihnachten musikalisch bezaubern lassen möchte, tut nicht falsch daran, zu diesem Album zu greifen.
[Norbert Florian Schuck, Dezember 2024]