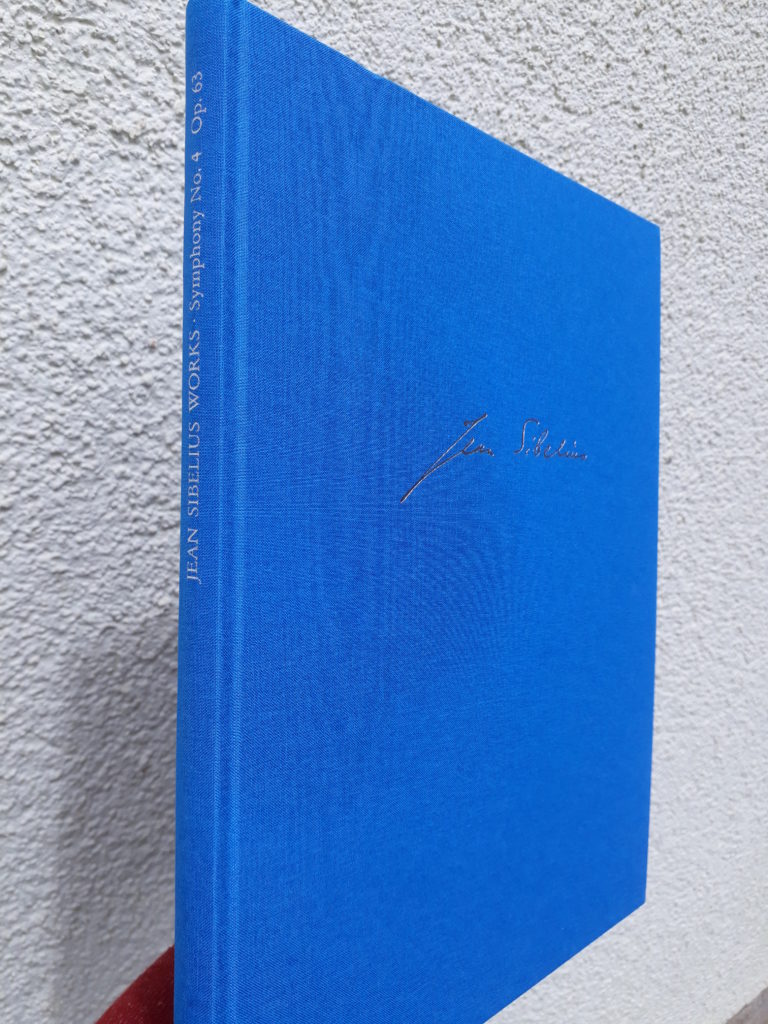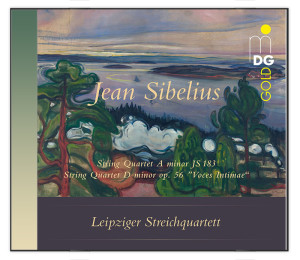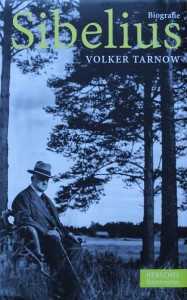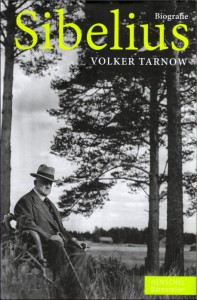Nur wenige Komponisten unserer Zeit können auf ein so umfangreiches Schaffen zurückblicken wie der 1949 im finnischen Forssa geborene Kalevi Aho, Autor von 17 Symphonien, mehr als doppelt so vielen Instrumentalkonzerten und gut sechs Dutzend Werken für kammermusikalische Besetzungen vom Solostück bis zum Sextett. Einige dieser Werke gehören zu den meistgespielten zeitgenössischen Kompositionen ihrer jeweiligen Gattungen. So erlebte beispielsweise das Schlagzeugkonzert Sieidi in den zehn Jahren seit seiner Premiere 2012 bereits über 120 Aufführungen. In seiner Heimat ist Aho längst eine etablierte Größe des Musiklebens, wie nicht zuletzt das seit 2016 in seiner Geburtsstadt veranstaltete Festival Musica Kalevi Aho verdeutlicht. Aber auch außerhalb Finnlands weiß man den Meister zu würdigen. In Wien nahmen Musiker und Musikwissenschaftler den 74. Geburtstag des Komponisten am 9. März 2023 zum Anlass, mit einem Kammerkonzert und einer Gesprächsrunde an den beiden vorangegangenen Tagen gleichsam in das Jubiläum hinein zu feiern. Kalevi Aho wirkte an beiden Veranstaltungen mit.
Im Konzert, das am 7. März im Gläsernen Saal des Wiener Musikvereins stattfand, spielten das Violinistenehepaar Rémy und Iris Ballot, auch bekannt als Dirigent und Konzertmeisterin des Wiener Klangkollektivs, und die Pianistin Anika Vavić. Zwei Kompositionen Kalevi Ahos bildeten den Rahmen des Programms. Dazwischen waren Werke verschiedener anderer Komponisten zu hören: von Ahos verehrtem Lehrer Einojuhani Rautavaara, vom Übervater der finnischen Musik Jean Sibelius und von den beiden russischen Meistern Sergej Prokofjew und Dmitrij Schostakowitsch – die meisten davon mit einem mehr oder weniger deutlichen Bezug zu Wien. Nur in den Fünf Stücken für zwei Violinen und Klavier, einem Arrangement verschiedener Nummern aus Ballettsuiten und Filmmusiken Schostakowitschs durch Lewon Atowmjan, fanden alle drei Instrumente zusammen. Das übrige Programm bestand aus Solo- und Duowerken. Man hätte den Abend schwerlich eindrucksvoller eröffnen können als mit Rémy Ballots Darbietung von In memoriam Pehr Henrik Nordgren, einem Solostück, das Kalevi Aho 2009 zu Ehren des im Jahr zuvor gestorbenen großen Komponistenkollegen geschrieben hat. Ballot ließ die Musik sich mit rhapsodischer Spontaneität entfalten, ohne darüber den strengen, konsequenten Aufbau des Werkes zu vergessen. Die melismatischen Abschnitte und die choralartigen Doppelgriffpassagen gingen auseinander hervor wie Vorgesang und Responsorien, es entstand die bezwingende Wirkung eines schamanischen Trauerrituals. Hervorgehoben verdient noch zu werden, mit welcher Sicherheit Ballot eine äußerst leise Passage in höchster Lage meisterte, in der die Musik sich kaum mehr hörbar vor dem rauschenden Hintergrund des Bogenstrichs abspielt. Anika Vavić, die Ballot in Prokofjews Fünf Melodien op. 35a eine einfühlsame Begleiterin war, zeigte in der Suggestion diabolique op. 4/4 des gleichen Komponisten ihre Virtuosität, bevor sie sich in Sibelius‘ Impromptu op. 5/6, dem Tempo di valzer aus Prokofjews Klaviersonate Nr. 6 und Schostakowitschs Lyrischem Walzer & Romanze aus den Puppentänzen op. 91b als Meisterin der Charakterisierungskunst erwies. Durch alle Stücke, die gewissermaßen die Ausstrahlung des Wiener Walzers in andere Musikkulturen verdeutlichen, pulste jener dezente Schwung, der den Walzer erst zum Walzer macht. Ausgezeichnet gelang der Pianistin die verschiedenen Lagen des Klaviers gegeneinander abzuheben, sodass die einzelnen Stimmen miteinander dialogisierten und sich zeigte, wie farbig die Komponisten auf dem Klavier „instrumentieren“ konnten. Dieses klangliche Feingefühl kam auch den zwei Stücken Der Tod der Gottesmutter und Zwei Dorfheilige aus Einojuhani Rautavaaras Klavierzyklus Ikonen sehr zugute. Vavićs sicheres rhythmisch-melodisches Gespür ließ zudem die volksmusikalischen Wurzeln der Musik deutlich werden. Als drittes Stück Rautavaaras war eine Erinnerung an dessen Wiener Studienjahre zu hören, die den dritten Satz seiner Suite Lost Landscapes für Violine und Klavier bildet und nach der damaligen Wohnadresse des Komponisten Rainergasse 11, Vienna heißt. In dieser tiefempfundenen Elegie fand Anika Vavić in Iris Ballot ihre Partnerin an der Violine, und die Aufführung zeigte, dass Frau Ballot ihrem Manne im feinfühligen Gestalten der Phrasen, in der Sorgfalt der Tongebung und im Erfassen der melodischen Bögen nicht nachsteht. Die bereits erwähnten Schostakowitsch-Bearbeitungen hätten sich auch als heiterer Kehraus geeignet, doch damit sollte das Konzert noch nicht zu Ende sein. Der Abschluss blieb einer Uraufführung vorbehalten. Kalevi Ahos Fragen für zwei Violinen entstanden 2022 als Auftragswerk anlässlich der Hochzeit von Iris und Rémy Ballot. Das gut zehnminütige Stück ist ein veritables Gespräch in Tönen. Ein Instrument „fragt“, das andere „antwortet“, die Motive wechseln zwischen ihnen hin und her, werden variiert und fortgesponnen, wie man im Gespräch von einem ins andere kommt. Im Laufe des Werkes tauschen die beiden Violinen wiederholt die Rollen. Auch gibt es Abschnitte, die weniger nach Frage und Antwort klingen als nach gemeinsamer Erörterung eines Sachverhalts. Aho ist hier ein höchst feinsinniges und abwechslungsreiches Duo gelungen, das zwei einander ebenbürtige, technisch starke Spieler, die zeigen wollen, wie gut sie aufeinander hören können, vor lohnende Aufgaben stellt. Die Ballots haben sich „ihr“ Werk ganz zu eigen gemacht und brachten es aufs erfreulichste zum Sprechen, wobei zwischen beiden eine bewundernswerte Ausgeglichenheit herrschte. Eine solch innige Verbindung mit- und ein solch behutsames Eingehen aufeinander dürfte dem Komponisten als Ideal wohl vorgeschwebt haben.
Das Konzert bestand nicht nur aus musikalischen Beiträgen. Durch den Abend führte Peter Kislinger, der wohl beste Kenner des Ahoschen Schaffens in Österreich, der einem größeren Publikum vor allem durch seine Beiträge im Österreichischen Rundfunk (Ö1) als Förderer zeitgenössischer und Entdecker wertvoller, in Vergessenheit geratener Musik der Vergangenheit bekannt ist. Seine lebendigen Einführungen in die jeweiligen Stücke gaben dem Konzert ebenso zusätzlichen Wert wie die wiederholten kurzen Gespräche mit dem Komponisten. Kalevi Aho sprach u. a. über seine Freundschaft mit Pehr Henrik Nordgren und über Einojuhani Rautavaara, der gerade deswegen ein sehr guter Lehrer war, weil er es verstand, sich in die Werke seiner Schüler hineinzuversetzen und sie zu ermutigen, ihren eigenen Stil zu entwickeln. Auch über Ahos gegenwärtige Projekte konnten die Zuhörer etwas erfahren. Der Komponist hat gerade den Kopfsatz seiner Achtzehnten Symphonie vollendet, auch sei ein Orchesterwerk in Arbeit, das die Fragen aufgreift, aber anders weiterführt.
[Korrektur, 16. März 2023: Nach Mitteilung der Kalevi Aho Society wurde das Doppelkonzert für Violine, Violoncello und Orchester, welches am Anfang die Fragen zitiert, bereits am 18. Dezember 2022 vollendet.]
Am folgenden Tage leitete Dr. Andreas Holzer an der Universität für Musik und darstellende Künste eine Gesprächsrunde, an der neben Kalevi Aho auch Rémy Ballot, Peter Kislinger und die junge japanische Komponistin Reina Yoshioka teilnahmen. Angelpunkte des Gesprächs waren fünf Punkte, die Aho einst in einem Artikel als Aufgaben für die Komponisten unserer Zeit ausgemacht hatte:
1) Die Wiederentdeckung des Publikums
2) Die Suche nach einem Ausweg aus einer hermetischen Avantgarde samt Stärkung der Verbindung zur Vergangenheit
3) Die Stärkung der gesellschaftlichen Dimension von Musik
4) Die Entwicklung von Strategien, den Elfenbeinturm abzutragen
5) Der Komponist müsste fähig sein, der Musik tiefe emotionale Ausdrucksqualitäten zu verleihen
Aho berichtete aus dem finnischen Musikleben, wo zeitgenössische Musik ein fester Bestandteil regulärer Konzerte ist und nach wie vor zahlreiche neue Opern mit der Aussicht entstehen, in den namhaften Theatern des Landes zur Aufführung zu gelangen. Er selbst möchte Musik schreiben, die vom Publikum gern gehört und von Musikern gern gespielt wird. Sein erster Zuhörer ist er selbst: „Ich komponiere Musik, die ich selbst hören möchte.“ Als regelmäßig mit Aufträgen bedachter Komponist, trifft er sich sich vor der Arbeit an einem bestellten Werk mit den Musikern, für die es entstehen soll: „Zuerst kommen die Musiker zu mir und spielen mir vor. Dann denke ich an ihre Persönlichkeit und versuche so zu schreiben, dass das Werk für die Musiker sitzt. Wenn es für einen Musiker sitzt, dann wird es auch für andere Musiker annehmbar sein können.“ Aho gehört nicht zu denjenigen Komponisten, die um jeden Preis originell sein wollen: „Der Stil hängt davon ab, was man sagen möchte. Ich möchte nicht in einem Personalstil komponieren, denn dann verfällt man in Klischees. Ich mache mir klar, was ich sagen möchte. Der Stil kann sich von Werk zu Werk ändern, was sich nicht ändert, ist die Persönlichkeit des Komponisten.“ Dies ist einer der Gründe, warum der mitteleuropäische Modernismus, wie er sich letzten Endes in der Darmstädter Schule manifestierte, für ihn etwas Altmodisches ist. Großen Einfluss auf sein Schaffen hatte dagegen das Studium ursprünglicher musikalischer Phänomene außerhalb Europas: „Die Lösungen für Probleme fand ich nicht im mitteleuropäischen Modernismus, sondern ich habe mich mit Indischer und Arabischer Musik befasst. Ich habe seitdem oft arabische Instrumente verwendet und ein Buch über arabische Rhythmen geschrieben.“ Mit Jean Sibelius hat sich Aho viel beschäftigt. Er kennt sein Schaffen gut, sieht sich ihm durchaus innerlich verwandt, orientiert sich aber nicht bewusst an ihm. Auch denkt er beim Komponieren nie an etwas Finnisches. Seine Werke schreibt Aho seit langem sofort ins Reine, ohne Skizzen zu machen. „Ich fange an und mache weiter bis zum Schluss. Wenn ich beginne, weiß ich noch nicht, wie es sich entwickelt. Ich habe nur zweimal versucht, nach einem Plan zu schreiben. Habe ich etwa zwei Drittel des Stückes fertig, kann ich ungefähr sagen, wie es enden wird.“ Mitunter kristallisiert sich die jeweilige Gattung erst im Laufe des Kompositionsprozesses heraus. Interessanterweise entstand keine der ersten vier Symphonien des heute vor allem als Symphoniker bekannten Komponisten unter dem Vorsatz eine Symphonie zu schreiben. Zu seiner Ersten sagt Aho: „Ich wollte nur ein großes Werk für Orchester schreiben. Da sagte mein Lehrer Einojuhani Rautavaara: Das ist eine Symphonie.“ Auf die Frage, wie er den Begriff „Symphonie“ definiert, antwortet der Komponist: „Eine Symphonie ist ein großes Orchesterwerk, in dem der Komponist zeigt, was er kann, in dem er seine Gedanken kristallisiert.“ Kritik äußerte Aho an Konzertagenturen, die die von ihnen geförderten Musiker davon abhalten, sich mit zeitgenössischer Musik zu befassen. Er erzählte, wie ihn eine Geigerin um ein Violinkonzert bat, er sie jedoch aufgrund anderer Aufträge um zwei Jahre vertrösten musste. Nach der Fertigstellung des Werkes traf er die Geigerin wieder, doch sagte sie ihm diesmal, sie fühle sich noch nicht reif für moderne Musik. „Sie hatte eine andere Agentur.“
Vergnüglich waren Peter Kislingers Berichte über das Verhalten der Wiener Kritik im Laufe der Jahre gegenüber Werken zeitgenössischer finnischer Komponisten. Die von ihm zitierten Rezensionen boten wunderbares Anschauungsmaterial hinsichtlich des Umgangs der Kritiker mit dem Konzertpublikum. So erfuhr man vom einen Kritiker, dass das Wiener Publikum viel zu gebildet und anspruchsvoll sei, als dass solche Anbiederungsversuche, wie sie von Komponisten wie Rautavaara und Aho unternommen würden, Aussicht auf Erfolg hätten. Ein anderer Kritiker widersprach dem, denn die Musik habe dem Publikum gefallen – sie könne deshalb wenig taugen.
Rémy Ballot sprach aus eigener Praxis über das Erfassen des Zusammenhangs innerhalb einer Komposition – eine Sache, die ja nicht nur den Autor des Stückes und seinen Vermittler betrifft, sondern eminente Auswirkungen auch auf die Zuhörer hat. Denn wie kann ein Hörer ein Stück als ein Ganzes erleben, wenn es dem Musiker nicht gelingt, den Zusammenhang der Musik deutlich zu machen? „Der Klang ist nicht die Musik. Der Klang kann Musik werden. Er kommt von einem inneren Prozess her.“ Erst wenn es dem Musiker gelingt, Kontinuität in die Klänge zu bringen, das Hervorgehen eines klanglichen Phänomens aus dem anderen nachzuvollziehen, kommt eine lebendige Aufführung zustande. Wer unter den Zuhörern dieses Gesprächs das Konzert Tags zuvor miterlebt hatte, wusste nun, warum der Eindruck ein so vorteilhafter war!
Am 9. März, seinem 74. Geburtstag, reiste Kalevi Aho aus Wien ab. Und man hofft, dass die altehrwürdige Musikmetropole auch den 75. Geburtstag des Meisters angemessen zu würdigen versteht.
[Norbert Florian Schuck, März 2023]