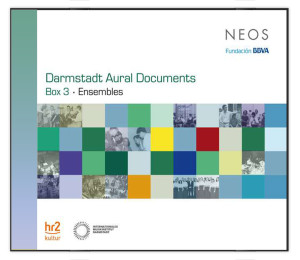Im Konzert der musica viva am 12. April 2024 im Münchner Herkulessaal spielte das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter François-Xavier Roth die Uraufführung des Bratschenkonzerts von Francesco Filidei (Solist: Antoine Tamestit), „Cloudline“ der US-Amerikanerin Elizabeth Ogonek sowie Iannis Xenakis‘ unglaublich herausforderndes Werk „Aïs“ – mit dem Bariton Georg Nigl und dem Schlagzeuger Dirk Rothbrust. Zu Ehren des kürzlich verstorbenen Komponisten und Dirigenten Peter Eötvös hatte man dessen Stück „Sirens’ Song“ zusätzlich aufs Programm gesetzt.
Im März 2024 haben wir innerhalb von nur elf Tagen gleich drei echte Weltstars der Neuen Musik verloren: Aribert Reimann, Maurizio Pollini, und am 24. 3. den Ungarn Peter Eötvös (Jahrgang 1944). Der war als Komponist bereits 1980 mit einem Kammermusikwerk bei der musica viva vertreten, hat dann ab 1989 regelmäßig das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks für dieses Format geleitet und dabei Musiker wie Publikum stets begeistert. 2019 war ein komplettes Programm Eötvös‘ eigener Musik gewidmet (wir berichteten). Grund genug, nach einer empathischen Würdigung durch Winrich Hopp und einer Schweigeminute eines seiner letzten Orchesterwerke – Sirens‘ Song von 2020 – erklingen zu lassen.
Schon hier spürt man, dass François-Xavier Roth und das BRSO einen großen Abend haben. Tatsächlich ist das Stück für mittelgroßes Orchester, in dem der Komponist versucht „hörbar zu machen, was Odysseus niemals zu Gehör bekommen hat“ (Eötvös) rhythmisch relativ simpel gestrickt. Harmonisch bilden zunächst Quint- und Tritonus-Schichten die Basis für liebreizende, zugleich ungreifbare Glissandi und wunderbare Bläser-Klangmischungen. Später kommen – von den Bässen ausgehend – Quartschichtungen hinzu; da wird’s schon gefährlicher – und die Bläser mutieren zu „Killervögeln mit Frauenköpfen“. Die Streicher ziehen die Zuhörer jedoch nach und nach in den Abgrund – fast unmerklich, ohne dass es laut würde. In einer kurzen Coda – quasi Dur – bleibt nur das sonnendurchflutete, ruhige Meer: hübsche, völlig nachvollziehbare Musik, die mit ihrer Schönheit auch das Publikum betört.
Francesco Filidei (*1973), der gerade an einer Oper nach Umberto Ecos Der Name der Rose arbeitet, hat die drei Sätze seines gut halbstündigen Konzerts für Viola und Orchester so ziemlich mit allen technisch-klanglichen Möglichkeiten gespickt, die sich für das – verglichen mit der Violine – solistisch immer noch etwas unterbelichtete Instrument anbieten. Der lange erste Satz Die Gärten von Vilnius ist eine Umarbeitung von Filideis gleichnamigem Cellokonzert. Hierbei bezieht sich der Komponist ausdrücklich beispielsweise auf die Tradition von Ottorino Respighis Tondichtungen. Die Verbindung von struktureller Klarheit – hier u. a. symmetrische bzw. „kreisförmige“, fraktale Motivbildungen – und beeindruckender Instrumentationskunst, etwa der konsequenten Auffächerung von Geräuschen über das totale Klangspektrum, sind wie immer bei ihm völlig faszinierend; ebenso, wie er die Solo-Viola dramaturgisch einsetzt. Der Mittelsatz ist rein humoristisch, sozusagen ein einziger, comic-artig vertonter Bratschenwitz. Antoine Tamestit muss hier auf „metronomische“ Vorgaben der Schlagzeuger Skalen, Flageolets usw. „üben“ – was natürlich schiefläuft. Die halbszenische Solistenpose wird dadurch völlig dekonstruiert: zur Posse. Dasselbe geschieht mit dem Material im Orchester, deutlich erkennbar etwa der C-Dur-Schlussfuge von Verdis Falstaff entnommen; die Einleitungstakte dazu werden – mittendrin – gar wörtlich zitiert. Aberwitzig ironisch erinnert dieses gut getimte Intermezzo den Rezensenten an den Mittelsatz TSIAJ („This Scherzo Is A Joke“) von Charles Ives‘ Klaviertrio. Das melancholische Finale – gegen Schluss erklingen nochmals Fragmente aus den Sätzen zuvor – bietet schließlich Tamestit die Gelegenheit, auf seiner Stradivari zu singen. Hinreißend, wie sich diese erfüllte Präsenz seiner Persönlichkeit auf den fast ausverkauften Herkulessaal überträgt: großer Beifall für ein musikalisch vielschichtiges Konzert.
Obwohl viel kürzer, kann Cloudline (2021) der jungen Amerikanerin Elizabeth Ogonek (*1989) – wie Filidei persönlich anwesend – Publikum wie Rezensent fast noch mehr begeistern. Selten hat man ein derartig natürliches, offenkundiges Gespür erlebt, für Orchester zu schreiben. Einerseits ausgehend von Wolken als Naturphänomen, andererseits dem Wunsch – und für die Uraufführung in der gigantischen Londoner Royal Albert Hall absolute Notwendigkeit –, mikrotonale Multiphonics der Klarinetten für einen größeren Klangkörper regelrecht zu instrumentieren, überzeugt dieses Werk auf ganzer Linie – bis ins Detail sensibelst austariert und im wohlklingenden Ergebnis einfach staunenswert.
Im krassen Gegensatz zu solcher Ästhetik steht Iannis Xenakis‘ „Aïs“ (= Hades), ein Auftragswerk für die musica viva von 1980 (UA 1981). Diese Auseinandersetzung mit dem Tod verlangt neben dem üblichen Riesenorchester einen Solo-Schlagzeuger – vor dem Orchester platziert und ganz vortrefflich: Dirk Rothbrust. Hauptprotagonist ist allerdings der Bariton, mit einer Partie, die – wie eigentlich das gesamte Stück – eine bewusste Zumutung darstellt. Über weite Strecken in höchster Lage der Kopfstimme, später in unglaublich schnellen Wechseln zwischen extrem tiefer – nur da hat man eine Chance, Textfragmente zu verstehen – und wiederum exponierter Falsettlage, muss sich der Solist sichtbar nicht nur gesangstechnisch, sondern ebenso emotional total verausgaben. Georg Nigl gelingt das einmal mehr überragend. Ob singend, schreiend oder deklamierend: Nigls Gestaltung geht an die Nieren, und er ist wohl der erste Sänger, der hier nicht wie ein unfreiwilliger Kastrat klingt, sondern von Beginn an dunkelste Ernsthaftigkeit zu transportieren vermag. Die leichte, leider suboptimale, da durch die benutzten Monitore zu sehr in die Breite gezogene Verstärkung, ist eher ein notwendiges Übel. Vor solch einem Künstler, der ja mit gleicher Energie einen Eisenstein (Fledermaus) gibt, kann man sich nur verneigen.
Das BRSO, von jeher mit einem verblüffend guten Zugang zur kompakten Musik Xenakis‘, legt diesmal wieder eine echte Glanzleistung hin. Man spürt förmlich die Begeisterung für diese alles andere als leichte Kost. Und Roth leitet das gesamte Konzert – auch er dirigiert ohne Taktstock – handwerklich präzise, hat zudem die unglaubliche Vielfalt verschiedenster Klänge mit klarer Vorstellung verinnerlicht und sie in den Proben seinen Musikern offensichtlich kongenial sehr nahegebracht. Trotz aller Herausforderungen wirkt er auf dem Podium völlig entspannt. In allen vier Werken zeigt das BRSO sich in Bestform, ist wirklich zu 100% souverän bei der Sache. Der Saal belohnt Solisten, Dirigent und Orchester schließlich mit Bravos und ungewohnt langanhaltendem Applaus. Wie gesagt: ein ganz besonderer Abend.
[Martin Blaumeiser, 13. April 2024]