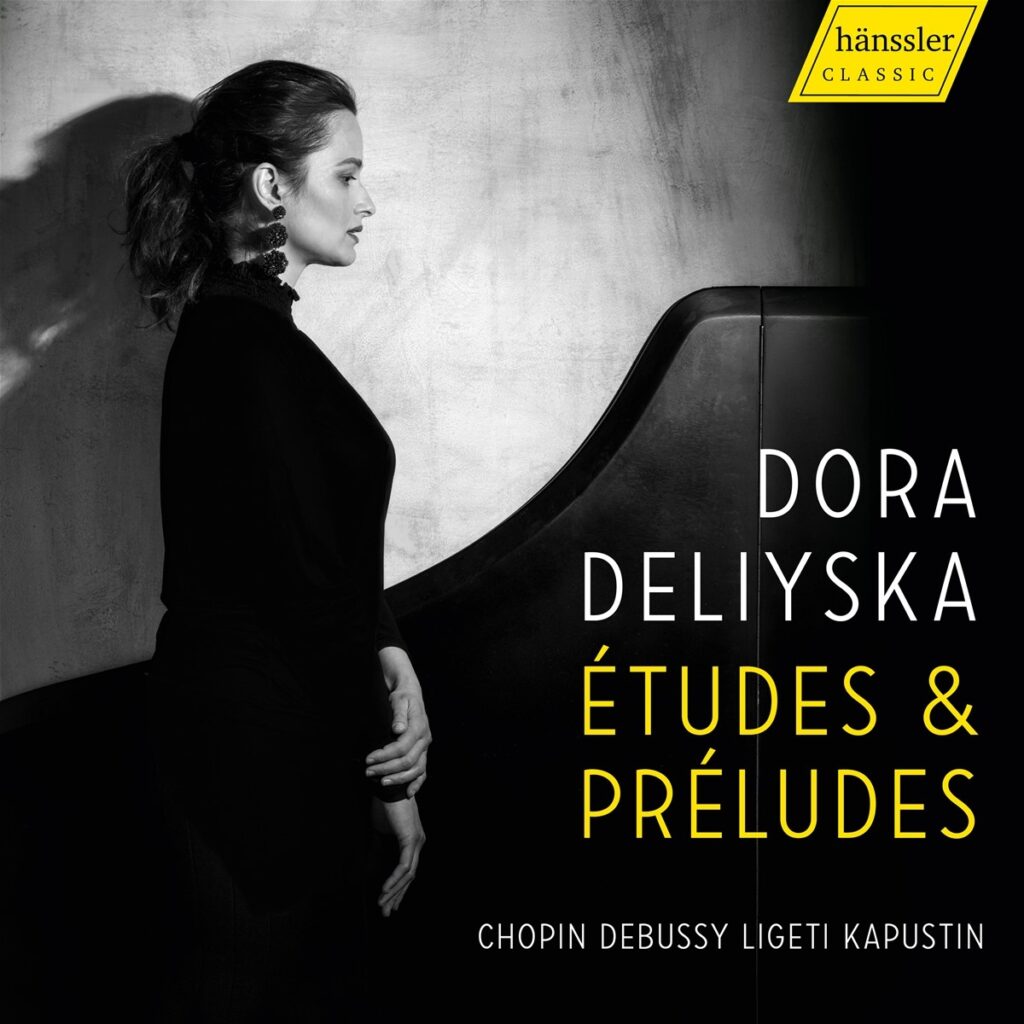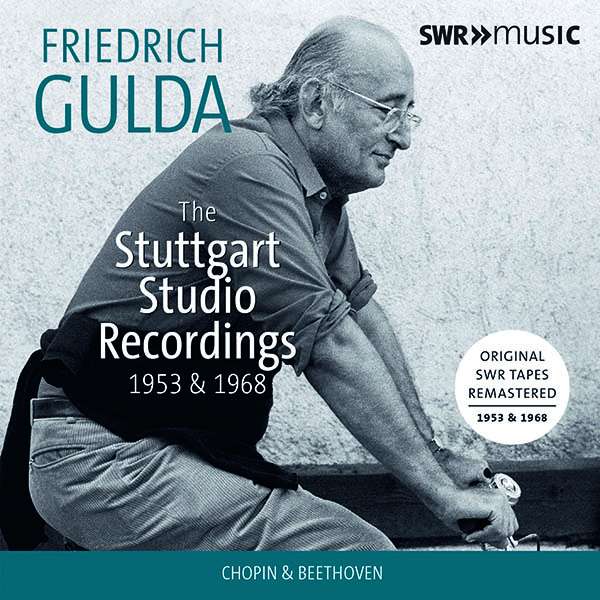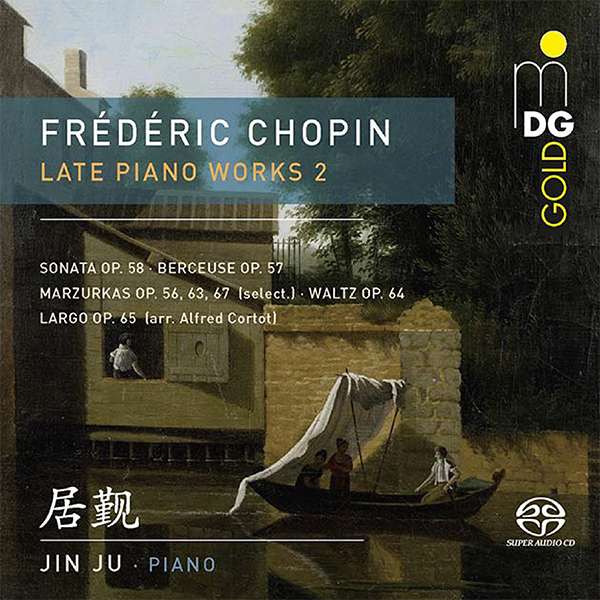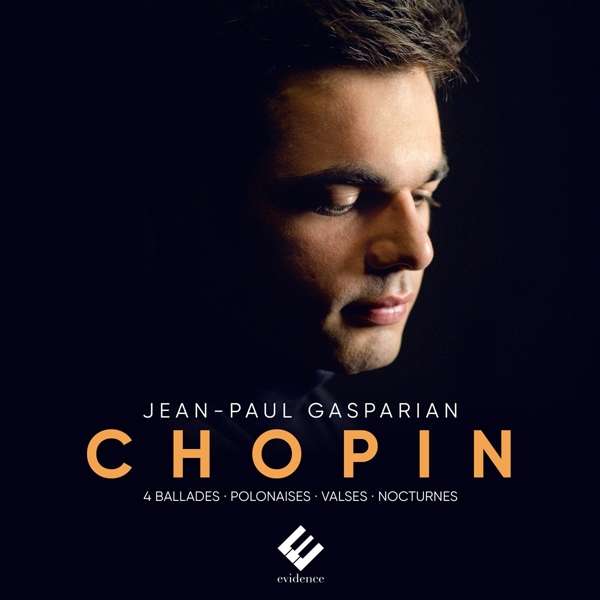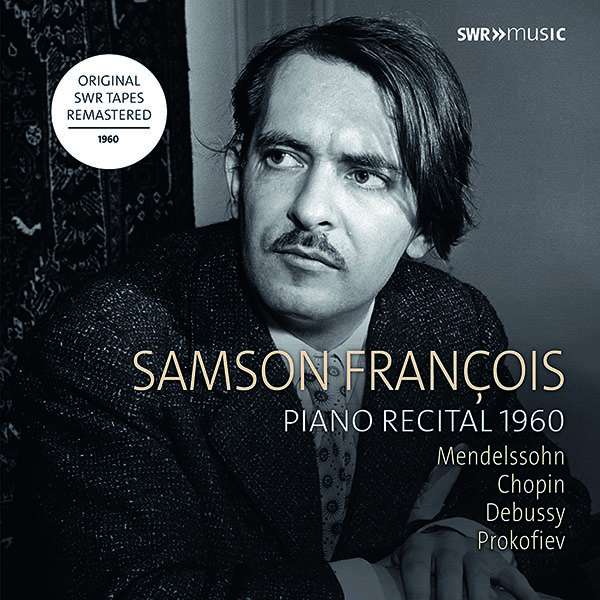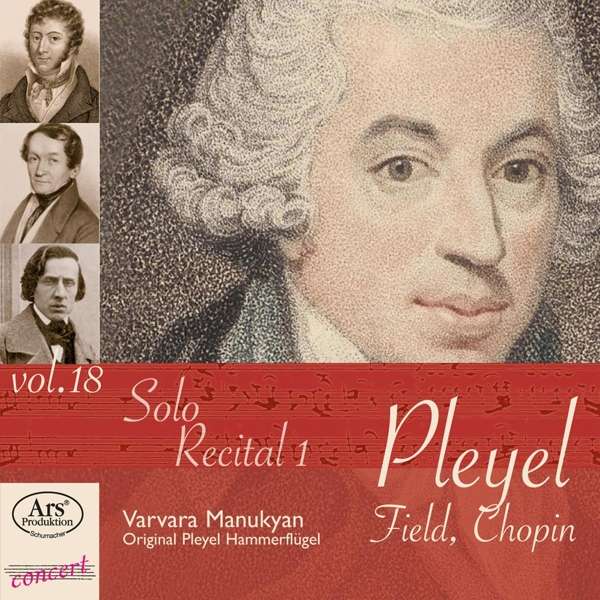Heute spreche ich mit der Pianistin Varvara Manukyan, die gerade ihre
Solo-CD mit Klavierwerken von Ignaz Pleyel, John Field, Camille Pleyel und
Frédèric Chopin herausgegeben hat.
[Rezension zur CD]
Dies war ja Ihre erste CD-Publikation, oder?
Ja und nein. Dazu muss ich
vielleicht zuerst einmal erzählen, wie ich zur internationalen Ignaz-Pleyel-Gesellschaft
(IPG) kam. Den Anstoß gab die Geigerin Cornelia Löscher, mit der ich zusammen
im Duo und Trio spiele. Seit über 10 Jahren pflegt sie die Verbindung zur
Pleyel-Gesellschaft und hat bereits als Studentin viele Werke von Ignaz Pleyel
aufgeführt. Vor circa fünf Jahren wurde sie vom Präsidenten der
Pleyel-Gesellschaft, Prof. Dr. Adolf Ehrentraud, gefragt, ob sie nicht eine
Hammerklavierspielerin kenne, mit der zusammen sie alle 48 Klaviertrios von
Ignaz Pleyel einspielen könne. Durch unsere lange Zusammenarbeit hat sie mich
empfohlen und so kam es, dass ich nach Ruppersthal zum Pleyel Zentrum gefahren
bin und den Komponisten sowie sein Umfeld für mich entdeckt habe – und auch
seine Flügel! In Arne Kirchner fanden wir noch einen wundervollen Cellisten,
der neben modernen auch auf alten Instrumenten spielt, und so ist das IPG
Pleyel Klaviertrio entstanden. Mit diesem Trio haben wir bereits drei CDs mit
je drei Trios aufgenommen, von denen bislang eine publiziert wurde [Ars 38 203;
EAN: 4260052382035].
Die CD
„Piano Recital“ ist meine erste Solo-CD, auf der ich neben einer Klaviersonate
von Ignaz Pleyel auch die romantischen Nocturnes von Field, Chopin und von
Camille Pleyel, dem Sohn von Ignaz, aufgenommen habe. Für die Trio-CD habe ich
einen Hammerflügel vom Vater aus dem Jahr 1830 verwendet, der im Geburtshaus
Pleyels steht; auf der Solo-CD hören Sie Klänge eines Camille-Pleyel-Instruments,
das 1838 gebaut wurde. Die Instrumente sind wirklich sehr unterschiedlich, was
auch die CDs voneinander abhebt – zusätzlich zur Besetzung.
Wie kamen Sie nun dazu, für die Solo-CD
einen vergleichsweise jungen Flügel zu spielen? Die meisten der Stücke
entstanden ja bereits vor 1838 und in der damaligen Zeit entwickelten sich die
Klaviere derartig schnell, dass wenige Jahre große klangliche Differenzen geben
konnten.
Wir hatten
einerseits natürlich nicht die größte Auswahl, was das Instrument betrifft.
Dieses Klavier steht im Pleyel Kulturzentrum in einem extra für Aufnahmen eingerichteten
Saal. Ein anderes historisches Hammerklavier in den Saal zu transportieren,
fand ich unnötig, weil mir dieses Instrument für diese Werke sehr passend
erschien. Die romantischen Stücke von Field, Chopin und Camille Pleyel
funktionieren auf solch einem Klavier vielleicht sogar noch besser, als auf
einem etwas früheren Instrument – obgleich, klar, die Stücke vor dem Instrument
entstanden. Camille Pleyel stand ja in enger Verbindung mit Chopin, der genau
solche Instrumente verwendete und auf ihnen spielte und komponierte.
Entsprechend wunderbar ist es, die Stücke auf genau solch einem Instrument
aufzunehmen. Gleiches gilt natürlich auch für Camille Pleyel selbst, der selbst
komponierte und nicht nur Klaviere baute. Von John Field wissen wir nicht,
welche Flügel er verwendete – aber vielleicht hat er seine Nocturnes und andere
spätere Werke ebenfalls auf Instrumenten von Camille oder sogar von Ignaz
gespielt. Die Flügel entsprechen gewissermaßen der Zeit der aufkeimenden
Romantik und so schmeicheln sie auch den Werken dieser Zeit.
Den ersten Programmpunkt des Solorezitals
bildet eine Klaviersonate von Ignaz Pleyel, die erstmalig eingespielt wurde.
Wie kamen Sie auf genau diese Sonate? Welchen Stellenwert nimmt allgemein die
Klaviermusik im Schaffen Pleyels ein? Als Komponist kennt man ihn schließlich,
wenn überhaupt, hauptsächlich für seine Streichquartette und Klaviertrios.
Und selbst
im Bezug auf Quartette und Trios ist der Name heute meist unbekannt, nur wenige
wissen um seine Streichermusik und noch weniger um seine Klaviermusik. Im Laufe
meiner langjährigen Kooperation mit der Ignaz-Pleyel-Gesellschaft kam ich dazu,
auch viele seiner Solowerke zu entdecken und zu spielen. In einem Jahr habe ich
mich vor allem seinen Sonaten verschrieben; und diese Sonate wurde schnell zu
meiner Lieblingssonate, weshalb ich sie für diese CD ausgewählt habe. Pleyel
Vater musste einfach auf die CD, wenngleich er vielleicht programmatisch nicht
unbedingt passt, da er im Gegensatz zu den anderen Komponisten kein Romantiker
war – aber ohne ihn wäre all das, was nachfolgt, unmöglich. Er hält all das
andere zusammen, von den Komponisten der CD über die Klavierfabrik bis hin zur
IPG und dem Pleyelsaal. So entsteht eine ruhende Wahrnehmung des
gesamten Programms.
Bei der Sonate fällt die Struktur auf, es gibt einen ziemlich langen
Kopfsatz, auf den zwei recht kurze Sätze folgen.
Allgemein unterscheiden sich die
Klaviersonaten Pleyels deutlich, bei dieser fällt natürlich das kurze Finale
auf; typisch allerdings sind knappe Mittelsätze. Diese zweiten Sätze bestechen
durch ihre Sanglichkeit: Man sagt, Pleyel singe in seinen Instrumentalwerken
und es ist wirklich wahr, daran erkennt man ihn. Während seines
Italienaufenthalts, wo er bei Wanhal studierte, hörte er sicherlich zahlreiche
Opern, was sich dann in der Musik niederschlug. Über die dritten Sätze lässt
sich wenig Allgemeines aussagen, oft zeichnen sie sich aus durch eine
spielerische, tänzerische und lustige Art. Wie zu der Zeit oft üblich, liegt
das Hauptaugenmerk der Sonaten auf dem Kopfsatz.
Mozart sagte einmal, man erkenne viel Haydn in der Musik Pleyels, und
schrieb das in einem Brief an seinen Vater nieder.
Richtig, Mozart schrieb, man
würde den Meister (Haydn) gleich herauskennen. In dem Brief erwähnte Mozart sogar,
dass Pleyel Haydn einmal ersetzen, als sein Nachfolger wirksam werden könne.
Das ist schon eine große Vorhersage.
Würden Sie Mozart zustimmen?
Auf jeden Fall kann ich nichts
dagegen sagen; tatsächlich kam es jedoch anders und Pleyel wurde nicht Haydns Nachfolger.
Was sich letztlich nicht gerade positiv auf seine Nachwirkung
ausgewirkt hat. Während bei Haydn die Frühwerke vergleichsweise nur selten zu
hören sind, wie beispielsweise die ersten Klaviersonaten, wurden und werden die
späten Werke damals wie heute regelmäßig aufgeführt. Pleyel hätte einen guten
Anknüpfungspunkt bekommen.
Genau, aber so wissen wir nun
wenig über seine Rolle und können diese auch gar nicht nachvollziehen. Er
schrieb so viele Werke, von Oper, Marionettenoper bis Kammer- und Klaviermusik
– was wir alles nicht kennen, der Name ist den meisten nicht einmal ein
Begriff.
Wie konnte das eigentlich passieren, dass Pleyel so schnell aus dem
Gedächtnis der Öffentlichkeit verschwand?
Ende des 18. und Anfang des 19.
Jahrhunderts zählte er zu den meistgespielten Komponisten Europas. Doch die
Geschichte spielte gegen ihn: Er wohnte damals nicht in Österreich, sondern in
Straßburg, wo er die Französische Revolution miterlebte. Viele der Komponisten,
sogar der Autor der Marseillaise, wurden verhaftet – was Pleyel mehr oder
weniger dazu zwang, eine Revolutionskantate zu schreiben. Später war sein Name
einfach nicht mehr präsent, er findet sich nicht einmal in österreichischen
Schulbüchern und Komponistenverzeichnissen – das könnte teils an den
politischen Umständen liegen, teils aber einfach am Zufall.
Pleyel teilt damit das Schicksal zahlloser großartiger Komponisten, die aus
teils uneinsichtigen Gründen von der Bildoberfläche verschwanden. Umso
wichtiger finde ich es, sie heute wiederzuentdecken. Die Werke sollen von der
Öffentlichkeit gehört und auch gespielt werden. Das verändert die „Hierarchie“
der Komponisten, wie sie heute in den Köpfen der Hörer herumspukt.
Pleyel wirkte nicht zuletzt als Noteneditor, er verlegte zahlreiche
Werke von Haydn, Clementi und Beethoven, hatte für manche Opera gar das
alleinige Publikationsrecht.
Es gibt wohl kaum eine so
vielseitige Figur in Europa wie Pleyel, der Komponist war, Klavierbauer,
Noteneditor und auch Gründer vom Pleyelsaal, wo zahlreiche heute große Namen
wie Chopin debütierten. Das zeigt uns seine Persönlichkeit in einer ganz
anderen Rolle.
Wer gehörte denn zum Umkreis von Ignaz Pleyel? Mit welchen Komponisten
der Zeit stand er in Kontakt?
Pleyel kannte viele Größen der
Zeit, durch seine vielseitige Beschäftigung konnte man sich seinem Einfluss
kaum entziehen. Selbst Beethoven zählte zum Umkreis, wenngleich es keinen
regelmäßigen Austausch gab. 1807 schrieb Beethoven dem Sohn, wobei er sich
erkundigte, wie es dem Vater und ihm ginge, und er freue sich darauf, die
beiden wiederzusehen. Das sagt viel aus über die Beziehung, da Beethoven
bekannterweise nicht zu den einfachsten Menschen gehörte – solch einen Brief
hätte er nicht ohne Grund geschrieben.
Spielte Beethoven auch auf einem Pleyel-Flügel?
Das lässt sich schwer sagen. Aber
zumindest kannte er sie und schrieb auch, dass er sie sehr schätze.
Wenn wir auf der CD weitergehen, blicken wir nun auf das Umfeld von
Ignaz Pleyels Sohn, Camille.
Genau, wir beginnen mit dem Kopf
des Ganzen, mit dem Vater und Gründer, dem ‚Möglichmacher‘ all des Folgenden.
Dann gehen wir weiter zur Romantik, der auch Camille Pleyel angehörte. Hier
beginnen wir mit vier Nocturnes von John Field, der dieses Genre ins Leben
gerufen hat. Dann widmen wir uns Camille Pleyel, welcher sich in seiner zu
hörenden Nocturne „á la Field“ den Ursprüngen verschrieben hat, und später
Chopins drei Nocturnes als Apotheose der Gattung. Die drei Nocturnes op. 9
stehen in Verbindung mit Pleyel, da sie Marie Moke Pleyel gewidmet sind, der
Frau von Camille. Das macht die Dramaturgie der CD aus.
Fangen wir mit John Field an: In welcher Beziehung stand er zur Pleyel
Familie? Kannten sie sich persönlich und hat er vielleicht sogar dort seine Klaviere
gekauft?
Ich persönlich weiß es nicht. Er gab
zwar zahllose Konzerte in ganz Europa, wohnte allerdings die meiste Zeit in
Moskau. Field lebte zur gleichen Zeit wie Ignaz Pleyel und die
Pleyel-Hammerklaviere fanden international großen Zuspruch, weshalb ich mir
eine persönliche Begegnung durchaus vorstellen kann.
Für mich musste Fiel auf die CD,
auch ohne Wissen um solch ein Treffen: denn Nocturnes ohne die Grundlagen
dieser Gattung zu spielen, fände ich schade.
In der Aufnahme fiel mir auf, dass Sie in den Field-Nocturnes viel
improvisiert haben; zumindest in der rechten Hand, während der Bass unverändert
weiterläuft; bei Camille Pleyel nicht.
Bei Pleyel sehe ich keine
Stellen, wo ich wirklich improvisieren würde, die Musik ist sehr selbstständig.
Bei Field, vor allem in der ersten Nocturne, öffnet sich ein ganz anderes Bild:
Hier laufen links die Triolen weiter und rechts stehen teils ganz lange Noten.
Da fragt man sich, was das bedeuten soll. Ein historisches Klavier besitzt
keine so kräftige Diskant-Lage, um den Ton ausreichend lange klingen zu lassen.
Die Note der Melodie geht unter und man hört nur die Triolen der Unterstimme –
das funktioniert musikalisch nicht. So bin ich überzeugt, dass hier wie auch in
der früheren Musik (beispielsweise im Barock) improvisiert wurde. Entsprechend
versuche ich, an diesen Stellen Neues einzufügen, und gleiches dort, wo es eben
stilistisch passt. Wenn man dies geschmackvoll macht, erhält das Stück eine
ganz neue Dimension. Das gibt ihnen auch etwas Fantasievolles, da sich in den
Stücken auch viel wiederholt, was so umgangen werden kann. Ich glaube, dass die
Nocturnes auch so gedacht waren; Field gibt uns diese Möglichkeiten, wir müssen
sie nur sehen und umsetzen.
Improvisieren Sie jedes Mal spontan aus dem Moment heraus oder richten
Sie sich an feste Vorlagen, die Sie komponiert, beziehungsweise vorbereitet,
haben?
Ich habe die einzelnen Läufe und
Ornamente aufgeschrieben und auswendig gelernt. Teils laufen die
Ausschmückungen über lange Strecken und sie müssen auch zur Harmonik passen,
und das bei all der Chromatik! Wenn es bei Bach oder seinen Söhnen kurze
Kadenzen gibt, die vielleicht zwei Takte lang sind: dort kann man jedes Mal
etwas Neues improvisieren, bei solch großem Format wie hier ist das allerdings
kaum möglich. Ich bin hier nach langem Nachdenken und Reflektieren auf eine
Variante gekommen, die ich nun in Konzerten und auch auf der Aufnahme spiele.
Mittlerweile ist dies obligato für
mich. Andere haben natürlich andere Ausschmückungen und ich freue mich immer,
im Konzert zu erleben, was andere aus dieser Nocturne machen mit ihren im
besten Sinne ganz eigenen Versionen – wie ein Fingerabdruck.
Die Werke von Camille Pleyel gehören der Romantik an. Hat er in dieser
Stil-Atmosphäre begonnen oder sich langsam dorthin entwickelt?
Nein, er begann direkt in der
Romantik und setzte sich deutlich vom Vater ab. Als er anfing, zu komponieren,
blühte der Stil bereits voll auf. Bei Camille entdeckt man sogleich einen ganz
persönlichen Stil, der zwar erkennbar zu seiner Zeit gehört, sich aber doch
gänzlich von anderen Komponisten der Zeit unterscheidet.
Die Nocturne Camille Pleyels betitelt er selbst als „Stilkopie“ nach
Field. Schlägt sich dies auch in der Musik nieder?
Tatsächlich lässt sich dieses
Werk in keiner Hinsicht als Stilkopie von Field bezeichnen, es steht ganz in
Camille Pleyels Personalstil. Ich sehe dieses „á la Field“ eher als Hommage an
den Erfinder der Gattung. Harmonisch heben sich die Komponisten deutlich
voneinander ab, was man hört, wenn man die beiden direkt gegenüberstellt, wie
ich es auf der CD gemacht habe. Das Empfindsame, das Süßliche der Intonation
von Field zum Beispiel, das findet sich nicht bei Pleyel. Auch ist Pleyels
Nocturne wesentlich kürzer als die Beiträge von Field.
Über Chopin und seine drei Nocturnes Opus 9 müssen wohl nicht viele
Worte verloren werden, über diese wurde von anderen bereits ausreichend
geschrieben. Oder wollen Sie noch etwas hinzufügen?
Es gibt wirklich nicht viel. Was
aber vielleicht gesagt werden muss, ist, dass diese Werke auf einem
historischen Instrument ganz anders klingen als auf einem modernen. Viele
Zuschauer, die diese Werke gut kennen und sie oftmals auf modernen Instrumenten
gehört haben, sind total überrascht von der Wirkung, die sie auf dem
historischen Flügel erhalten. Allgemein klingen sie etwas nachdenklicher – sie
sollten auch ein bisschen langsamer gespielt werden – und erhalten eine
sensiblere und melancholischere Note; wie sie Werke von Chopin eigentlich immer
haben sollten, was allerdings moderne Flügel uns nicht erlauben, da sie
schneller und stärker sind. Dadurch ergibt sich das Problem der heutigen
Wahrnehmung auf die Romantik und das Virtuosentum. All die Passagen mit den
vielen kleingeschriebenen Noten, die heute in irrem Tempo heruntergespielt
werden, tragen eigentlich so viel Gesang und Feingefühl, sie umarmen den
gesamten tonalen Rahmen. All das kann bei schnellem Tempo unmöglich realisiert
werden. Das alte Instrument erlaubt mir, so etwas aus der Musik herauszuholen.
Was kann sonst noch gesagt
werden? Vielleicht, dass die Widmungsträgerin Marie Moke-Pleyel früher die
Verlobte von Hector Berlioz war. Sie hat ihn dann aber verlassen und Camille
Pleyel geheiratet. Chopin kannte sie sehr gut und widmete die Nocturnes nicht
umsonst ihr: Sie gehörte zu den wirklich bekannten Pianistinnen der damaligen
Zeit.
Wie kamen Sie eigentlich dazu, sich auf historische Instrumente zu
spezialisieren?
Wie so vieles war dies vielleicht
Zufall, vielleicht aber auch nicht. Irgendwie kam ich damals im
Tschaikowski-Konservatorium in Moskau in die Abteilung für historische
Aufführungspraxis, die Alexei Lubimov erst kurz zuvor eröffnet hat; dort wirkte
nicht nur er, sondern auch seine wunderbare Kollegin, Olga Martinova, die
mittlerweile zur Professorin berufen wurde. Ich gehörte damals zu den ersten
Studentinnen dieser Abteilung und begann, mich mit historischer
Aufführungspraxis auseinanderzusetzen. Später habe ich dann verschiedene
Meisterkurse besucht und kam schließlich hier nach München, wo ich bei der
Cembalistin und Hammerklavierspielerin Christine Schornsheim studierte. Sie gab
meinem Spiel noch einmal neuen Schliff. Ich bin sehr dankbar dafür, so tollen
Lehrern und Musikern auf meinem Weg begegnet zu sein.
Die historische Aufführungspraxis
bietet uns einige Schwierigkeiten, so muss ich immer wieder die alten
Instrumente ausfindig machen und zu Konzerten oder Aufnahmen transportieren.
Andererseits ist das aber auch meine große Leidenschaft und ich werde meinen
Weg weiter gehen.
Oft steht die historische Aufführungspraxis massiv in der Kritik.
Konzerte wie Aufnahmen gleichermaßen klingen rein erdacht und nicht mehr
erlebt, wie Museumsstücke, die auf theoretischen Quellen basieren, ohne den
Bezug zum echten Leben zu haben. Sie haben einen anderen Zugang zur Musik und
ich merke beim Hören Ihrer CD, dass Sie in gelebten Kontakt mit den Noten
treten, sie aktualisieren statt bloß dar- oder gar auszustellen.
Ich bin selbst oft sehr
enttäuscht von Konzerten, in welchen die Musiker sich historisch informierten.
Oft werden die Instrumente missverstanden und die Musiker holen nicht das aus
ihnen hervor, was in ihnen steckt. Nicht umsonst haben wir die Vorurteile, alte
Instrumente und besonders das Cembalo seien langweilig oder klingen wie eine
Nähmaschine, mechanisch und ohne Dynamik. Nichts davon stimmt, sofern man das
Instrument gut spielt. Wie bereits erwähnt, bin ich gerade hier meinen Lehrern
dankbar, dass Sie mir die technischen wie musikalischen Geheimnisse gezeigt
haben, die den Unterschied machen: denn man kann diese Musik auch auf andere
Weise spielen, als man sie gewohnt ist. Selbstverständlich hat eine gewisse
Epoche ihre Techniken, die man erlernt, doch innerhalb dieses Rahmens gibt es
noch immer unendlich viele Möglichkeiten, sie stimmig einzusetzen und lebendig
auf die Musik zu übertragen. Wir sollten nicht vergessen: Als Musiker sind wir
Vermittler, und wenn wir diese Rolle gut umsetzen, dann leben auch die
historischen Instrumente und ihre Techniken weiter und verlieren nichts an
ihrer Aussagekraft. Wenn wir die Rolle missverstehen, erklärt es sich von
selbst, dass das Publikum die modernen Instrumente bevorzugt – und das, obwohl
die Musik gar nicht für sie geschrieben wurde. Hätte Chopin einen Steinway
gehabt, klänge seine Musik vermutlich vollkommen anders.
Was halten Sie denn von Aufnahmen auf modernen Flügeln?
Ich beschäftige mich jetzt nicht
intensiv damit, aber erkenne trotzdem sofort, ob sich ein Pianist Gedanken
gemacht hat, für welche Instrumente die Musik geschrieben wurde oder nicht. Er
muss ja nicht gleich Cembalo oder Hammerklavier spielen, aber dennoch bemerkt
man, ob er zumindest ein bisschen Ahnung über sie besitzt – und das ist
wahrscheinlich entscheidender.
Walter Gieseking schrieb einmal, man solle Bach auf modernen Klavieren
spielen, aber immer das Cembalo als Idee im Kopf haben.
Das Cembalo ist dynamisch und im
Bezug auf gewisse Spielweisen eingeschränkt, doch Bachs Musik ist zu einem guten
Teil dafür konzipiert. Insofern sollte der heutige Pianist sich bewusst sein,
welche Möglichkeiten ein Cembalo hat und welche nicht – es müssen Kompromisse
eingegangen werden. Der Musiker muss etwas erzeugen, dass sich mit der Ästhetik
des Cembalos vereinbaren lässt und nicht selbst kreieren. Dann nämlich wäre es
ein Arrangement.
Wir hatten ja bereits gesagt, dass sich zu der Zeit von Pleyel die
Klaviere schnell entwickelten. Was für Unterschiede gibt es denn zwischen den
Instrumenten von 1830 und 1838, die Sie gespielt haben?
Das Instrument des Vaters besitzt
gerade im Diskant etwas Silbriges, allgemein herrscht ein Glanz vor, das
Instrument wirkt leichter. Beim Sohn fehlt diese Brillanz, dafür überragt das
Klavier durch eine sanfte Gedämpftheit; während beim Vater die obere Lage
überwiegt, lässt sich beim Sohn besser mischen, die Mittellage scheint recht
neutral und die Tiefe brummt sonor herauf. Man muss diese Instrumente einmal
gehört haben, um sich der enormen Unterschiede bewusst zu werden, die
letztendlich Ausschlag geben für die Ästhetik der Epoche.
Die großen Konkurrenten von Pleyel war die Klaviermanufaktur Sébastien
Érard. Wo liegen denn die Unterschiede zwischen beiden?
Darüber wurde bereits viel
geschrieben, Rubinstein vermerkte beispielsweise einiges darüber in seiner
Autobiographie „Mein glückliches Leben“. Aus meiner Sicht kann ich sagen, dass
Érard-Flügel wesentlich schwerer sind, Anschlag wie Klang. Die Tasten sehen
ganz anders aus und es entsteht ein „gepuffter“ Klang, er besitzt nicht diese
Brillanz der Pleyel-Klaviere. Diese Brillanz inspirierte auch Chopin, der
sagte, seine Werke könne man nur auf einem Pleyel-Flügel aufführen. Die Seele
seiner Kunst liege eben bei einem Klavier von Pleyel.
Nun sollten wir noch auf einen ganz wichtigen Punkt aufmerksam machen,
und zwar, wie diese CD-Produktion und mit ihr viele anderen um Ignaz Pleyel
ermöglicht werden.
Dieses Projekt und viele weitere
konnten durch die internationale Ignaz-Pleyel-Gesellschaft realisiert werden,
die bereits seit 25 Jahren existiert. Geleitet wird die Gesellschaft durch
Prof. Dr. Adolf Ehrentraud, der nicht nur CD-Produktionen finanziert und
ermöglicht, sondern auch das Museum leitet, dort Führungen macht und Konzerte
veranstaltet. Als Gründervater macht er diese wundervolle Arbeit seit der
ersten Sekunde der IPG an.
Es begann mit einem Museum, das
mittlerweile wirklich schön eingerichtet wurde inklusive Marionetten aus einer
Puppen-Oper, die oben aufgehängt wurden, und vielen Gemälden aus der Zeit. Es
gibt einen herrlichen Pleyel-Flügel aus einem Opus, von dem nur noch sieben
Exemplare enthalten sind. Ein Pianino steht dort ebenso wie Pleyel-Harfen, die
mittlerweile kaum noch jemand spielen kann. Ich kann nur jedem empfehlen, der
in Niederösterreich Nähe Wien ist, das Museum einmal zu besuchen! Seit drei
Jahren entsteht in der Nähe ein Pleyel-Kulturzentrum mit einem Konzertsaal, der
eine ausgesprochen gute Akustik hat. Dort werden auch die Aufnahmen gemacht, in
diesem Saal mit etwa 150 Plätzen, wo auch das Instrument vom Sohn steht.
Professor Ehrentraud hat vieles davon selbst gespendet und auch das Land
Niederösterreich hat geholfen, all das zu errichten. Jetzt im April haben wir
noch ein Benefizkonzert gespielt, damit sich das Kulturzentrum auch weiterhin
entwickeln kann. Aktuell wird an einem Anbau gearbeitet, aber die Konzerte
laufen natürlich weiter; Termine findet man alle auf der Homepage https://www.pleyel.at. Selbst werde ich im
Juni und Juli dort wieder spielen, mindestens drei Mal im Jahr trete ich im
Kulturzentrum auf und freue mich auf weitere Zusammenarbeit mit der IPG.