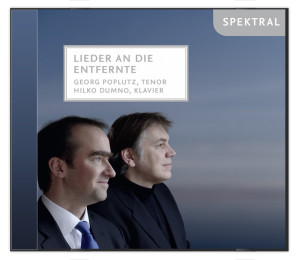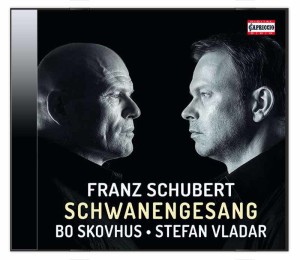Interview mit der Geigerin So Jin Kim zum aktuellen CD-Debut „The Grand Duo“
Die Geigerin So Jin Kim bildet schon lange mit dem Pianisten David Fung eine symbiotische Einheit. Ganz bewusst haben sie sich mit einem CD-Debut viel Zeit gelassen. Im Falle des neuen Tonträgers war alles eine Gefühlsentscheidung. Ungewöhnlich ist das Programm allemal, wo Werke von Richard Strauss, Franz Schubert und des israelischen Gegenwartskomponisten Avnar Dorman einen Spannungsbogen wie keinen anderen bilden.
So Jin Kim, die in Korea geborgen wurde, in den Staaten aufwuchs und heute abwechselnd in New York und Hannover lebt, bekundete im Gespräch, was ihr wichtig ist.
Erzählen Sie mir etwas über die Vorgeschichte dieser Produktion. Was war die Grundidee für diese Stücke-Abfolge?
Dieses Programm wird durch die Sonate von Richard Strauss zusammengehalten und das hat seine besondere Vorgeschichte. Als ich nach Deutschland kam, habe ich mit hiesigen Orchestern, unter anderem dem der Bayerischen Staatsoper musiziert. Ich war wirklich sehr beeindruckt von dieser Tradition und diesem Klang – vor allem, was die Blechbläser hier können. Und dann haben mich Strauss und Wagner sehr berührt. Ich bin seitdem regelrecht infiziert von der Orchestermusik von Richard Strauss. Deshalb musste eine Sonate von ihm auf die neue CD kommen. Die Violinsonate E-Dur, Opus 18 ist die letzte von Strauss in klassischer Form durchkomponierte Sonate, und sie hat riesige Parts sowohl für Klavier und Violine. Dieses Stück gibt der CD das Fundament. Schuberts A-Dur-Sonate, die auch den Untertitel „Grand Duo“ trägt, passte hierzu, obwohl dieses Stück einen großen Kontrast zu Strauss markiert. Aber dann sollte auch noch ein zeitgenössisches Stück wie ein Bindeglied funktionieren. Hier bot sich Avner Dormans zweite Sonate aus dem Jahr 2008 an. Ich kenne Avner Dorman und seine Kompositionen seit vielen Jahren und wir haben zusammen an der Juillard School studiert. Ich habe Avner dann nach Empfehlungen gefragt. Und von denen gefiel mir diese zweite Sonate am besten.
Auf das spätromantische Stück folgt Dormans zeitgenössische Komposition, bevor Schubert das Finale bildet. Wie kam es zu diesem etwas ungewöhnlichen, weil un-chronologischen Spannungsbogen?
Es hat sich so ergeben. Ich habe sehr lange mit mir über die Reihenfolge gerungen. Ich wollte die CD nicht mit dem modernen Stück beginnen, aber auch nicht beenden. Strauss und das moderne Stück enden beide mit einem exaltierten, fast wilden Part. Dormans Sonate beginnt mit einem sehr spirituell getragenen Teil, der fast wie ein Gebet wirkt. Da sehe ich eine Gemeinsamkeit, weswegen sie hier aufeinander folgen. Schuberts Sonate bekam dadurch zwangsläufig die Rolle eines Finales. Sie markiert ohnehin eine andere Welt für sich. Wer bei Schubert tief zuhört, der vergisst alles, was vorher zu hören war. Gerade dieser Aspekt hat zur Entscheidung für diese Abfolge geführt.
Haben Sie ein besonderes Klangideal?
Musik kann nicht existieren ohne Klang. Wenn ich mich in ein Stück hinein vertiefe, versuche ich, eine ganz spezifische Atmosphäre zu erzeugen. Die kluge Gestaltung des Klanges lässt im Idealfall jene Welt erstehen, die der Komponist im Sinn hatte. Deswegen ist nur eine Spieltechnik wirklich großartig, wenn man sie nicht mehr als solche wahrnimmt. Erst sobald man nicht mehr bewusst drauf achtet, wie schnell die Finger sich bewegen, wirkt die Musik auf einer tieferen Ebene. Das ist meine Intention, wenn ich den perfekten Klang für eine Komposition suche. Und daraus schließlich Bilder, Gedanken, Emotionen hervor gehen…
Ich frage nicht zuletzt deshalb, weil Sie Ihr Instrument in Avner Dormans Sonate so ganz anders, als bei Schubert und Strauss klingen lassen. Was wollten Sie zum Ausdruck bringen?
Dormans zwei Stücke kombinieren einen Ruhezustand mit einem exaltierten, intensiven Part, bei dem Leidenschaft auch etwas mit Leiden zu tun hat. Der erste Satz ist wie ein Gebet. Der zweite umso mehr ein Ausbruch, der spieltechnisch und auch rhythmisch ins Extreme geht. Da entsteht ein rauher Klang, den man bloß nicht wieder glätten sollte. Es geht darum, mutig und extrovertiert zu sein. Hier lebt ein ganz starkes Bewusstsein für Energien.
Dormans Stück überwindet mit ausgeprägten modalen Parts ja auch die Vorherrschaft von Dur und Moll, die für Schubert und Strauss ja noch relativ verbindlich ist. Außerdem gibt es viele Fugato-Parts. Welche Funktion haben solche Kontraste in diesem Programm?
Ich mag sehr an Avners Dormans Kompositionsstil, dass er sehr zeitgenössisch ist, sich trotzdem auch sehr traditioneller Verfahren bedient. Die sogar älter als bei Schubert und Strauss sind.
Öffnet Avner Dormans Sonate hier ein Fenster?
Auf jeden Fall. Das macht er sehr mutig und direkt, während es bei Strauss und Schubert viel vorsichtiger passiert.
Strauss hat seine Sonate im Zuge einer großen Verliebtheit in seine spätere Frau komponiert. Dorman legt seiner Sonate zwei Liebesgedichte zu Grunde. Gibt es bei Schuberts „Grand Duo“ ähnliche Bezüge?
Bei Strauss und Dorman sind solche Hintergründe sicher aufschlussreich. Schuberts Musik ist in meinem Empfinden aber so selbsterklärend, dass sich jede Diskussion über programmatische Hintergründe erübrigt. Seine Tonsprache hat eine so starke lyrische Dichte, dass ohnehin alles in jedem Moment „lovely“ ist.
Sie haben in den letzten Jahren eine beeindruckende Karriere voran getrieben. Hätten Sie ein solches Programm bereits in einem früheren Stadium erarbeiten und vor allem aufnehmen können bzw. wollen?
Es war gut, sich für das CD-Debut Zeit bis heute zu lassen. Ein Aufnahme zu machen ist eine sehr verantwortungsvolle und endgültige Sache. Es wird etwas produziert, das ewig ist. Als Musikerin lebe ich in einem Zustand ständigen Wandelns und Weiterentwicklung. Selbst während eines Aufnahmeprozesses ändert sich die Wahrnehmung ständig. Da ist es ein sehr gewichtiger Schritt, etwas in die Welt auszusenden, was nicht mehr veränderbar ist.
Wie lange arbeiten Sie schon mit Ihrem Pianisten David Fung zusammen?
David und ich sind schon lange freundschaftlich und künstlerisch miteinander verbunden. Daher war es in jedem Moment klar, dass wir uns für ein Programm entscheiden, das einen fantastischen Pianisten braucht, der hier sein ganzes Können entfaltet. Auch David mag dieses Programm sehr.
Sie hatten eingangs schon über Ihre Erfahrungen mit Orchestern geredet. Sie treten ja nicht nur als Solistin vor Orchestern auf, sondern sitzen auch selbst am Pult, zum Teil als Konzertmeisterin. Welche Erfahrungen wirken daraus auf das solistische Spiel?
Eigentlich spielt es keine Rolle, in welchem Medium jemand musiziert – wenn es doch um die Musik an sich geht. Musizieren ist einfach Musizieren. Orchesterpraxis vermittelt aber die Einsicht, dass jeder Musiker immer ein Part innerhalb eines großen Ganzen ist – so wie ein Detail in einem großen Bild. Jeder alleine kann das Stück Musik nicht erschaffen. Diese Erkenntnis bereichert auch das Solistendasein immens, vor allem das Verständnis über die eigene Rolle.
Sie leben in Europa, Amerika und sind auch in Ihrer ursprünglichen Heimat Asien viel gefragt. Welche Unterschiede erleben Sie?
Es ist in jedem einzelnen Land unterschiedlich. Das trifft schon für Europa zu. Vor allem in Deutschland fühle ich eine tiefe Verwurzelung der klassischen Musik in der eigenen Kultur. Die hohe Kenntnis des deutschen Publikums ist in jedem Moment spürbar. Wenn in deutschen Konzerten das Publikum wirklich überwältigt ist und dies auch zeigt, bedeutet dies sehr viel. Das ist ein Statement mit Gewicht. In Amerika ist immer ein hoher Level an Enthusiasmus da. Amerikaner trauen sich gerne, richtig aus dem Häuschen zu sein, was hier fast schon Normalzustand ist. Auch das ist immer eine schöne Erfahrung. Und in Asien, vor allem in Korea ist vieles in einer Entwicklung begriffen, die Hoffnung weckt: Das Interesse an klassischer Musik wächst seit Jahren unaufhörlich.
[Interview geführt von Stefan Pieper, 2018]
CD:
The Grand Duo: So Jin Kim (Violine), David Fung (Piano)
Konzert-Tipp:
So Jin Kim und David Fung gastieren am 12. Juni im Pianosalon Christophori Berlin