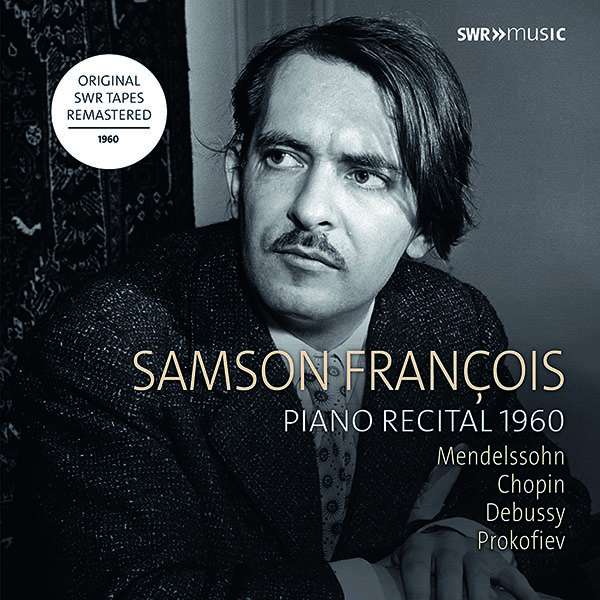Orfeo, C 763 093 D; EAN: 4 011790 763323

Das Stuttgarter Kammerorchester unter Michael Hofstetter nimmt alle dreizehn Kammersymphonien von Felix Mendelssohn auf drei CDs auf. Die Box erschien bei Orfeo.
Die Streichersymphonien von Felix Mendelssohn sind weit mehr als bloße Studienwerke oder Kompositionsübungen, es ist von der allerersten an eigenständige und auf ihre Art abgeschlossene Konzertliteratur von handwerklicher Beherrschung und geistiger Inspiration, wie sie viele Kollegen seiner wie unserer Zeit selbst in ihrer Reifephase nicht erreichen. Gedacht waren sie für die Aufführung im häuslichen Bereich, heute sollten sie jedoch auch öffentlich erklingen.
Eine strenge Ausbildung prägte die Kindheit Felix Mendelssohns, der ab seinem sechsten Lebensjahr in Deutsch und Französisch, Mathematik, Kunst und Musik ausgebildet wurde, ein Jahr später (1816) Violin- und Klavierunterricht erhielt. Ab 1818 erhielten Felix und seine Schwester Fanny Privatunterricht in mehreren Fächern. Die Kinder mussten in allen Bereichen hohe Bildung vorweisen können, wurden stets zum Lernen angehalten. Die musikalische Ausbildung legten die Eltern in die Hände von Carl Friedrich Zelter (1758-1832), selbst Autodidakt und hauptberuflicher Maurermeister, der jedoch durch intensive Forschung an alter Musik technische Meisterschaft entwickelte und in hohen Kreisen, vor allem mit Johann Wolfgang von Goethe, verkehrte, was ihm gesellschaftliche Prominenz sicherte. Die Meinungen über Zelter gehen weit auseinander: Als wichtigster musikalischer Bezugspunkt für Felix Mendelssohn nimmt er auf jeden Fall eine Vorrangstellung bezüglich dessen musikalischer Entwicklung ein, auch wenn das Genie des Jungen sich wohl auch „von selbst“ (?) entwickelt haben würde. Die Streichersymphonien entstanden unter seiner Aufsicht und zumindest die frühen spiegeln die Haupteinflusspunkte Zelters (CPE Bach, Händel etc.) deutlich wider.
Der Überschaulichkeit halber ordne ich die Symphonien in drei Gruppen ein, die allerdings nur gedachten Kategorien entsprechen und der organischen Entwicklung einer jeden einzelnen im Kontext nicht im Wege stehen sollten. Die erste Gruppe umfasst die ersten sechs Streichersymphonien, die alle 1821 komponiert wurden und in konsequenter Dreisätzigkeit schnell – langsam – schnell konzipiert wurden. In der Entwicklung dieser sechs Symphonien kann manch eine Gemeinsamkeit zu derjenigen der ersten sechs Klaviersonaten von Mozart gesehen werden (Mozart zählte neunzehn Jahre, als er diese Sonaten komponierte, Mendelssohn schrieb die ersten Streichersymphonien zwölfjährig). Im Umfang sind die sechs 1821 komponierten Symphonien noch recht gering, dafür dicht in der musikalischen Textur. Von der ersten Symphonie an zeigt sich fundiertes technisches Können besonders auf kontrapunktischer Ebene: Insgesamt neigt Mendelssohn noch dazu, seinen Satz zu überfrachten. Allein von der ersten zur dritten Symphonie zeigt sich eine beachtliche klangliche Verfeinerung, die sein unaufhaltsames Streben wie sein eigenes Reflektieren versinnbildlicht. Jedes einzelne Werk experimentiert mit neuen Elementen und Charakteristika. In der vierten Symphonie probiert er eine langsame Einleitung aus (was er ab der Achten dann zum Standard macht) und lässt im Andantesatz erstmalig Elemente seiner späteren, romantischeren Tonsprache durchschimmern. Mendelssohn begann allmählich, seinen Satz aufzuklären, was in der Sechsten schließlich zu klanglichen Erfolgen führte. In dieser entdeckte er zudem das Menuett als Zwischensatz für sich, was die Tore öffnete für viersätzig konzipierte Formen.
In eine zweite Gruppe ordne ich die Symphonien 7-9, diese bestehen nun je aus vier Sätzen, wobei zu der bisherigen Form an dritter Stelle je ein Menuett oder im Falle der 9. Symphonie ein Scherzo hinzutritt. Im Gegensatz zu dem Menuett der Sechsten, das als alleiniger Mittelsatz größeren Umfang benötigt und so zwei Trios besitzt, haben die der Symphonien aus der zweiten Gruppe je nur ein Trio. Zudem wachsen die Symphonien in ihrer Gesamtlänge deutlich an, verdoppeln bis verdreifachen ihre Spieldauer. Die gesamte Konzeption wirkt nun symphonischer, es gibt deutlichere Kontraste und nachvollziehbarere Wechselspiele zwischen den Stimmen: Mendelssohn operiert sparsamer mit seinen Mitteln, verteilt sie ökonomischer. Allgemein verfeinert sich sein Gespür für Klang; dies führt unter anderem dazu, dass er beginnt, die Stimmen aufzufächern, um den Gesamtklang weiter auszudifferenzieren. In der siebten Symphonie begnügt er sich damit, lediglich Celli und Bass eigenständiger zu führen. Ab der Achten experimentiert er mehr: Im Adagiosatz kommen nur Bratschen und tiefe Streicher zum Einsatz, die Bratschen jedoch unterteilt er in drei Sektionen. In der Neunten knüpft er hieran an und teilt die Bratschen in zwei Sektionen, im Andante gibt es zudem insgesamt vier Violinstimmen. Die Zweiteilung der Bratschen etablierte sich von nun an als Standard für ihn.
Da von der zehnten wie der dreizehnten Symphonie je nur ein Kopfsatz überliefert ist, können diese formal nicht eingeordnet werden. Eine dritte Gruppe bilden daher lediglich die elfte und zwölfte Symphonie, welche ich als experimentale Symphonien bezeichnen würde: Mendelssohn geht vollends an oder gar über die Grenzen des Genres, experimentiert mit neuen Formmodellen und Ideen; er ist bereit für das volle Orchester. Mit fünf Sätzen und einer Spieldauer von 40 Minuten erreicht die Elfte ganz neue Dimensionen – im Scherzo nimmt der Komponist zudem Schlagwerk (Pauken, Triangel und Becken) hinzu, schreit also förmlich nach dem Symphonieorchester. Er bleibt dabei, die Bratschen in zwei Teile zu separieren, was die Mittellage facettenreicher ausgestaltet. Die Faktur wird noch luzider und er behandelt seine Mittel noch sparsamer bis hin zur Einstimmigkeit, wodurch er ein größeres Spektrum an Klangfarben erhält. Die Besonderheit der g-Moll-Symphonie Nr. 12 liegt vor allem im Kopfsatz, welcher nach einer langsamen Einleitung in einer großen Fuge zwei Themen durchführt. Hier kehrt Mendelssohn wieder zur dreisätzigen Form zurück, wobei das Finale die Hälfte der Länge ausmacht.
Das Stuttgarter Kammerorchester liefert eine formidable Gesamteinspielung dieser insgesamt dreizehn Streichersymphonien ab, die besonders durch ihren luftig-leichten Klang begeistert. Dirigent Michael Hofstetter verzichtet auf große Geste, sondern hält die Musik schlicht und geradlinig. Er verfolgt die Entwicklung musikalisch mit und passt sein Orchester den Gegebenheiten der Musik an – vor allem behalten die Symphonien dadurch die ausgelassene Jugendlichkeit, die sie charakterisiert, trotz der grandiosen handwerklichen Leistung. Überschwänglich lebendig präsentiert Hofstetter die frühen Symphonien, verleiht den späteren dann mehr Kontrast, differenziert deutlicher aus und gibt ihnen allgemein gewisse Reflexion ganz im Sinne des reifenden Mendelssohn. Ich bewundere den heute selten anzutreffenden Mut, einige der Wiederholungen auszusparen, die in den Noten vermerkt sind: Wenn sich die Musik zu weit vom Ausgangspunkt entfernt hat, macht die Rückkehr ebendorthin oft keinen Sinn mehr, was auf Kosten der Formverständlichkeit geht. Gerade in den umfangreicheren, späteren Werken hätte ich sogar auf noch ein paar mehr Wiederholungen verzichtet. Die Tempi übersteigert das Orchester teils, so dass die Allegri vor allem der früheren Symphonien zu rasch davoneilen und fast durchgehend Alla Breve-Stimmung evozieren, während die Andante-Sätze schleppen: Hier wäre Mut zu subtileren Kontrasten wünschenswert, sich auf die Gratwanderung einzulassen, die Tempi zu relativieren, ohne dass dabei die Gegensätze verschwimmen oder die Musik in den Randsätzen stockt. Technisch bewundernswert gelingen die Unisonostellen, die brillant aufeinander abgestimmt erklingen, sowie die mehrfach separierten Stimmen, wo die Stimmgruppen auch ihr Miteinander im Gegeneinander beweisen.
[Oliver Fraenzke, November 2020]