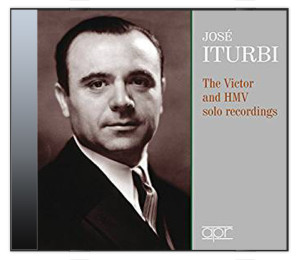Romain Nosbaum im Gespräch über seine neue CD „Saudades“
Zeit zu haben ist für den luxemburgischen Pianisten Romain
Nosbaum die wichtigste Ressource, um künstlerisch aufzutanken, sich in neue
Projekte hinein zu versenken, die Essenz reifen zu lassen. Die Idee für seine
aktuelle CD kam ihm im letzten Jahr, als die kalte, dunkle Jahreszeit herauf
zog. Spanien und Südamerika standen als aktuelles musikalisches Reiseziel auf
der Agenda. Das Programm beginnt mit einer sehnsuchtsvollen Fantasiereise aus
Enrique Granados „Goyescas“, in denen Francisco de Goyas tiefgründige Bilder
ihren Widerhall finden. Darauf folgen Musikstücke von spanischen und
brasilianischen Komponisten. Sie verdichten einen Zustand, für den es in der
portugiesischen Sprache das Wort „saudades“ gibt. Das ist ein sehr universelles
Wort, es steht für Fernweh, Sehnsucht, Liebe, Freude, Trauer. Vielleicht alles
zugleich. In unserer nordisch-westlichen, rationalisierten Welt gibt es dieses
Wort nicht – wen wundert es!?
Das Interview führte Stefan Pieper
Was war die Initialzündung zu diesem spanisch-südamerikanischen
Projekt?
Die kam eher zufällig etwa vor einem Jahr.
Draußen war es kalt und ich hörte solche Musik. Ich spürte, so etwas will ich
jetzt selber machen. Da fließen viele persönliche Erlebnisse mit ein. Ich war
ja selbst viel im Süden, vor allem in Brasilien und habe dort viel Zeit in
kleinen Läden mit Livemusik verbracht und war immer fasziniert. Da gibt es so
viel Musik, die hier niemand kennt. Also nahm ich mir Zeit, dies näher zu
erforschen. Hinzu kommt, dass ich lange mit einer Person zusammen war, die aus
Brasilien kommt. Das alles hat mich schon stark geprägt. Ich bin viel gereist,
war vor allem an der Küste unterwegs. Man kann dort so viel unmittelbare
Emotion spüren. Das ist alles ohne Filter dort und kommt wirklich von Herzen!
Die Mentalität ist sehr direkt und die Menschen überlegen nicht dreimal, bevor
sie etwas sagen.
Gibt es einen Unterschied zwischen den großen Städten und dem
kulturellen Leben auf dem Land?
Ich war ja viel in den Küstenregionen. Das
Leben ist dort schon anders als in den Städten. Die echte, authentische Musik
kommt vor allem von dort her, was ich gerade in den vielen Cafés immer neu
erlebt habe. Es ist so faszinierend – diese Stimmen, dieses Rhythmusgefühl!
Die Kompositionen auf der CD sind natürlich in erster Linie
raffinierte Kunstmusik. Wie widerspiegelt sich in der Dramaturgie die populäre
Musik?
Das Programm ist so aufgebaut, dass es mit
den „klassischsten“ Werken beginnt. Die beiden Stücke von Enrique Granados zum
Beispiel sind noch sehr „klassisch“ geschrieben mit viel Polyphonie. Nach und
nach geht es aber in immer populärere Richtungen, nachher dann etwa mit Ernesto
Lecuonas Danzas Cubanas, dann zum Schluss Marlos Nobres Stück „Frevo“. Sehr
populär ist auch Luisa Sobras „Amarpelos dois“.
Man kann schon sagen, dass die südeuropäische Musik schon viel
klassischer verwurzelt ist, als etwas die cubanischen Stücke.
Wie sind Sie auf die Stücke gestoßen?
Ich habe einige meiner besten
Musikerfreunde kontaktiert – vor allem einen in Brasilien. Der kennt viele
Werke und hat mir Vorschlüge gemacht. Es gibt schon viele tolle Sachen für
Klavier. Nicht alles ist unbedingt sehr pianistisch, aber es klingt immer gut.
Es lohnt sich außerordentlich, vor Ort die Bibliotheken zu durchstöbern. Es
gibt mittlerweile auch gute online-Dokumentationen.
Aber es finden sich ja auch viele moderne Farben in den Stücken.
Das stimmt. Es ist alles sehr unmittelbar
aufeinander bezogen und berührt sich. Das merkt man vor allem bei der Sonatina
von Carlos Guastavino. Da klingt so manches typisch romantisch, fast
französisch, so dass es von Debussy oder Ravel sein könnte mit Rhythmen, die
südländisch wirken. Guastavino ist hier sicherlich von Debussy und Ravel
inspiriert worden.
Umgekehrt hat sich Debussy ja auch mächtig bei solchen
Einflüssen bedient!
Natürlich. Die Habanera ist ja so ein
typisches Beispiel.
War es Ihnen wichtig, diese enge Verbindung zwischen
Musikstilen, Kulturen und auch Emotionen darzustellen?
Auf jeden Fall. Deswegen kam ich ja auch
auf das portugiesische Wort „Saudades“. Dieses Wort fasst so vieles zusammen.
Es liegt so viel unendliches darin: Melancholie, Sehnsucht, Liebe.
Hatten Sie als erstes dieses Wort im Sinn und haben daraufhin
erst die Musik ausgesucht oder stand „Saudades“ hinterher als Fazit im Raum?
Eher ist letzteres der Fall. Ich hatte erst
Musik im Sinn, die ich gerne spielen wollte. Am Anfang standen die Goyescas von
Enrique Grandados. Alles weitere hat sich daraus ergeben. Schnell wurde eine
große Einheit daraus – und die hat viel mit Seele zu tun. Das Wort „Saudades“
ergab sich dann als verbindende Assoziation, als großer gemeinsamer Nenner. Ich
habe das dann einfach so stehen gelassen, weil es passte.
Es ist doch bezeichnend, dass es dieses Wort in keinen
Übersetzungen gibt. Was ist an diesem Wort spezifisch für die
portugiesisch/brasilianische Kultur?
Das Wort ist sehr undefinierbar, sogar in
der Sprache selbst. Es heißt alles mögliche: Das Verlangen nach einer Person
oder die Sehnsucht nach einem Land, Fernweh also. Das alles kommt in jedem
Stück vor. Ebenso liegen Melancholie und Tristesse und andererseits auch Freude
stark beieinander.
In unserer westeuropäischen Mentalität ist ja alles rationaler
und schablonenhafter. Alles hat seine Schublade, es gibt ein ausgeprägtes
entweder/oder. Was für eine andere Mentalität haben Sie in Südamerika
entdeckt?
Vor allem dieser Wechsel und diese
Gleichzeitigkeit von Gefühlen: Man kommt ganz schnell von einem Sentiment ins
andere. Jemand ärgert sich drei Minuten lang aufs heftigste und ist danach
wieder weg. Genauso verhält es sich auch in dieser Musik.
Was war Ihnen beim Spiel besonders wichtig, um diese Gemengelage
abzubilden?
Es geht vor allem darum, die ideale Balance
zu finden. Es ist wichtig, diese Stücke bloß nicht zu süßlich überzuckert zu
spielen.
Würden Sie sagen, einige Stücke füllen diskografische Lücken?
So direkt neu weiß ich nicht. Ich höre auch
gar nicht so viele andere Interpretationen vorher, weil ich gerne eine eigene
Idee selber verwirkliche. Einige Stücke sind noch nie aufgenommen worden.
Wiederum andere sind natürlich sehr bekannt – das berühmteste dürfte wohl
Asturias von Isaac Albeniz sein.
Sie arbeiten hier ja einen echt perkussiven Gestus heraus. Wie
haben Sie diese Technik entwickelt?
Ursprünglich ist dieses Stück ja für
Gitarre geschrieben. Hier wird immer eine Note repetiert und alterniert. Als
Gitarrist kann man hier nicht viel falsch machen, wenn man die Saiten zupft. Es
war fast eine Art Obsession, einen vergleichbaren Effekt aus dem Klavier heraus
zu kitzeln. Es bot sich hier an, auch mal eine Prise Scarlatti einzubringen. Es
sollte wie ein Perpetuum mobile sein und im guten Sinne „auf den Wecker gehen“.
Möchten Sie neben dem persönlichen Erfahrungsgewinn auch dem
Publikum etwas Neues vermitteln?
Auf jeden Fall! Ich freue mich, dass es im
deutschsprachigen Raum noch so vieles vermitteln gibt. Im französischen Raum,
der mir als Luxemburger natürlich auch sehr nah ist, gibt es einen größeren
Bezug zum Spanischen. Aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel Wiener
üblicherweise Konzerte mit solchem Repertoire erleben und auch in Luxemburg
betrete ich mit diesem Repertoire immer noch Neuland. Ich habe es kürzlich in
der Philharmonie aufgeführt und dass war eine ganz neue, starke Erfahrung für
mich: Ich war wirklich erstaunt, allein, weil ich ganz viele neue Menschen hier
im Publikum gesehen habe – weit jenseits vom „normalen“ gediegenen
luxemburgischen Bildungsbürgertum. Plötzlich waren ganz viele Portugiesen und
auch Kapverdianer im Publikum.
Gibt es einen kulturellen Patriotismus, der in die Konzertsäle
lockt? Erlebnisse mit brasilianischen Musikern, die auch in Deutschland ihr
„eigenes“ Publikum haben, bestärken diesen Eindruck. Wenn berühmte Musiker aus
der heimischen Kultur spielen, scheint sich dies wie ein Lauffeuer
herumzusprechen.
Ich weiß, was Sie meinen. Es gibt diese Legenden,
etwa Caetano Veloso oder Mariza. Einen solchen Effekt spüre ich auch, wenn ich
brasilianische Musik aufführe. Ich habe mit vielen Brasilianern nach dem
Konzert gesprochen, die waren unglaublich glücklich und dankbar, dass sie „mal
für eine Stunde zuhause“ waren, wie mir gesagt wurde. Die Leute fühlen sich
geehrt, dass man in einem kalten Land weit weg deren eigene Musik spielt. So
eine Rückmeldung gibt mir eine ganz neue Energie, die ich bei Klassikprogrammen
zuweilen vermisse. Ich wusste, da sitzen Leute, die haben eine riesige Lust,
das zu hören. Das war wirkte unmittelbarer als beim normalen kritischen
Konzertpublikum, das meist auf die Interpretation eines bekannten Werkes
achtet. Mein neues Programm steht für einen sehr unmittelbaren Zugang, wo die
Musik ohne Umwege zu den Menschen kommt. Der Abend in der Luxemburger
Philharmonie war ein echtes Erweckungserlebnis. Viele Menschen, die noch nie in
der Philharmonie waren, hatten neue Erlebnisse und Vorurteile abgebaut.
Fühlen Sie sich wie auf einer Mission bei so etwas?
Ich mache vor allem, was ich gerne mache.
Ich kann nicht etwas machen, bei dem ich mich nicht wohlfühle. Es muss eine
richtige Idee dahinter sein.Wenn ich südamerikanische Musik aufnehme, ist das
integrale, übergreifende Programm sehr wichtig. Die große Idee geht über das
einzelne einstudierte Werk weit hinaus. Deswegen habe ich auf Konzerten auch
schon mal alles in einem Durchgang ohne Pausen gespielt. Denn, wenn ein Konzert
zu viel in Zwischenapplaus zerfällt, geht viel von der Magie verloren, die
möglich wäre.
Was machen Sie anders als viele Ihrer Kollegen?
Viele junge Musiker von heute lassen sich
nur auf Leistung trimmen- das hat mich noch nie interessiert. Ich hatte einst
gar nicht so sehr die große Karriere im Visier, sondern habe Klavier studiert,
um zu unterrichten. Wettbewerbe haben mich auch nicht interessiert. Aber ich
bekam immer mehr Lust am Spielen. Der Wunsch, aufzutreten, nahm langsam, aber
sicher Gestalt an. Alles passierte ohne jeden Druck. Vielleicht ist dies meine
tiefe Weisheit. Vor allem möchte ich etwas mit Menschen teilen. Es geht doch
nicht ums eitle Imponieren, stattdessen birgt Musik doch die große Chance, eine
Gemeinsamkeit mit anderen zu Menschen finden. Musik soll doch ehrlich sein und
Wahrheit, aber auch Schönheit transportieren.
Ich höre bei allem heraus, dass Sie sehr gern der Sache auf den
Grund gehen. Wie hat sich diese Haltung bei Ihnen entwickelt?
Ich brauche relativ lange, bis ich Sachen
fühle. Dass ich den Weg finde und erkenne, was ich machen will. Was ich hier
auf der CD vorliege ist im Vergleich etwa zu Mozart oder Bach eine sehr freie,
imaginative Musik. Es ist wichtig, hier erst mal mit allen Sinnen hinein zu
finden. Viele andere Pianisten sind oft sehr ungeduldig oft. Ich will mir aber
möglichst viel Zeit nehmen, um die die Stücke ausgiebig zu lernen. Das
beinhaltet auch, dass ich aus Prinzip immer auswendig spiele. Ich bin ein sehr
intuitiver Mensch. Aber ich bin auch sehr rational in meinen Gefühlen. Ich
lasse es gehen, aber ich weiß auch, wie ich es gehen lasse. Und dabei eine Idee
finde, das große Ganze wieder zu bündeln. Also die Affekte in einer Musik zu
bündeln wie die Gefühle in diesem Wort. Musik ohne Spannung lebt nicht.
Sind die Lebensbedingungen für Musiker in Luxemburg besser?
Wir sind schon unter einem gewissen Druck,
kenne ein paar Musiker. Aber Kulturschaffende bekommen viel finanzielle
Unterstützung. Das ist absolut genial bei uns. Da haben wir haben ein
Riesenglück. Trotzdem haben wir starke Konkurrenz, vor allem, weil hier alles
so lokal ist. Aber ich halte mich auch manchmal fern davon, das hilft mir,
meinen eigenen Weg zu machen. Trotz aller Gelassenheit bin ich auch sehr
diszipliniert und verlange viel von mir. Manchmal brauche ich auch Distanz, um
die Musik immer aufs neue frisch anzugehen. Das beinhaltet auch Alltagsrituale:
Abends mache ich den Klavierdeckel zu und höre dann sehr gerne Jazz.