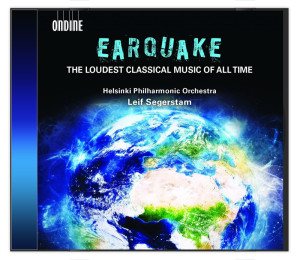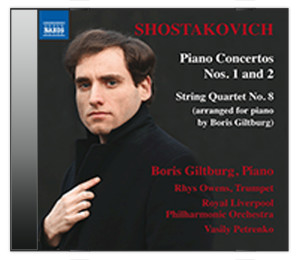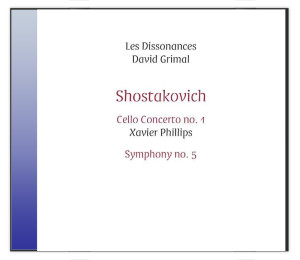Zwei Mal jährlich nimmt das Bruckner Akademie Orchester unter Leitung seines Chefdirigenten Jordi Mora mit einem neuen Programm die Münchner Bühnen im Sturm. Dieses Mal gibt es die d-Moll-Symphonie Bruckners, die „Nullte“, sowie die Sechste Symphonie Dmitri Schostakowitschs. Am 23. April 2017 spielte das Orchester im Kubitz Unterhaching und heute, einen Tag später, im Münchner Herkulessaal der Residenz.
Schon längere Zeit berichtete ich nicht mehr aus den großen Sälen Münchens. Grund war nicht mangelndes Angebot an Konzerten und namhaften Orchestern, sondern dass nichts wirklich bemerkenswert aus der klingenden Masse herausgestochen ist. Technische Perfektion und roboterhafte Makellosigkeit sind an der Tagesordnung, viel zu oft allerdings auf Kosten des tatsächlichen Erspürens der Musik, auf Kosten von Inspiration und Einmaligkeit der Aufführung. Ein ganz anderes Bild erwartet den Hörer am heutigen Abend des 24. April 2017 im Herkulessaal beim Auftritt Jordi Moras mit seinem Bruckner Akademie Orchester. Das Orchester ist ein bunter Flickenteppich bestehend aus professionellen Musikern, ambitionierten Laien und musikalischen Nebenberuflern sowie einigen jungen Talenten. Was sie verbindet, ist ihre Liebe zur Musik sowie der Anspruch, das Maximum aus den Tönen herauszuholen. Auf erstaunlich hohem technischen Niveau findet die Arbeit musikalisch statt, und so sticht dieses Orchester hervor.
Das Programm enthält keinen wirklichen Publikumsmagneten, und Werbung gab es keine bis wenig, also blieb der Herkulessaal kaum halb besetzt. Viele potentiell Interessierte ließen sich diese Gelegenheit entgehen (zumal bei 35 € für die beste Kategorie, einem für diesen Saal minimalen Kostenaufwand), Musik auf außergewöhnlich großartigem Niveau zu hören.
Die „Nullte“ Symphonie Bruckners ist nicht etwa vor der Ersten komponiert, sondern danach und wurde vom Komponisten als ungültig, „annulirt“, abgehakt, erhielt folglich ihren Beinamen. Dabei ist das etwa 40-minütige Werk durch und durch echter, kerniger, feinsinniger Bruckner, enthält herrliche Steigerungen und ist durchgehende stringent aufgebaut, mit einem großen Zug voll magischer Momente. Jordi Mora hält die Form energetisch zusammen und beweist im gemeinschaftlichen Tun durchweg den Überblick über das Gesamte. Jeder Einsatz hat seine unverrückbare, unersetzliche Funktion im orchestralen Geflecht, keine Themenwiederholung wird mechanisch gleichartig aufgefasst, alles erhält kontextbezogen einzigartige Wertigkeit, unwiderstehliche Intensivierung und innerlich nachklingende Wirkung. Der weit ausgreifende Kopfsatz gelingt kristallklar und zutiefst ergreifend, der langsame Satz verzaubert in unerhörter Zartheit, und das mit durchaus dämonischen Zügen durchsetzte Scherzo treibt aus der Tiefe glühend voran. Manche Momente im Finale gemahnen überraschend ein wenig an die Mannheimer Schule, angereichert durch beinahe Mendelssohn’sche Klangwelten, von Mora besonders farbenprächtig hervorgehoben.
Ein formal gewagtes Experiment stellt die Sechste Symphonie Schostakowitschs dar, hauptsächlich aus dem weit ausgedehnten Largo-Hauptsatz bestehend. An diesen schließt ein Allegro an, und die Symphonie endet mit einem übermütig turbulenten Presto, die beiden letzten Sätze sind dabei zusammen kürzer als der erste. Somit ist die gesamte Symphonie ein auskomponiertes Beschleunigen, aus dem inneren Leiden hin zu rasendem Tollen, immer wilder und ungezügelter werdend. Der erste Satz wird unter Mora äußerst getragen und tiefschürfend dargeboten und fließt doch beständig und unaufhaltsam durch all die harmonischen Schrägheiten, die vom Orchester deutlich hervorgeholt und in ihren mannigfachen Bezügen erfühlt werden. Die schnellen Sätze reißen mit Witz und Charme mit, verleugnen auch nicht unterhaltungsmusikalische Elemente, die dennoch den unbedingten Ernst und die irrationale Doppelbödigkeit Schostakowitschs überall durchklingen lassen. Hier können die Musiker auch technisch ihr Können auf die Probe stellen, die Solisten, Stimmführer und besonders der grandiose Konzertmeister leisten Phantastisches. Und die Technik degeneriert nicht für eine Sekunde zum Selbstzweck, alles geschieht immer im Dienst der Musik und der dynamischen Formwerdung.
Jordi Mora ist das absolute Gegenteil eines Selbstdarstellers, er gibt wenig auf äußere Ästhetik seiner Bewegungen oder showbetonte Eleganz. Seine Bewegungen werden vom Körperinneren geführt, wie im Tai Chi sind die Arme lediglich die Vermittler einer mittig fokussierten Kraft, die in ihrer Zentrierung meditative Ruhe und kraftvolle Flexibilität ausströmt, was sich unmittelbar auf die Musiker überträgt. Diese folgen jedem Wink ihres Dirigenten, sind ein brillant eingespieltes Team und haben sichtlich Freude am Musizieren. Freude haben auch die Hörer angesichts solch eines überragenden Konzerts, das mit geradezu frenetischem Applaus endet. In einem Jahr, also wieder in der Woche nach Ostern, werden wir wohl die Neunte Symphonie Gustav Mahlers von diesen Musikern hören dürfen, und vielleicht versteht man es ja dann auch, vorher ein bisschen effizienter dafür zu werben.
[Oliver Fraenzke, April 2017]