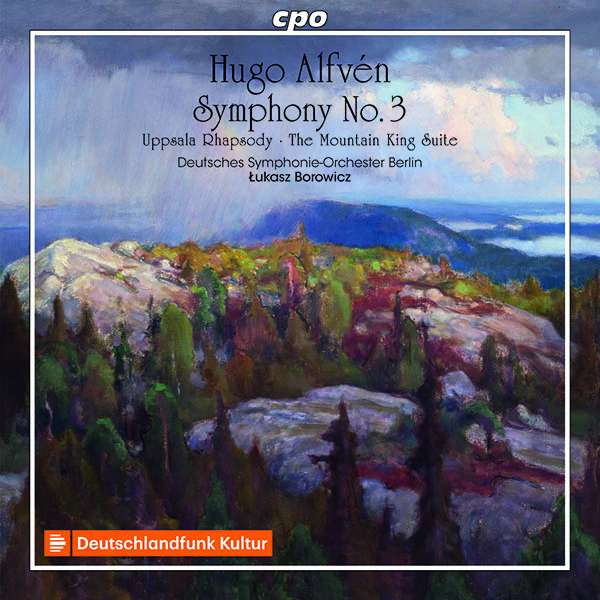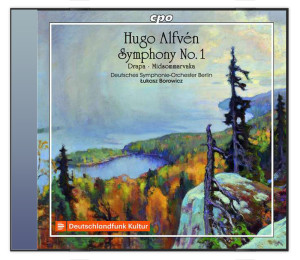Naxos, 8.573772; EAN: 7 4731337727 5

Das deutsche Symphonie-Orchester Berlin widmet sich unter Leitung von Antoni Wit den Streicherkonzerten von Johannes Brahms. Mit der Solistin Tianwa Yang steht das Violinkonzert D-Dur op. 77 auf dem Programm, im Doppelkonzert für Violine, Cello und Orchester a-Moll op. 102 kommt Gabriel Schwabe hinzu.
Johannes Brahms gehört zu den ganz wenigen großen Komponisten vor Ausbruch der Atonalität, der durchweg unzeitgemäß komponierte, dessen Musik nicht durch seine Zeit beflügelt wurde, sondern sich ständig gegen sie zur Wehr setzen musste. Ließen sich frühe Werke noch annäherungsweise als Fortführung der Tradition der Wiener Klassiker bezeichnen, löste er sich in späteren Jahren durch die enorme Konzentration und Komprimierung auf das Wesentliche vollkommen von seiner musikalischen Umwelt. Brahms‘ Werke sind weder fortschrittlich, noch sind sie reaktionär – sie beschreiten einen ganz eigenen Weg und stehen für sich alleine. Auf sein Umfeld musste Brahms gespalten gewirkt haben, verehrt als den Meister, den man nicht verkennen kann, und zugleich skeptisch beäugt, da er nicht so recht passen wollte in die Zeit und in die aktuelle Musik.
So verwundert auch nicht, dass die Musik von Brahms regelmäßig floppte oder zwiegespalten aufgenommen wurde. Das Publikum musste die Werke einfach schätzen, doch verstanden sie nur die wenigsten. Das trifft besonders auf sein letztes Orchesterwerk zu, dem bahnbrechenden Doppelkonzert a-Moll, welches die beinahe ausgestorbene Gattung auf völlig neue Weise wiederbelebte. Warum hingegen das Violinkonzert derartig populär wurde trotz des gewaltigen und kaum durchdringbaren Kopfsatzes, bleibt fraglich: Lag es am Einsatz des Widmungsträgers Joseph Joachim, an der an Unspielbarkeit gemahnenden Schwierigkeit oder am eingängigen Thema des Finals?
Die mitwirkenden Musiker dieser CD präsentieren tiefes Verständnis und ansprechende Lebendigkeit in Kombination mit einer hinreißenden Schlichtheit. Für das Projekt ging Naxos in die Vollen und engagierte das Weltruhm genießende Deutsche Symphonieorchester Berlin und nahm die CD in der Jesus-Christus-Kirche in Berlin Dahlem auf, in der bereits Furtwängler, Karajan, Abbado, Barenboim und zahlreiche andere konzertierten und einspielten. Als Solistin glänzt Tianwa Yang durch ihre Leichtigkeit und ihr akkurates Zuhören, wodurch sie stets in einer Einheit mit dem Orchester bleibt. Auch das Orchester unter Leitung Antoni Wits bleibt ausgewogen, wenngleich gerade im Kopfsatz die Tontechnik die Ausgeglichenheit unterminiert: Die hohen Streicher wurde deutlich heruntergeregelt, vermutlich um der Solovioline den Vortritt zu lassen, doch dadurch leidet die gesamte klangliche Abstimmung der Musiker. Im Mittelsatz bröckelt anfangs das Tempo zu einem Achtelzeitmaß, später gewinnt Yang das von Brahms ausdrücklich vorgeschriebene Viertelmaß wieder zurück und leitet energetisch direkt über in das souveräne Finale. Im Doppelkonzert unterstützt Gabriel Schwabe, der bereits das gesamte Cellowerk Brahms‘ aufgenommen hat, und fügt sich problemlos in das Geflecht der Stimmen ein. Die beiden Solisten wirken zusammen ohne jeden Bruch, sie sind perfekt aufeinander eingespielt. Schwabe erreicht auf dieser CD eine beinahe unerhörte Sanftheit der Cellostimme, wie sie nur von wenigen Meistern erreicht wurde, derart zart und weich klingt sein Instrument. Im Doppelkonzert kommt nun auch die Tontechnik weitesgehend mit und so schweißen alle Beteiligten das Konzert zusammen zu einem großen und zeitlosen Werk mit kolossaler Spannweite und tief empfundenem Ausdruck.
[Oliver Fraenzke, Mai 2019]