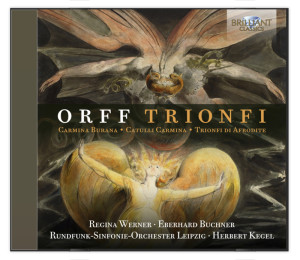Brilliant Classics, 99784; EAN: 5 028421 957845

Brilliant Classics präsentiert das gesamte Orchesterwerk des bedeutenden Schweizer Symphonikers Fritz Brun (1878–1959) in einer preiswerten 11-CD-Packung. In den ursprünglich bei Guild und Sterling erschienenen Aufnahmen sind das Moscow Symphony Orchestra und das Bratislava Symphony Orchestra unter der Leitung von Adriano zu hören.
Der Schweizer Dirigent Adriano ist ein Musiker, der ganz aus dem Studio heraus wirkt. Ohne je im Konzertsaal aufgetreten zu sein, hat er seit den 1980er Jahren in Zusammenarbeit mit dem Symphonie-Orchester des Slowakischen Rundfunks, dem Bratislava Symphony Orchestra und dem Moscow Symphony Orchestra ein umfangreiches diskographisches Werk geschaffen, das überwiegend bei Marco Polo/Naxos, Sterling und Guild erschienen ist. Sein besonderes Augenmerk galt dabei stets der Förderung vernachlässigter Kompositionen. Bei einem nicht geringen Teil der Aufnahmen Adrianos handelt es sich um Ersteinspielungen, und wiederholt ist es vorgekommen, dass der Dirigent das Orchestermaterial anhand unveröffentlichter Manuskripte selbst erstellt hat. Schwerpunkte in Adrianos Diskographie bilden das Schaffen Ottorino Respighis, von dem er mehrere frühe Orchesterwerke sowie die Opern La bella dormente nel bosco und Lucrezia als erster auf CD brachte, Filmmusik (u. a. jeweils vier Arthur Honegger und Georges Auric gewidmete CDs) und Werke schweizerischer Komponisten. In letzterer Kategorie leistete er Pionierarbeit für Émile Jaques-Dalcroze (3 CDs), Pierre Maurice, den völlig übersehenen Wagnerianer Albert Rudolph Fäsy, den in der Schweiz lebenden Amerikaner George Templeton Strong (3 CDs), sowie für Hermann Suters großartige d-Moll-Symphonie. Zu nennen wären weiterhin die Ersteinspielung der Symphonie Nr. 1 des Nürnberger „Metamorphosen-Symphonikers“ Martin Scherber und zwei CDs mit Werken des jung gestorbenen Italieners Mario Pilati. Den Höhepunkt von Adrianos Wirken als Dirigent und musikalischer Entdecker markiert dabei zweifelsohne seine Gesamtaufnahme der Orchesterwerke von Fritz Brun, die er zwischen 2003 und 2015 mit dem Moscow Symphony Orchestra und dem Bratislava Symphony Orchestra auf zehn CDs festhielt.
Auch Fritz Brun war Schweizer. 1878 in Luzern geboren, ging er 19-jährig nach Köln, um bei Franz Wüllner Komposition und Dirigieren zu studieren. Nach kurzen Intermezzi als Hauspianist des kunstsinnigen Prinzen Georg von Preußen in Berlin, sowie als Klavierlehrer in London und Dortmund, kehrte er 1903 in die Schweiz zurück und ließ sich in Bern nieder, wo ihn die Bernische Musikgesellschaft 1909 zum Generalmusikdirektor berief. Als Dirigent des Berner Stadtorchesters, der Liedertafel und des Cäcilienvereins war Brun über drei Jahrzehnte der wichtigste Musiker der Stadt und eine der herausragenden Persönlichkeiten im Musikleben der Schweiz. Gastspiele u. a. in Paris und Rom belegen sein Ansehen auch im Ausland. 1941 trat er in den Ruhestand und lebte in Morcote am Luganer See bis zu seinem Tode 1959 nur noch seinem Schaffen.
Seinem Haus in Morcote hat Brun den Namen Casa Independenza gegeben. Das ist durchaus auch als Programm für sein kompositorisches Lebenswerk zu verstehen, denn ein Unabhängiger war Fritz Brun als schöpferischer Künstler von Anfang an. Gewiss kann man ihn einen Traditionalisten nennen und jedes seiner Werke ein Klang gewordenes Bekenntnis zu einer großen Tradition – namentlich zur durch tonale Beziehungen gegliederten instrumentalen Großform, wie sie beispielhaft von Johannes Brahms repräsentiert wird –, doch hat sich Brun nie von Vorbildern abhängig gemacht und lässt sich entsprechend auch keiner „Schule“ zurechnen. Den Meistern der Vergangenheit gegenüber nimmt er die Haltung eines dankbaren Erben ein, aber eines, der mit dem überkommenen Gut nach eigenen Vorstellungen waltet. Die entspannte Haltung eines souveränen Charakters zeigt sich auch in seinem Verhältnis zu den modernistischen Strömungen seiner Zeit. So beschäftigte er sich in den 1920er Jahren intensiv mit dem „Problem der atonalen Auflockerung“, zu welcher er meinte: „Ich stehe ihr feindlich gegenüber, wenn sie sinnlos, phantasielos dem Schreiben einer öden Papiermusik verfällt, sie fesselt mich in hohem Grade, wenn sich Köpfe wie Strawinsky und Schoeck mit ihr befassen.“ Was Brun hier als „atonal“ bezeichnet, ist – die Erwähnung Igor Strawinskys und Othmar Schoecks deutet bereits darauf hin – eine freie Dissonanzbildung und Stimmführung, die sich vom Funktionsakkorddenken und schulmäßig kontrapunktischen Regelwerk des 19. Jahrhunderts löst, jedoch keine wirkliche Atonalität im Sinne harmonischer Beziehungslosigkeit. Seine Stücke anhand klarer tonaler Zusammenhänge aufzubauen, blieb ihm eine Selbstverständlichkeit, auch wenn er, gerade in den Werken seiner mittleren Schaffensperiode um 1930, eine an scharfen Dissonanzen reiche Harmonik kultivierte.

Brun war vor allem Orchesterkomponist. Im Zentrum seines schöpferischen Lebenswerkes stehen zehn Symphonien, die zwischen 1901 und 1953 vollendet wurden. Sie bilden das Rückgrat der vorliegenden, nunmehr von Brilliant Classics in einer Box zusammengefassten 11-CD-Edition. Hinzu kommen vier einsätzige Orchesterwerke, von denen die Symphonische Dichtung Aus dem Buch Hiob dem Frühwerk angehört; der Symphonische Prolog und die Ouvertüre zu einer Jubiläumsfeier stammen aus späteren Jahren, die Rhapsodie von 1957 ist Bruns letztes Werk überhaupt. An konzertanten Kompositionen hinterließ Brun ein Violoncello- und ein Klavierkonzert sowie ein einsätziges Divertimento und einen Variationszyklus für Klavier und Streichorchester. Auch alle diese Stücke gehören seinem Spätwerk an. Auf Vollständigkeit bedacht, hat Adriano nicht nur Bruns orchestrale Instrumentalmusik eingespielt, sondern sich auch seinen beiden Chorwerken mit Orchester gewidmet: Verheißung für gemischten Chor, Orgel und Orchester (Bruns größtbesetztes Werk) und Grenzen der Menschheit für Männerchor und Orchester, beide auf Texte von Goethe. Außerdem sind in der Werkschau fünf Lieder für Altstimme und Klavier enthalten, die Adriano für Streichsextettbegleitung arrangierte (Liedbearbeitungen dieser Art sind eine Spezialität des Dirigenten), sowie drei Klavierlieder von Othmar Schoeck, denen Fritz Brun zu einem orchestralen Klanggewand verholfen hat.
Ein Blick auf Schoeck lohnt sich, will man Hörern, die Brun noch nicht kennen, eine ungefähre Vorstellung davon geben, was sie in dessen Musik erwartet, handelt es sich doch bei Schoeck um denjenigen unter Bruns komponierenden Zeitgenossen, dem dieser sich künstlerisch und menschlich besonders eng verbunden fühlte. Beide Komponisten widmeten einander Werke, dirigierten Aufführungen der Stücke des jeweils anderen, und verbrachten, seit 1908 gut befreundet, auch privat regelmäßig Zeit zusammen, wanderten beispielsweise in jungen Jahren zweimal nach Italien (auf der zweiten Reise zusammen mit Hermann Hesse). Ihre frühen Briefe pflegten sie, nach ihren Lieblingskomponisten, mit „Johannes“ (Brahms = Brun) und „Hugo“ (Wolf = Schoeck) zu unterschreiben. Die Namen verraten, wie beide sich selbst sahen – und es ist der Freundschaft gewiss nicht abträglich gewesen, dass sie einander nicht als Konkurrenten betrachteten: Schoeck schrieb, wie Wolf, keine Symphonien und überhaupt vergleichsweise wenig Instrumentalmusik, Brun, wie Brahms ein ausgesprochener Sonatenkomponist, keine Opern und nur sehr wenige Lieder. Die Œuvres beider ergänzen einander, als handelte es sich um zwei Seiten einer Medaille. Gewissermaßen haben Brun und Schoeck die gleiche stilistische Haltung in unterschiedlichen Genres kultiviert: Brun in der instrumentalen Großform, Schoeck in der Oper und der lyrischen Miniatur. Beide nehmen auch eine ganz ähnliche stilistische Entwicklung, schaffen ihr Frühwerk in direkter Nachfolge der Meister, nach denen sie ihre Freundschaftsnamen gewählt haben, durchlaufen in mittleren Jahren eine Phase „expressionistischer“ Dissonanzballungen (Schoeck: Penthesilea) und finden schließlich zu einem vergeistigten, abgeklärten Spätstil, der die Errungenschaften der frühen und mittleren Werke gleichsam transzendiert.
Wie Schoeck ist Brun ein ungemein einfallsreicher Harmoniker, der sich auf feinste Übergänge versteht, den Einzugsbereich einer Tonart mit zahlreichen Nebenharmonien und Zwischenstufen vielfarbig auszugestalten weiß, und dissonante Vorhalte in verschiedenen Spannungsgraden dazu nutzt, das Geschehen reizvoll in der Schwebe zu halten. Hinsichtlich der Melodiebildung und des Periodenbaus neigt Brun schon frühzeitig zu dem, was Arnold Schönberg „musikalische Prosa“ nennt. Auch liebt er den polyphonen Tonsatz, gerade die mittleren und späten Werke sind geprägt von einem fein verästelten Miteinander der Stimmen, in welchem die Hauptmotive beständig variiert werden. Bruns Musik ist, wie Max Reger gesagt hätte, „bis in die äußersten Zweiglein durchgebildet“. Während jedoch manche seiner Zeitgenossen unter ähnlichen Voraussetzungen einen üppig-geschmeidigen „Jugendstil“ kultivieren, wirkt Brun sehr bodenständig, mitunter geradezu urig. Auch liebt er starke Stimmungskontraste: Schattige Idyllen, gemalt in exquisitem harmonisch-instrumentatorischem Chiaroscuro, gibt es in seinen Werken ebenso wie steile, schroffe Felswände und hoch aufragende Gipfelzinnen. Den ersten Satz der Dritten Symphonie charakterisierte der Komponist gar selbst als „anorganisches, einsames, feindliches“ Hochgebirge.
Einen guten Einstieg in Bruns Welt bietet die Achte Symphonie von 1942, in deren Anfangstakten man die Kunstgriffe des Komponisten wunderbar in nuce nachvollziehen kann. Der Kopfsatz beginnt heftig bewegt mit irregulär periodisierten Fanfarenklängen. Der unharmonisierte erste Ton ist E, Dominante der angegebenen Haupttonart A-Dur. Bevor diese eintritt, erscheinen als erste Harmonien Mollklänge: cis, f, d. Letzteres führt als Subdominante in eine Kadenz nach A-Dur, doch nach einem einzelnen kurzen Tonika-Akkord geht es sofort unruhig weiter. Brun gelingt hier das Kunststück eine Musik zu schreiben, die fest in A-Dur verankert ist, sich aber über weite Strecken in Nebenharmonien der Haupttonart bewegt und, da die Phrasen häufig Moll-Akkorde als Ziel ansteuern, eher Moll- als Dur-Charakter aufweist. Den vier Sätzen der Symphonie liegt als Idee die Abfolge der Tageszeiten zugrunde. Der erste Satz mit seiner unruhigen Stimmung gibt das treffliche Bild eines betriebsamen Tagesgeschehens. Dem weit ausgesponnenen zweiten Satz liegt als Refrainthema das alte Berner Volkslied „Schönster Abestärn“ zugrunde, das in mehreren Zwischenepisoden auf vielfältige Weise verwandelt wird. An dritter Stelle folgt – vom Tempo her ein weiterer langsamer Satz, doch nach dem zweiten durchaus beschwingt wirkend – ein bezauberndes Notturno mit einem beinahe konzertanten Solo für die Bassklarinette. Das Finale steht in a-Moll, hebt in mäßiger Bewegung an und entwickelt nach und nach immer mehr Aktivität, bis es, wie der Morgen in den Mittag, in die Eröffnungsfanfare des Kopfsatzes einmündet.
Bruns Symphoniestil erscheint erstmals in der 1930 uraufgeführten Fünften Symphonie zu voller Reife ausgeprägt. Dieses Stück kann mit Fug und Recht ein Extremwerk genannt werden. In Bruns Schaffen nimmt es einen ähnlichen Platz ein wie die Penthesilea bei Othmar Schoeck, oder auch die ein paar Jahre später entstandene Vierte Symphonie von Ralph Vaughan Williams im Werk ihres Komponisten. Wenn man liest, die Symphonie stehe in Es-Dur, so lasse man am besten jeden Gedanken an Beethovens Eroica, an Schumanns Rheinische oder an Bruckners Romantische beiseite! Das Thema der eröffnenden Chaconne ist so stark von Chromatik geprägt, dass die Melodie als solche keinen Dur-Eindruck aufkommen lässt. Auch in der Harmonisierung vermeidet Brun lange Zeit die Festigung der nominellen Haupttonart. Geschickt baut er in den Variationen Spannung auf und ab, doch handelt es sich um Abstufungen von Dissonanzgraden. Es brodelt beständig in diesem von grellen Kontrasten geprägten Satz, die nervöse Unruhe verschwindet nicht. Erst ganz am Ende erscheint das Thema in eindeutiger Es-Dur-Harmonisierung glanzvoll im Tutti. Man gönne der Tonart diesen Triumph, denn es bleibt der einzige im ganzen Werk! Die Siegesstimmung wird umgehend durch ein schattenhaft dahinhuschendes Scherzo durchkreuzt. Auch der langsame Satz bringt keine Aufhellung: Brun schrieb ihn als Trauermusik im Gedenken an seinen Freund, Kapellmeisterkollegen und Mitsymphoniker Hermann Suter. Der Finalsatz ist eine Fuge, deren Thema aus einem Motiv des dritten Satzes gewonnen wurde. Ähnlich Beethovens Großer Fuge und den Fugen des deutschen Brun-Zeitgenossen Heinrich Kaminski verwandelt sich das Thema im Verlauf des Stückes, sodass das wiederkehrende Chaconne-Thema des Kopfsatzes als weitere Variation des Fugenthemas erscheint. „Kontraste, Konflikte“ heißt eine geniale Symphonie des eine Generation jüngeren ostdeutschen Meisters Ernst Hermann Meyer. Dies wäre auch ein passender Titel für das Finale von Bruns Fünfter. Die Konflikte der ersten drei Sätze werden in diesem Stück nicht gelöst, sondern mittels intensivierter Kontrapunktik noch verschärft, bis in es-Moll ein Ende mit Schrecken gemacht wird.

Über weite Strecken behandelt Brun in der Fünften Symphonie das Orchester wie ein großes Kammermusikensemble. Diese Tendenz setzt sich in der Sechsten (C-Dur) fort, die in vielerlei Hinsicht wie ein lichtes Gegenstück zu dem Vorgängerwerk wirkt. Begann dieses mit einem Variationssatz, so dient in der Sechsten ein solcher als Finale. Trotz der Moll-Tonart macht er verglichen mit dem Kopfsatz der Fünften einen geradezu freudigen, zuversichtlichen Eindruck, und mündet auch folgerichtig in eine strahlende Dur-Coda. Wie Nr. 6 so hat auch Nr. 7 in D-Dur einen relativ knappen, vergleichsweise leichtgewichtigen Kopfsatz in mäßig langsamem Tempo. Ließ Brun die Sechste ausdrücklich mit einem „Präludium“ beginnen, so eröffnet er die Siebte mit einem „Nachklang“: Was nachklingt, ist ein Motiv aus Schoecks Oper Venus, das Brun nicht wörtlich verwendet, sondern – eben wie es in ihm nachgeklungen hat – bereits in verwandelter Form verarbeitet. Nach dem spukhaften Scherzo der Fünften und dem derb stampfenden der Sechsten, könnte man den entsprechenden Satz der Siebten Symphonie eine phantastische Jagdszene nennen. An dritter Stelle folgt, ähnlich der Sechsten, ein zartes Stück in melancholischem Serenadenton. Wie die Symphonien Nr. 5, 6 und 8, die alle nominell in Dur-Tonarten stehen, besitzt auch die Siebte ein Finale in Moll. Fast doppelt so lang wie der Kopfsatz, ist es fraglos der gewichtigste Abschnitt der Symphonie und zeigt seinen Komponisten vom unruhigen, zurückhaltenden Beginn bis zum choralartigen Schluss, der wahrhaft „hochgebirgig“ klingt, als Meister des weiträumigen Spannungsaufbaus.
Die beiden letzten Symphonien, die Brun als über 70-Jähriger komponierte, setzen sich recht deutlich von den vorangegangen ab und wirken wie zwei unterschiedliche Entwürfe zu einem „altersweisen“ symphonischen Schlusswort. Die Neunte (F-Dur) ist wie Nr. 5–8 eine ausgesprochene Finalsymphonie, lässt jedoch dem viertelstündigen, ernsten Andante, mit dem sie schließt („Glaube und Zweifel – Lob Gottes und der Natur“), vier ziemlich kurze Sätze voller pittoresker Elemente vorangehen („Präludium“, „Serenade“, „Liebesruf“, „Im Kreis der Freunde“) – die Monumentalsymphonik früherer Jahre erscheint ins Idyllische sublimiert. In der Zehnten (B-Dur) schließlich, der kürzesten aller Symphonien Bruns, verschwindet auch die Gewichtung des Finalsatzes. Alle Monumentalität bleibt beiseite; das Werk präsentiert sich durchweg als heiter-abgeklärtes Musizieren eines gereiften, feinsinnigen Komponisten, der sich und der Welt nichts mehr beweisen muss.
Obwohl Brun seine Erste Symphonie bereits mit 23 Jahren schrieb, entwickelte sich sein Personalstil vergleichsweise langsam. Die ersten vier Symphonien bilden gleichsam die Wegmarken dieser Entwicklung. Nr. 1 in h-Moll verhält sich zu den späteren Werken ungefähr wie Bruckners Erste zu dessen späteren Symphonien: Der Komponist schreibt noch nicht in seinem späteren Stil, aber er schreibt mit unverkennbar individueller Note. Es handelt sich um Bruns Abschlussarbeit am Kölner Konservatorium, seine erste Orchesterkomposition überhaupt, doch spricht aus dem Werk kein Anfänger, sondern ein junger Meister. Brun stellt sich merklich in die Tradition von Brahms, auf den er mehrfach direkt anzuspielen scheint. Gerade diese Anklänge zeigen Bruns Souveränität im Umgang mit dem Vorbild: Er imitiert nicht, er kommentiert. Man höre sich etwa den Beginn des Finales an und vergleiche ihn mit den entsprechenden Stellen in Brahmsens Zweiter und Dritter Symphonie! Auch in der Instrumentation geht er eigene Wege, weist etwa den Blechbläsern größere Bedeutung zu als Brahms dies tat. Bereits in dieser Symphonie neigt Brun zu schroffen Kontrasten. Besonders originell ist der Schluss: Die Musik scheint einen kraftvollen Ausklang anzustreben, fällt jedoch binnen wenigen Takten in sich zusammen, als würde sie plötzlich in einem Abgrund versinken.
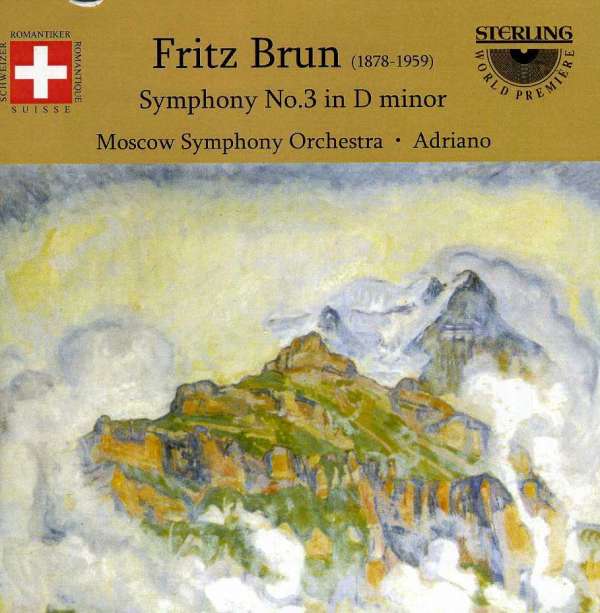
Die Symphonien Nr. 2–4 wirken weniger stringent als dieser sehr gelungene Erstling, schlagen jedoch persönlichere Töne an. Das Vorbild Brahms ist in der lyrischen Zweiten (B-Dur) mit ihrem volkstümlich-verspielten Finale nur noch an wenigen Stellen präsent. In der dreisätzigen Dritten (d-Moll) schärft sich Bruns individuelles Profil bedeutend. Namentlich im Rhythmischen steckt das über einstündige Werk voller interessanter Einzelheiten. Zwar ist Nr. 3 tatsächlich Bruns längste Symphonie, doch klingt sie auch deutlich länger als die übrigen – der Schwung der Ersten ist nahezu ganz verschwunden, selbst die „Allegro“-Ecksätze schleppen sich mit der Schwerfälligkeit eines Alpengletschers voran. Auch in der Vierten (E-Dur) dominieren behäbige Zeitmaße, doch schreibt Brun hier wieder flüssiger. Einen selbstständigen langsamen Satz enthält das Werk nicht, dessen Funktion wird gewissermaßen auf das Trio des Scherzos und die langsame Einleitung zum Finale verteilt. Der Stil der späteren Werke kündigt sich schon deutlich an, namentlich in den dissonanten Harmonien und stampfenden Rhythmen des Scherzos. Brun war im Bezug auf diese Symphonie übrigens der Meinung, sie sei insoweit „mangelhaft“, als dass er sie „mit Bruckner im Nacken“ niedergeschrieben habe. Ein seltsamer Selbstvorwurf, denn weder klingt das Werk stilistisch uneigenständig, noch besonders brucknerisch – bestenfalls ganz entfernte Anklänge an Bruckners Siebte Symphonie ließen sich anführen.
Die vier einsätzigen Orchesterwerke Bruns unterscheiden sich deutlich voneinander. Aus dem Buch Hiob, seine einzige Symphonische Dichtung, datiert aus den Jahren zwischen der Ersten und Zweiten Symphonie. Anscheinend versuchte sich der Komponist, gerade weil er in der Ersten Symphonie auf Brahmsens Spuren wandelte, nun in programmatischer Musik. Das Werk ist im Wesentlichen ein dunkel getöntes großes Adagio mit belebteren Episoden. Auf einer Höhe mit den mittleren und späten Symphonien steht der monumentale Symphonische Prolog von 1944, ein ausgedehnter Allegrosatz mit langsamer Einleitung. In der Ouvertüre zu einer Jubiläumsfeier verarbeitet Brun geistreich und unterhaltsam ein Berner Volkslied, das aber erst am Ende in seiner Originalgestalt erklingt. Der Effekt ähnelt dem Schluss der Akademischen Festouvertüre von Brahms, zu welcher Bruns Werk ein würdiges Gegenstück darstellt. Als letztes Werk überhaupt komponierte Brun mit fast 80 Jahren eine zehnminütige Rhapsodie. Adriano scheint mir das Werk in seinem Kommentar zu unterschätzen, denn ein Nachlassen der Schöpferkraft vermag ich hier nicht festzustellen. Rhapsodisch im Sinne von „aus heterogenen Elementen zusammengesetzt“ ist das Werk nicht, vielmehr zeigt sich Fritz Brun hier ein letztes Mal als Meister in der Kunst motivischer Verwandlung.
Als Komponist konzertanter Werke ist Brun erst spät tätig geworden. Die beiden dreisätzigen Konzerte für Violoncello und für Klavier datieren aus der Zeit zwischen der Achten und Neunten Symphonie, ebenso die Variationen für Streichorchester und Klavier. Das Divertimento für Klavier und Streicher gehört zu seinen letzten Werken. Wie Brahms bloßer Effekthascherei abhold, vermeidet Brun äußerliche Brillanz in der Gestaltung der Solopartien. Soloinstrument und Orchester agieren stets eng miteinander verzahnt als gleichberechtigte Partner in einem teils symphonisch, teils kammermusikalisch anmutenden Geschehen. Die Variationen und das Divertimento sind hochwertige Beiträge zur konzertanten Literatur für Kammerorchester. Die beiden großen Konzerte dürften zu den technisch und musikalisch anspruchsvollsten ihrer Art gehören und stellen gerade die Solisten vor große, aber auch durchaus lohnende Herausforderungen im Hinblick auf die Erfassung motivischer Zusammenhänge, denn da Brun das beständige Variieren liebt, lässt er die Themen in den Solostimmen in immer neuen Varianten auftreten.
An Vokalmusik hat Brun vor allem A-cappella-Chöre hinterlassen, während er nur selten instrumental begleitete Gesangsstücke schrieb. Die fünf Klavierlieder, deren Begleitung Adriano sehr ansprechend für Streichsextett gesetzt hat, stellen nichts weniger als etwa die Hälfte der Beiträge des Komponisten zu dieser Gattung dar. Es mögen Nebenwerke sein, und sie mögen eine Vergleichung mit den drei Liedern Othmar Schoecks, die in Bruns Orchesterfassung ebenfalls Teil der Brilliant-Edition sind, nicht eigentlich aushalten, doch sind es nichtsdestoweniger Nebenwerke eines Meisters. Als Hauptwerke auf vokalem Gebiet können dagegen die beiden orchesterbegleiteten Goethe-Chöre gelten, die sich durch kräftige Kontraste und eine herbe, aus linearer Polyphonie gewonnene Harmonik auszeichnen.
Zu Lebzeiten war Fritz Brun in seiner Heimat ein sehr angesehener Komponist, was sich nicht nur an verschiedenen Preisen zeigt, die ihm verliehen wurden, sondern auch daran, dass seine Symphonien stets kurz nach ihrer Vollendung uraufgeführt wurden, um anschließend von verschiedenen Schweizer Orchestern nachgespielt zu werden. Illustre Dirigenten nahmen sich der Werke an; insbesondere auf Volkmar Andreae und Hermann Scherchen konnte Brun zählen. So war etwa die Fünfte Symphonie 1930 innerhalb von sechs Wochen nach ihrer Uraufführung durch Andreae in Zürich auch in Winterthur unter Scherchen und in Bern unter Brun selbst zu hören. Auch leitete Scherchen 1933 eine Probeaufführung der Sechsten Symphonie in Winterthur und dirigierte das Werk, nachdem es im Folgejahr durch Andreae in Zürich offiziell uraufgeführt worden war, an drei aufeinanderfolgenden Tagen in Winterthur und Bern. Weit weniger Glück hatte Brun allerdings mit der Drucklegung seiner Werke. Es ist angesichts der Originalität und Qualität seiner Werke völlig unverständlich, warum bis zum heutigen Tage seine sämtlichen Symphonien, mit Ausnahme der Nummern 2 bis 4, lediglich Manuskript geblieben sind! Auch von den Konzerten gibt es keine gedruckten Partituren. Einzig die von Adriano erstellten Klavierauszüge des Cello- und des Klavierkonzerts sind veröffentlicht. Insofern ist diese Gesamtaufnahme auch als ein Plädoyer zu verstehen, all diesen Stücken zu einer angemessenen Verbreitung durch den Druck zu verhelfen; ein Plädoyer, dem sich der Verfasser dieser Zeilen gern anschließen möchte. Verleger hervor! Wer traut sich? Hier gibt es Ehre zu erwerben!
Adriano hat seine zehn CDs umfassende Gesamteinspielung innerhalb von 13 Jahren mit zwei Orchestern durchgeführt. Abgesehen von der Achten, ist in allen Symphonien das Moscow Symphony Orchestra zu hören, ebenso in den einsätzigen Orchesterwerken. In den drei zuletzt entstandenen Produktionen – der Achten Symphonie und den drei Schoeck-Liedern, den Werken für Klavier und Orchester, sowie dem Cellokonzert und den Vokalwerken – spielt das Bratislava Symphony Orchestra. Die erste CD, die Einspielung der Dritten Symphonie, war ursprünglich bei Sterling erschienen, die übrigen CDs bei Guild. Die Wiederveröffentlichung durch Brilliant vereint somit zum ersten Mal den ganzen Zyklus unter einem gemeinsamen Dach. Will man die Leistung der Ausführenden richtig einschätzen, so sollte man bedenken, dass es sich um eine Pioniertat handelt. Adriano hat mit den Orchestern Werke einstudiert, die nicht nur durch ihre weitgehend polyphone Beschaffenheit und mitunter komplizierte Rhythmik höchste Anforderungen an die Musiker stellen, sondern die auch über keine besondere, teilweise auch gar keine Aufführungstradition außerhalb der Schweiz verfügten. Die Orchester in Moskau und Bratislava betraten mit Bruns Musik völliges Neuland. Adriano hat es vermocht, sie mit den Gegebenheiten dieser Werke vertraut zu machen und zu handwerklich sehr soliden, musikalisch überzeugenden Darbietungen anzuspornen. Bruns Rhythmen sind bei Adriano in sicheren Händen, auch wahrt er stets die Übersicht über das Zusammenspiel der Orchestergruppen. Mit dem Cellisten Claudius Herrmann und dem Pianisten Tomáš Nemec stehen ihm in den Instrumentalkonzerten fähige Solisten zur Verfügung, denen sich die Mezzosopranistin Bernadett Fodor in den Liedern würdig anschließt. Der Bratislava Symphony Choir erledigt seine Aufgabe in den Chorstücken gut, wenn auch nicht ohne Probleme bezüglich der Textverständlichkeit. Nur im Falle einer einzigen Aufnahme, nämlich des Klavierkonzerts, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, die Musiker hätten sich (in den Ecksätzen, weniger im Mittelsatz) mit der bloßen technischen Bewältigung des (offenbar sehr schweren) Stückes zufrieden gegeben. Dass ich mir noch stringentere, die Feinheiten der Brunschen Musik noch genauer herausarbeitende Darbietungen als die hier aufgezeichneten vorstellen kann, besonders wenn Orchester und Dirigent Erfahrungen mit den Werken im Konzert gemacht hätten, sei nicht verschwiegen; Adriano hat allerdings für zukünftige Konkurrenzeinspielungen die Messlatte hoch gelegt. Im Großen und Ganzen kann man den Dirigenten und seine Mitstreiter nur beglückwünschen, ein solches Projekt über einen so langen Zeitraum weitergeführt und erfolgreich zum Abschluss gebracht zu haben. Das Ergebnis ist ein Meilenstein in der Rezeptionsgeschichte eines bedeutenden Symphonikers.
Die Packung enthält insgesamt elf CDs, denn als Bonus ist den zehn von Adriano dirigierten eine weitere Scheibe mit historischen Aufnahmen aus dem Jahr 1946 beigegeben. Sie enthält das einzige überlieferte Tondokument von Fritz Brun als Orchesterdirigent, eine Aufnahme seiner Achten Symphonie mit dem Studio-Orchester Beromünster, sowie eine Einspielung der Variationen für Streichorchester und Klavier durch das Collegium Musicum Zürich und den Pianisten Adrian Aeschbacher unter der Leitung Paul Sachers, der das Werk in Auftrag gegeben hatte. Auch diese Bonus-CD war ursprünglich bei Guild herausgekommen.
Aus Platzgründen konnte der Edition als Begleittext lediglich der siebenseitige Aufsatz beigegeben werden, mit welchem Peter Palmer 1996 in der britischen Musikzeitschrift Tempo auf Brun aufmerksam gemacht hatte; ein guter, auf den Punkt gebrachter Text, dem man stellenweise anmerkt, dass er auf ein britisches Publikum zugeschnitten ist (Brun wird vorrangig mit britischen Zeitgenossen verglichen). Brilliant Classics stellt jedoch auf seiner Netzpräsenz zusätzlich einen über 80-seitigen Text bereit, der sämtliche Einführungen Adrianos zu den originalen Veröffentlichungen enthält. Sie enthalten nicht nur eine Fülle an Informationen über Bruns Biographie und sein Schaffen, sondern vermitteln auch vom Schweizer Musikleben zur Zeit des Komponisten ein sehr lebendiges Bild.
Norbert Florian Schuck [Mai 2021]