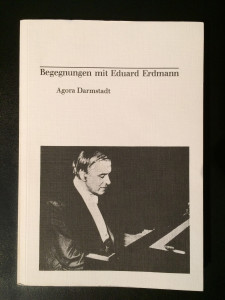Sonaten 1-3: Naxos 8.110693; EAN 0636943169322
Sonaten 4-6 & 19-20: Naxos 8.110694; EAN 0636943169421
Sonaten 7-10: Naxos 8.110695; EAN 0636943169520
Sonaten 11-13: Naxos 8.110756; EAN 0636943175620
Sonaten 14-16: Naxos 8.110759; EAN 0636943175927
Sonaten 17, 18, 21: Naxos 8.110760; EAN 0636943176023
Sonaten 22-26: Naxos 8.110761; EAN: 0636943176122
Sonaten 27-29: Naxos 8.110762; EAN: 0636943176121
Sonaten 30-32: Naxos 8.110763; EAN 00636943176320
Eroica-Variationen und Bagatellen: Naxos 8.110764; EAN 0636943176429
Diabelli-Variationen und Bagatellen: Naxos 8.110765; EAN 0636943176528
Klavierkonzerte 1-2: Naxos 8.110638; EAN 0636943163825
Klavierkonzerte 3-4: Naxos 8.110639; EAN 0636943163924
Klavierkonzert 5 und Cello-Sonate 2: Naxos 8.110640; EAN 0636943164020

Artur Schnabel war der erste Pianist, der Aufführungen sämtlicher Klaviersonaten Ludwig van Beethovens auf Schallplatte festgehalten hat. Oliver Fraenzke, Gründer unseres Magazins, Herausgeber der Kammermusik-Reihe Beyond the Waves im Verlag Musikproduktion Jürgen Höflich und selbst Pianist, stellt diese diskographische Großtat in der zweiten Folge unseres Kleinen Beethoven-Vademecums vor und legt dar, warum sie nach wie vor für die Darbietung Beethovenscher Klaviermusik Referenzstatus besitzt. (d.Red.)
Betrachtet man Beethovens Klavierwerk, so kommt man kaum um die Aufnahmen Artur Schnabels herum, die weit oben in der Liste der Referenzaufnahmen stehen, als Zyklus betrachtet wohl sogar mit an deren Spitze. Sicherlich gibt es zahlreiche andere großartige Aufnahmen von Beethovens Tastenwerk, so beispielsweise durch Eduard Erdmann oder Arturo Benedetti Michelangeli, doch kaum einer von den Pianisten diesen Ranges näherte sich dem Komponisten derart systematisch in der Gesamtheit seines Schaffens. Aus den 1920er-Jahren existieren Konzertprogramme Schnabels, die zyklische Aufführungen aller Beethoven-Sonaten belegen; in den 1930er-Jahren empfand Schnabel schließlich die Aufnahmetechnik als ausreichend gereift, um mit den Sonaten, Klavierkonzerten, den Diabelli- und den Eroicavariationen und einigen anderen Werken ins Studio zu gehen, wobei er die Abbey Road Studios in London für das Großprojekt auserkor.
In der Auswahl seines Repertoires galt Artur Schnabel als unerbittlich: Ausschließlich die Werke nahm er auf, die laut eigener Aussage besser sein, als ein Mensch sie spielen könne. Dies führte dazu, dass er beinahe ausschließlich Werke der Epoche um die Wiener Klassik spielte, inklusive Brahms und Schubert. Letzteren entdeckte Schnabel gemeinsam mit Eduard Erdmann wieder und konzertierte als einer der ersten mit dessen Sonaten, die zuvor wenig verstanden waren. Der Fokus auf die vergleichbar alte Musik mag vor allem deshalb verwundern, da Schnabel auch als Komponist in Erscheinung trat und dort zu den Neuerern zählte. Beeinflusst vom Durchbrechen der Tonalität und den Ideen Schönbergs schloss Schnabel sich den Fortschrittlern an, bewegte sich in den Kreisen von Ernst Křenek, Philipp Jarnach und Hans Jürgen von der Wense, der zweifelsohne zu den radikalsten Tonsetzern der Zeit zählte und in seiner ganzen Art sowie seinem vielseitigen Wirken revolutionierte. Schnabel betitelte seine Werke allgemein mit klassischen Bezeichnungen wie Sonate, Quartett oder Symphonie, doch inhaltlich hatten sie zumeist wenig mit diesen Gattungen gemein.
Geboren wurde Artur Schnabel am 17. April 1882 in Kunzendorf, Galizien, das heute zum südöstlichen Teil Polens gehört. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen als jüngstes von drei Kindern einer jüdischen Textilhändler-Familie auf. Er zog noch als Kind mit der Mutter und seinen Geschwistern nach Wien, wo er 1890 als Pianist debütierte und dort wohnhaft blieb, selbst als seine Familie vier Jahre später wieder in die Heimat zurückzog. Er wurde Schüler von Anna Jessipowa, die als „Madame Essipoff“ bekannt war, und nach deren Scheidung Schüler ihres Exgatten Theodor Leschetizky, einer der namhaftesten Lehrer der Zeit und Mitbegründer der heute sogenannten russischen Klavierschule. Eusebius Mandyczewski unterwies Artur Schnabel in Musiktheorie und gab ihm Kompositionsunterricht; durch ihn kam er auch in Kontakt mit einigen der großen Komponisten der älteren Generation wie unter anderem Johannes Brahms, wobei scheinbar wenig Austausch zwischen den etablierten Meistern und dem jugendlichen Aufsteiger stattgefunden hat. Um die Jahrhundertwende zog Schnabel nach Berlin und heiratete 1905 Therese Behr. Therese Behr-Schnabel wirkte als Altistin, trat oft auch mit ihrem Ehemann auf. 1909 kam Karl Ulrich auf die Welt, der sich selbst als Pianist einen Namen machte und gemeinsam mit seinem Vater einen Großteil des vierhändigen Repertoires einspielte, 1912 folgte Stefan Artur, welcher in Amerika Schauspieler wurde. (Bereits 1899 war Schnabel Vater einer vorehelichen Tochter geworden, Elisabeth Rostra.) Nach Hitlers Machtergreifung 1933 flüchtete die Familie in Vorahnung unmittelbar nach England, verbrachte die Sommer jedoch in Tremezzo. Als der Krieg unausweichlich schien, emigrierten die Schnabels 1939 in die USA, die Schwestern folgten – die Mutter blieb in Österreich, wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert und kam dort im gleichen Jahr zu Tode. Nach dem Krieg kehrte die Familie nach Tremezzo zurück, Artur verlebte dort seine letzten Jahre und starb am 15. August 1951 in Morschach in der Schweiz.
Die für seine Entwicklung bedeutsamsten Jahre dürften nach der fundamentalen Ausbildung in Wien wohl diejenigen in Berlin gewesen sein, wo Schnabel in regem künstlerischen Austausch mit einigen der bedeutendsten Komponisten und Musikern gewesen ist sowie den Durchbruch als konzertierender Pianist errang. Einer der wahrscheinlich zentralsten Einflüsse dürfte der durch den vierzehn Jahre jüngeren Eduard Erdmann gewesen sein: die beiden lernten sich vermutlich 1920 kennen, als Erdmann sich gerade als einer der zentralsten Vertreter der Szene Neuer Musik etablierte, mit Aufführungen u.a. seines Lehrers Heinz Tiessens, Scherchens, Bergs, Schönbergs etc. von sich Reden machte. Erdmann sah Schnabel gewissermaßen als eine Art Lehrer, befolgte insbesondere seine Lebensratschläge und nahm wichtige Anschauungen Schnabels an. Und doch handelte es sich um ein Verhältnis auf Augenhöhe. Schnabel schätzte Erdmann besonders auch als Darbieter seiner eigenen Werke und übernahm als Komponist seinerseits musikalische Inspirationen von seinem Kollegen. Schubert entdeckten sie gemeinschaftlich wieder und zurückblickend schuf sogar Erdmann die tiefgründigeren Aufnahmen dessen Klavierwerks (insbesondere der letzten Sonaten und der Impromptus). Zu Beethoven bemerkte Erdmann allerdings, dass keiner dessen Sonaten so verstand, wie Schnabel es tat, und er selbst nichts hinzuzufügen hätte. Aus diesem Grund weigerte sich Erdmann, Beethovens Sonaten aufzunehmen, solange Schnabel lebte: erst 1953 spielte er, bereits als von der Kriegszeit gezeichneter Mann mit schwindender manueller Technik, nicht aber geistiger Durchdringung, die Pathétique ein.
Schnabels Beethoven-Aufnahmen entstammen seinen reifen Jahren: Die meisten fallen in die Zeit seiner frühen 50er, als sich die Erfahrungen seiner bereits über 40 Jahre währenden Karriere längst in einem gesetzten, bewussten und ausgeglichenen Spiel manifestiert haben. Schnabel blieb durch den regen Austausch in Berlin frisch und lebendig und stand den musikalischen wie technischen Neuerungen gegenüber stets offen. Jede der Aufnahmen zeugt von intensiver und vor allem präzise detailverliebter Beschäftigung mit ausnahmslos einem jeden dieser Werke. Schnabel vertrat genaue Werktreue und so setzte er die Partituren minutiös um. Dabei spielte er allerdings nüchterner, distanzierter, als es beispielsweise Erdmann tat. Nichtsdestoweniger fehlt auch die emotionelle Seite der Werke nicht und die Musik funkelt vor Lebendigkeit und Frische. Als Zyklus betrachtet zeugen die Einspielungen vor allem von einem: umfassender Menschlichkeit. Schnabel stellt Beethoven nicht als wilden, zerzausten Berserker da, der die Regeln brach und als Raptus das Aufsehen auf sich zog, so wie man es von neueren Einspielungen viel zu leidlich kennt, sondern zeigt ihn als vielschichtige, ausgeglichene Persönlichkeit, dessen kompositorische Ausbrüche stets integriert werden in ein komplexeres Ganzes. Beethoven wird uns sympathisch.
Technisch stechen besonders Schnabels Feinheiten des Anschlags hervor, seien es die schimmernden Läufe oder die geräuschhaft schnellen Triller, vor allem aber stockt einem der Atem, sobald Schnabel Pianissimo spielt. Über lange Strecken bannt der Pianist den Höher durch sein weltfremdes, gedämpftes Spiel in den ruhigsten Passagen, hält die Spannung bis zum Zerreißen in der Schwebe und bringt die Zeit zum Stillstand. Mit dieser Basis spannt er große Kontraste und eröffnet ein gewaltiges Spektrum an Farben und Möglichkeiten, die zu einem unerhört formbezogenen Spiel führen, was uns selbst die weiten Flächen der letzten Sonaten mühelos nachvollziehen lassen.
In keiner Sekunde buhlt Schnabel dabei um Aufmerksamkeit, sondern spielt lediglich für den Komponisten, für die Noten und für den verständigen Hörer, der nicht geblendet werden will, sondern der Musik zuliebe hört. Entsprechend könnten Hörer, die sich an den Effekt neuerer Aufnahmen gewöhnt sind, irritiert werden von der Leichtigkeit, Lebendigkeit und unprätentiösen Herangehensweise an diese Werke.
In den Beethovenaufnahmen seien besonders die getragenen Sätze hervorzuheben, die Schnabel enorm langsam nimmt, dabei aber zu keiner Zeit schleppt, so dass in der Wirkung die Zeit still zu stehen scheint und dennoch in gemächlichem Maße prozessiert. Seine beachtliche Fingertechnik stellt der Pianist nie zur Schau, kehrt sie im Gegenteil teils sogar unter den Tisch, um umso mehr Platz für musikalische Ausgestaltung zu gewinnen. Natürlich gibt es kleinere Fehler oder Ungenauigkeiten im Vergleich zum neueren (auch Live-)Aufnahmen, was ich jedoch nicht als Manko sehe, denn auch sie stehen für die menschliche Seite der Musik. Zudem nimmt man sie gerne in Kauf für solch ein durch und durch musikalisches, ausgewogenes und formbewusstes Spiel, das auch die längsten Sätze als Ganzes erfasst.
In den frühen, Beethovens Lehrer Haydn gewidmeten Sonaten vollzieht Schnabel den Stilentwicklungsprozess pianistisch nach, stellt sie in Haydn’scher Feinheit des Spiels dar. Schon in der beginnenden f-Moll-Sonate sticht sein brillantes Staccato-Spiel hervor, durch das die Noten zwar sehr kurz, aber dennoch mit Hall und Volumen kommen. Auch die Sforzati wägt Schnabel sauber ab, bezieht sie stets auf die aktuelle Grunddynamik. Im Adagio hören wir bemerkenswerte Pedalisierung, das Finale gestaltet er etwas freier. Die folgende A-Dur-Sonate beginnt ausgesprochen fröhlich und locker geradlinig, was den ganzen Satz durchgeht, der in dieser Heiterkeit verweilt – hier wirken neuere Darbietungen doppelbödiger und zwiegespaltener, doch Schnabel setzt seine Ansicht stimmig um. Das Largo gestaltet er herrlich zweischichtig, nimmt die Melodie als reinen Gesang mit einer Art Streicherbegleitung. Das Finale erscheint wenig virtuos, dafür umso sanglicher mir subtilen Freiheiten, das Grazioso hären wir so wörtlich wie selten sonst. Die umfangreichere C-Dur-Sonate nimmt Schnabel klassisch fein und ausdrucksstark, intensiviert die Kontraste. Sehr sympathisch erscheint mir, dass selbst Schnabel mit der Trillerbewegung im Thema zu kämpfen hat: hieran dürfen sich alle Pianisten erfreuen, die selbst um dieses Detail gerungen haben. Im Adagio erleben wir, wie laut Pausen sprechen können und schmerzlicher rufen als die Noten an sich; der Mollteil changiert zwischen Zweifel und Hoffnung, Aufbegehren und Resignation: Momente der Gänsehaut. Das Scherzo springt gelöst herum, dabei wirkt vor allem das Trio völlig unprätentiös, was angesichts des Notensatzes einem Wunder gleicht – dafür fokussiert Schnabel sich auf die Bassführung. Wieder leichtfüßig kehrt das Finale ein, wobei Schnabel jedes der Motive in klaren Bezug setzt und so einen roten Faden durch den vielgliedrigen Satz zieht.
Schreiten wir etwas zügiger durch die darauffolgenden Sonaten, konzentrieren uns nur auf ein paar besonders auffällige Stellen. Aus der siebten Sonate op. 10/3 sticht der Largo-Mittelsatz hervor, der so enorm langsam gespielt wird, dass Schnabel jede einzelne Note mit Bedeutung füllen muss. Er setzt sie um wie eine Cellostimme; die Qualität jeden Anschlags übersteigt hierbei, so meint man zumindest, die physikalischen Möglichkeiten eines Klaviers. Im Rondo glänzt die Unterstimme, flächig klangmalerisch unterstreicht sie die Melodie, bleibt dabei in jeder Note verständlich. Die Pathétique weitet erneut die Kontraste, das Fortissimo findet seine Grenze an Robustheit und Lärmen, ohne dabei hart oder geschlagen zu wirken. Im Hin und Her, Drängen und Zurückhalten des Beginns intensiviert Schnabel die Spannung, löst sie erst im Allegro, wo er unerbittlich nach vorne zieht und ein ewiges Precipitato-Gefühl evoziert. Der Mittelsatz trumpft wieder durch seine Kantabilität auf, präsentiert romantischen Flair in klassischem Gewand. Das Finale gewinnt schließlich die lang ersehnte Leichtigkeit und Gelöstheit, auf die die ganze Sonate abzielt, beruhigt das Gemüt nach der enormen Spannung der Vorausgegangenen. Eines der wenigen Details, die mir in Schnabels Darbietungen unverständlich erscheinen, finden wir im Finale der E-Dur-Sonate op. 14/1: warum beschleunigt Schnabel auf das Crescendo? Dies unterminiert die geradlinige Fröhlichkeit des Satzes. In der folgenden G-Dur-Sonate besticht einmal mehr der Mittelsatz, trotz der kurzen Staccati hebt Artur Schnabel die Melodie in den Vordergrund und gestaltet sie kompromisslos aus. Das Scherzo avanciert zu einer aufsehenerregenden Gradwanderung zwischen operettenhafter Stimmung und düster-gespenstischem Satz, in der Kürze der Motive beinahe fragmentarisch wirkend.
Die stilistische Auswägung der mittleren Sonaten ist allgemein erwähnenswert. So ist beispielsweise die sogenannte „Mondschein“-Sonate überhaupt nicht so romantisierend gespielt, wie man sie heute viel zu oft hören muss, sondern besticht durch gehaltenes, dabei durchgängiges Tempo, das die Wirkung auf die Spitze bringt und über lange Strecken die eiserne Spannung aufrechterhält. Umso vorwärtsdrängender das Finale, welches beinahe aggressiv aufstößt und die Sforzati wie Aufschreie hervorblitzen lässt. Die folgenden Sonaten integrieren zusehends mehr orchestrale Farben in das Klavier: während das Andante der „Pastorale“ wieder einen Beweis für brillante Zweistimmigkeit mit feinsinnigem Staccato liefert, erscheint das Adagio der G-Dur-Sonate op. 31/1 bereits völlig orchestral mit Holzbläserstimmen als Melodie und dichter Streicherbegleitung. Im Finale der Pastoral-Sonate denken wir dafür, eine Harfe zu hören. In der 31/1 ist noch der Beginn zu erwähnen, der fast wie ein Scherzo daherkommt, keck virtuos, und doch ohne jegliche Form der Zurschaustellung. Wie bereits bei der Sonata quasi una fantasia, so nimmt Schnabel auch die „Sturm“-Sonate op. 31/2 keineswegs klischeehaft romantisch, er treibt die Spannung nicht durch Rubato unnötig in die Höhe, sondern lässt die Noten durch Präzision und ausgewogenen Anschlag durch sich sprechen. Das Finale stellt den bisherigen Höhepunkt von Schnabels vielseitiger Staccatokultur dar. Die Es-Dur-Sonate op. 31/3 gehört zu den Sonaten, die unbedingt mehr zu entdecken sind. Schnabel setzt sie in unendlicher Schönheit um mit augenzwinkernden Details, in springender Heiterkeit mit wohl dosierten Proportionen. Die technischen Anforderungen des Scherzos stellt er vollends in den Dienst der musikalischen Ausgestaltung; das Presto nimmt er rasend schnell, bleibt fein und technisch unscheinbar. In der „Wandstein“-Sonate op. 53 gilt es, sich die Ressourcen einzuteilen, um die Form zu bewältigen, was Schnabel durch langes Beharren in den unteren Dynamikstufen und graduellen Aufbau realisiert und so den gesamten Bogen des Satzes musikalisch ausfüllt. Im Adagio zählt dagegen jeder Ton, jede subtile Wendung wird adäquat unterstrichen, ohne sie überzubetonen. Der Beginn des Rondos schwebt förmlich über allen Wolken, so surreal wirkt das Pianissimo in Schnabels Händen.
In den späten Sonaten spreizen sich die Kontraste bis zum Zerbersten auf, dabei wird die Aussage auf ihre Weise kompakter. Ich würde mich hüten, diese Werke einer „Epoche“ zuzuordnen, denn dieser Stil ist ausschließlich später Beethoven und nichts sonst. Jede Sonate steht monumental für sich alleine in der Musikgeschichte und verlangt nach unbefangenem Herangehen, enormem Bewusstsein und musikalischer Imaginationsgabe. Schnabel blüht hier voll auf und kreiert einen Höhepunkt der Klavierkunst. Besonders die langsamen Passagen wirken wie Wunder, vollendeter Tastengesang und unendlich fein abgestufte Dynamiknuancen bereiten den Weg, die „himmlischen Längen“ zu bewältigen, die durch seine facettenreiche Artikulation und die überirdischen Pianissimopassagen (besonders -triller) bis ins Letzte ausgestaltet werden. Die flirrenden Begleitungen raunen orchestral ausgestaltet, während die Oberstimme schwebt, stets im Bewusstsein über Form und Proportion.
Die Klavierkonzerte Beethovens nahm Artur Schnabel gemeinsam mit dem London Symphony Orchestra und dem London Philharmonic Orchestra unter Leitung Malcolm Sargents auf. Das Klavier erscheint dabei auf das Orchester klanglich abgestimmt, verliert dabei nicht seine Distanz und seinen individuellen Klang, wirkt entsprechend wie ein wohl dosierter Kontrapunkt. Schnabel übernimmt eine reiche Palette an Orchesterfarben aufs Klavier, nutzt ebenso aber die rein klavierspezifischen Klangfarben, um das Zusammenspiel durch unterschiedliche Facetten zu bereichern.
[Oliver Fraenzke, Februar 2021]