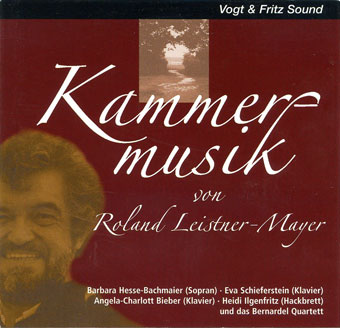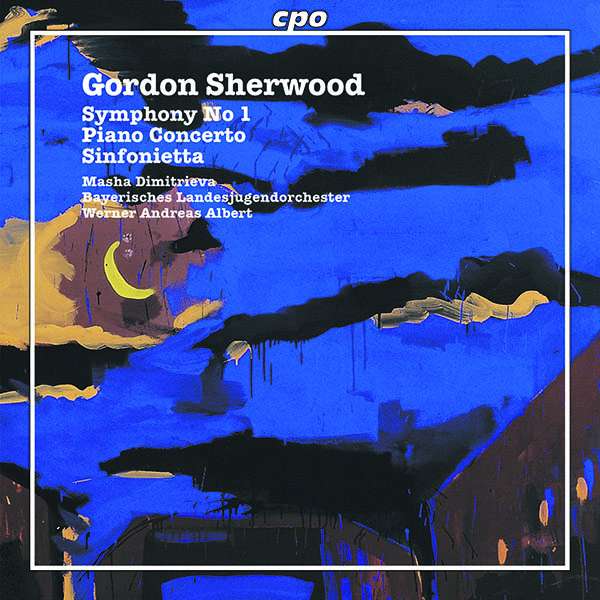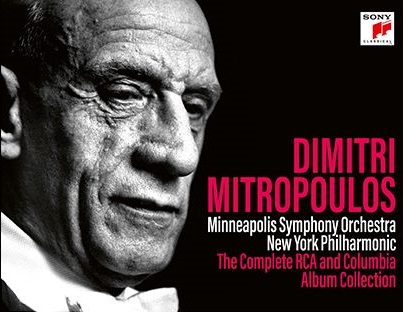Um in das Thema einzuführen, möchte ich mit einer kleinen autobiographischen Begebenheit beginnen. Als ich vor vielen Jahren meinen damaligen Musiklehrer in der gymnasialen Oberstufe mit Blick auf eine nahende Prüfung fragte, ob er mir Literatur empfehlen könne, die einen fundierteren Überblick über die Musikgeschichte vermittelt, erhielt ich folgende Antwort: „Schau dir doch einfach diese Konzertserie von Bernstein an.“ Freilich hatte ich damals bereits von Leonard Bernstein gehört, aber die von meinem Lehrer angedeutete Konzertreihe war mir bis dato unbekannt. Mit diesen recht spärlichen Informationen machte ich mich an das (letztlich recht aufwendige) Unternehmen, mir irgendwoher das besagte Material zu beschaffen. Was mir mein Lehrer damals empfahl, waren die sogenannten Young People’s Concerts, die Bernstein in den späten 50er bis frühen 70er Jahren mit dem New York Philharmonic Orchestra überaus erfolgreich präsentierte.
Diese Konzerte, in denen Bernstein mit all seiner medialen Vermittlungskompetenz und vor allem seinem Charisma klassische Musik einem damaligen Millionenpublikum durch das Fernsehen näherbrachte, sollte letztlich auch mein Interesse nicht nur für die Musikgeschichte allgemein, sondern speziell auch für die Art ihrer Aufbereitung und Vermittlung beeinflussen. Ich kann meinen biographischen Einstieg vielleicht dahingehend bilanzieren, dass Bernstein mit seinen Young People’s Concerts sicherlich dazu beigetragen hat, dass ich mich später für das Studium der Musikwissenschaft entschied.
Wenn man einmal grundsätzlich über den hier angerissenen Zusammenhang von Musikgeschichte, musikgeschichtlicher Bildung und deren Vermittlung ins Nachdenken gerät, so gelangt man fernab der traditionellen Formate musikhistorischer und -historiographischer Aufbereitung auch zu dem Phänomen des Historischen Konzerts. Genauer gesagt, zum Historischen Bildungskonzert im Sinne einer klingenden Vermittlung von Musikgeschichte. Im Zuge einer Recherche nach dem Ursprung und zentralen Entwicklungsstationen dieses Konzerttypus wird recht schnell offensichtlich, dass das Format durch die Geschichte hindurch häufig mit konkreten Bildungsintentionen verknüpft wurde. Diese Vermittlungsabsichten dokumentieren sich vor allem in der Art und Weise der Selektion von bestimmtem Repertoire sowie in den die Konzerte zumeist flankierenden Werkkommentaren der Programmverantwortlichen, in denen die Begründung der intendierten Auswahl mitgeliefert wird.
Im Folgenden möchte ich mich auf ausgewählte Fallbeispiele des Historischen Konzerts im Zuge eines kleinen „Gänsemarschs der Epochen“ (Ernst Bloch) konzentrieren und dabei die den Konzerten zugrundeliegenden Bildungsintentionen erläutern. Die Frage nach den Absichten, wie und warum bestimmte Kompositionen ausgewählt und kommentiert werden, damit sie in der Funktion einer übergeordneten musikgeschichtlichen Bildungsidee aufgehen, stellt das verbindungsstiftende Motiv meiner Ausführungen dar.
I. Das Historische Konzert als tönende Theologie im 17. Jahrhundert
Den Anfang meines Überblicks bildet eines der wohl frühesten Historischen Konzerte aus dem damals protestantisch geprägten Nürnberg um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Bei diesem Exempel handelt es sich weniger um die Absicht einer Wiederbelebung älterer Musik um ihrer selbst willen, als vielmehr um die wohldurchdachte Darbietung von Kompositionen, die so etwas wie eine chronologisch sortierte, klingende Geschichte der christlichen Musik bot.
Was wissen wir über das betreffende Konzert, das am 31. Mai 1643 in Nürnberg stattfand? Dokumentiert ist, dass der damalige Professor für Theologie der Nürnberger Universität, namens Johann Michael Dilherr, ein großer Liebhaber und Kenner der Musik war, und dass eben dieser Dilherr ein Gesuch an den Rat der Stadt richtete, um eine sogenannte „Entwerffung des Anfangs, Fortgangs, […] Brauchs und Mißbrauchs der Edlen Music“ ausrichten zu dürfen, was dann auch positiv beschieden wurde. Über den Inhalt und Ablauf des Konzerts im großen Stadtsaal geben die Chroniken des Nürnberger Archivs recht genaue Auskunft. Man kann zunächst festhalten, dass dieses in jederlei Hinsicht groß angelegte Konzert einiges Aufsehen in der Stadt erregte, was umso mehr erstaunen mag, als wir uns in einer Zeit omnipräsenter Konflikte, verursacht durch die Wirren des Dreißigjährigen Krieges, befinden. Doch die Stadtchronik gibt wieder, dass nicht nur das nahezu gesamte, verfügbare Personal an städtischen Musikanten, Stadtpfeifern, Sängern, Kantoren und Organisten aufgeboten wurde, sondern dem Konzert schließlich auch eine „unglaubige Menge Volks, ja wohl etliche Taußend Menschen“, beigewohnt haben muss.
Das Konzertprogramm, welches Dilherr ausgewählt und in einer lateinischen Vorrede ausführlich erläutert hat, vollzieht zunächst eine Entwicklung der biblischen Musikgeschichte nach. Die unverkennbare theologisch motivierte Kontextualisierung des Programms stand dabei im Dienste der Veranschaulichung, welche Bedeutung und welcher Nutzen der musica sacra seit der Erschaffung der Welt zukam. Entsprechend reicht der erste Teil des Programms von einem anfänglichen Gesang dreier Diskantisten im Sinne einer Versinnbildlichung der Engels- oder Himmelsmusik mit Texten aus dem Genesisbericht, über Harfen- und Flötenspiel in Erinnerung an Jubal, dem biblischen Erfinder der Instrumente, über alttestamentarische Psalmgesänge der Erzmusiker David und Salomo bis hin zu neutestamentarischen Lobliedern anlässlich Jesu Verkündigung – um hier nur einige der dargebotenen Stücke aufzulisten. Nach Abschluss dieses biblischen Programmteils kam es dann zu einem zeitlichen Wechsel innerhalb des Konzertablaufs. Denn durch Dilherrs Wahl eines gregorianischen Chorals bewegte sich das Programm fortan erstmals auf dem Boden musikgeschichtlicher Tatsachen. Es folgten sodann Beispiele für mehrstimmige Figuralmusik (u. a.) von Johannes Ockeghem, womit wir uns bereits mitten im 15. Jahrhundert befinden, sowie eine Motette Orlando di Lassos, also eines Vertreters des 16. Jahrhunderts. Mit doppelchörigen Werken von Giovanni Gabrieli und Hans Leo Hassler – Akteuren, die wir heute historiographisch in die Frühphase der Barockmusik einordnen – sollte dann der vorläufige musikgeschichtliche Höhepunkt, sowohl was die kompositionstechnische Entwicklung als auch den Nutzen gottesdienstlicher Musik betrifft, präsentiert werden. Durch diese vergleichende Gegenüberstellung von Komponisten und Stilen aus verschiedenen Epochen beabsichtigte Dilherr auf den kompositorischen Fortschrittsprozess der Kirchenmusik aufmerksam zu machen. Dieses Vorhaben enthielt dabei eine zentrale theologische Bildungsintention: Dadurch, dass Dilherr am Ende des Konzerts auch einen protestantischen Choral sowie eine Darbietung des Verses „Coelestis musica salve“ darbieten ließ, bekam der musikgeschichtliche Fortschrittsgedanke des Konzerts einen konfessionellen, und zwar einen protestantisch-lutherischen Akzent. Nachdem die Musik der biblischen Vergangenheit und der nicht zu überbietenden Gegenwart verklungen war, erfolgte eine Art prophetische Ankündigung der nahenden Himmelsmusik, eben jener „coelestis musica“, als einem Sinnbild für die im protestantischen Glauben fest verankerte Vorstellung von der endzeitlichen Apokalypse. Biblische Vergangenheit, weltliche Gegenwart und zukünftige Prophetie wurden damit in dem Nürnberger Konzert auf Basis eines theologisch geleiteten Geschichtsverständnisses zusammengeführt und durch das göttliche Medium der musica sacra klingend zum Ausdruck gebracht.
II. Das Historische Konzert Gottfried van Swietens – oder: Zur Konstruktion eines musikgeschichtlichen Erbes
Ich komme damit zum zweiten Fallbeispiel eines Historischen Bildungskonzerts und mache dabei einen großen Sprung vom 17. in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Hierbei geht es mir um die Anfänge des Historischen Privatkonzerts, die neben ersten Ausprägungen in London und Berlin vor allem in Wien zu finden sind – und hier personell aufs Engste verbunden mit dem Diplomaten, Bildungspolitiker und bedeutenden Musikmäzen Baron Gottfried van Swieten.
Van Swieten, der ab 1777 Präfekt der kaiserlichen Hofbibliothek war und zeitlebens als großer Kenner der Tonkunst, mitunter auch als „Patriarch der Musik“ gerühmt wurde, versammelte seit den 1780er Jahren in seiner Wiener Dienstwohnung namhafte Musiker in sonntäglichen Matineen, bei denen vorrangig Werke alter Meister, insbesondere Musik Johann Sebastian Bachs und Georg Friedrich Händels, gespielt und studiert wurden. An diesen Veranstaltungen der sogenannten Gesellschaft der Associierten Cavaliere nahm unter anderem auch Wolfgang Amadeus Mozart ab 1782 regelmäßig teil, den van Swieten ebenso protegierte wie später Ludwig van Beethoven. Im Rahmen der Matineen sollte Mozart erstmals in intensiven wie kompositorisch nachhaltigen Kontakt mit der Musik Bachs kommen. Auch Joseph Haydn stand in engem, langjährigem Verhältnis zu van Swieten, der (u. a.) für die Bearbeitung der Libretti zu den Oratorien Die Schöpfung und Die Jahreszeiten verantwortlich zeichnete. Nicht zuletzt widmete Beethoven dem Baron seine Erste Symphonie aus Dankbarkeit für die ihm zukommende Förderung – aber wohl auch aus strategischem Kalkül, wohlwissend um Stellung wie Einfluss van Swietens im damaligen Musikzentrum Wien.
Es ist sicherlich nicht übertrieben zu behaupten, dass van Swieten aufgrund seiner musikalischen Kompetenzen und mäzenatischen Netzwerke maßgeblich zur Konstruktion dessen beigetragen hat, was wir heute historiographisch (eingedenk aller terminologischen Schwierigkeiten) mit dem Begriff „Wiener Klassik“ bzw. als „klassische Trias“ bezeichnen. Entscheidend mit Blick auf die von van Swieten veranstalteten, an eine aristokratische wie intellektuelle Elite gerichteten Hauskonzerte ist die funktionale historische Verortung speziell der Werke Bachs und Händels in das damals zeitgenössische Verständnis von Musikgeschichte. In diesem Punkt konkretisiert sich die besondere Vermittlungsintention van Swietens. Entscheidend ist, dass er die Komponisten Bach und Händel als historische Instanzen installierte, an die er vor allem Haydn und Mozart kompositorisch anschließbar machen wollte – und zwar im Sinne einer wenn auch nicht fortschrittsgeleiteten, so doch geschichtlich folgerichtigen Stilentwicklung. Das in der Musikhistoriographie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts vielfach zu lesende Narrativ von einem heroengeschichtlichen Entwicklungsgang der Musik, welcher von Bach und Händel ausgehend unmittelbar zu den Wiener Klassikern führt, findet mit den Historischen Konzerten van Swietens eine der frühesten Vorbildungen. Kurz gesagt werden Bach und Händel – wohlbemerkt bereits in den 1780er Jahren – im Zuge der Swieten-Konzerte zu Vorläufern einer neuen Musikepoche inthronisiert, eben zu jener der sogenannten „klassischen Trias“. Hier vollzieht sich nicht weniger als die Konstruktion eines historiographischen Erbes, das in der Musikgeschichte für lange Zeit diskursmächtig wirken sollte.
III. Das Historische Konzert als musikgeschichtliches Korrektiv – François-Joseph Fétis
Mit den rezeptionsgeschichtlichen Folgen der „Wiener Klassik“ sind wir im „langen“ 19. Jahrhundert angelangt, und ich möchte als Beispiel eines Historischen Konzerts aus dieser Zeit auf ein bedeutendes Projekt des belgischen Komponisten und Musikschriftstellers François-Joseph Fétis eingehen. Ab dem Jahre 1832 organisierte Fétis in Paris zwei vielbeachtete Veranstaltungen: zum einen die Vorlesungsreihe Cours de philosophie musicale et d’histoire de la musique und zum anderen die damals weithin beachteten Concerts historiques. Das Neuartige und Aufsehenerregende dieser öffentlichen Konzerte war die Art und Weise der philosophisch-historischen Betrachtung, die sich in der methodischen Anordnung der Programme nach bestimmten Gattungen, Schulen, Nationen und Epochen niederschlug. Bemerkenswert ist, wie Fétis während der Planung und Durchführung der Konzerte mehr und mehr zu der Überzeugung gelangte, die bis dato vorherrschende musikalische Fortschrittsdoktrin anzuzweifeln.
Aus musikgeschichtlichem Interesse hatte er nicht nur die historiographischen Schriften eines Charles Burney und Johann Nikolaus Forkel gelesen, sondern auch ältere Kontrapunkt- und Harmonielehrbücher studiert. Im Zuge dessen war Fétis zu der Überzeugung gelangt, dass viele der vergessenen Kompositionen für ihn musikalisch gehaltvoller waren als die meisten Werke aus neuerer Zeit. Er beschäftigte sich daraufhin mit den Werken bedeutender Komponisten der Vergangenheit, bis zurück zur Musik der Trouvères und Troubadours, und erkannte, dass die ihnen zugrundeliegenden musikalischen Regeln variabel, weil je nach Ort und Zeit verschieden waren.
In seiner – unvollendet gebliebenen – Histoire générale de la musique, die Fétis 1869 begonnen hatte, erklärte er schließlich die europäisch-abendländische Musikgeschichte zu einer von vielen Entwicklungssträngen und entzog ihr damit den Status eines Paradigmas, an dem alle anderen Musikarten und -stile zu messen seien. Es war diese ästhetische Nivellierung historischer Unterschiede mit dem Ergebnis einer bis dato neuartigen Aufwertung älterer Musik bzw. einer Abwertung des stilistischen Fortschrittsnarrativs eurozentristischer Provenienz, die Fétis in seinen Historischen Konzerten als zentrale Bildungsintention klanglich zu vermitteln trachtete.
IV. Das Historische Konzert der Gegenwart und die Evidenz der klingenden Lebenswelt
Zum Abschluss möchte ich nochmals einen großen zeitlichen wie räumlichen Sprung machen – dieses Mal vom Paris des 19. zur amerikanischen Ostküste des 20. Jahrhunderts. Damit komme ich wieder zurück zum Ausgangspunkt meiner Vorbemerkung. In meinem letzten Beispiel für ein Historisches Konzert widme ich mich den Anfängen einer angewandten Vermittlung von Musikgeschichte mittels des damals noch jungen Mediums Fernsehen. Den Beginn dieser Entwicklung bildet – wie bereits angedeutet – Leonard Bernstein, den ich hier allerdings nur kurz anführen möchte. Vielmehr geht es mir im Folgenden um die Frage, welche gegenwärtigen Konzepte des Historischen Konzerts es eigentlich gibt und wie musikhistorische Bildung in Zeiten aktueller Vermittlungsdebatten aussehen kann.
Ein überaus erfolgreiches Format bildet in diesem Zusammenhang die Fortführung der von Bernstein initiierten Young People’s Concerts. In New York war in den 2000er-Jahren der Dirigent Delta David Gier mitverantwortlich für die Konzeption dieser Konzerte. Es ist für mein Thema aufschlussreich nachzuvollziehen, wie Gier und seine Mitstreiter des New York Philharmonic Orchestra das Format derart modernisiert haben, dass es beständig eine große Zielgruppe von Kindern wie Erwachsenen ansprach und noch immer anspricht. Zu fragen wäre, wie das Erfolgskonzept dieser Aktualisierung musikhistorischer Bildung umrissen werden kann.
In einer Ankündigung der Konzertreihe für das Jahr 2009 hat Gier einen Teil der Programme wie folgt erläutert: „In jedem der vier Konzerte […] haben wir dieses Jahr vier verschiedene Aspekte, die wir durch die Musik vermitteln möchten. Das erste Konzert widmet sich zum Beispiel dem Thema ,Musik zum Tanz‘. Das Element […] ist Rhythmus, und wir werden gemeinsam einen Weg durch dieses Programm beschreiten, das von Bach bis hin zu Steve Reich reicht – und vielleicht noch darüber hinaus. Es soll darum gehen, wie der Rhythmus Teil unseres täglichen Lebens ist, von unserem Herzschlag bis hin zur Art und Weise, wie wir gehen. […] Es geht darum, welche Rolle der Rhythmus in all diesen verschiedenen Musikstilen und -epochen spielt. Wir beenden dieses Konzert mit dem Bolero von Ravel – der eine Art ultimatives Rhythmusstück ist.“
Der Vermittlungsansatz, den Gier hier am Beispiel eines der Konzerte skizziert, kann als repräsentativ für die Gestaltung der gesamten Serie gelten. Zentral ist dabei der Versuch, auf Basis eines übergeordneten musikalischen Themas, wie hier dem Zusammenspiel von Musik und Tanz bzw. Rhythmus und Bewegung, anschauliche Beispiele aus der Musikgeschichte auszuwählen und diese zur Grundlage eines klingenden Bildungstransfers zu machen – eines Transfers, der darauf abzielt, ein Bewusstsein für die Musik im Sinne ihrer ästhetischen Äquivalenz bzw. Übertragbarkeit auf ganz alltägliche Phänomene wie dem großstädtischen Klangrhythmus zu schaffen. Die Kinder und Jugendlichen werden durch die Konzerte dafür sensibilisiert, ihre eigene Lebenswelt als eine klingende wahrzunehmen und diese Erfahrungen wiederum im Rahmen neuer Konzerterlebnisse einzubeziehen. Dieser phänomenologisch basierte Ansatz, der auf eine sinnstiftende Beziehung zwischen der eigenen Biographie und der tönenden Umwelt abzielt, scheint mir gegenwärtig einer der Hauptstränge der Vermittlungskonzepte Historischer Konzerte zu sein und den Erfolg der Formate bei einem nicht allein jüngeren Publikum mitzuerklären.
Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt. Wichtig ist mir, abschließend nochmals auf das verbindungsstiftende Motiv meiner verschiedenen Fallbeispiele hinzuweisen: und zwar auf das übergreifende Anliegen, mittels der Selektion eines bestimmten Musikrepertoires auf übergeordnete geschichtliche, historiographische und/oder ästhetische Sachverhalte aufmerksam zu machen. Sei es die Vermittlung einer spezifisch konfessionellen Musikhistorie wie 1643 in Nürnberg oder die Konstruktion eines musikgeschichtlichen Erbes der „Wiener Klassik“ durch van Swieten, die Aufwertung alter Musik im Sinne eines historiographischen Korrektivs wie bei Fétis oder die Starkmachung eines Sinnbezugs zwischen den Werken der sogenannten „klassischen“ Musik und der eigenen Lebenswelt in heutigen Formaten des Historischen Konzerts – in all diesen Beispielen geht es letztlich um die Mitteilung einer Bildungsidee qua Geschichtsrekurs, genauer gesagt: um eine tönende Vermittlung von Musikgeschichte, die in ihrem Verklingen Vergangenheit erfahrbar macht und damit in mehrerlei Hinsicht mit Sinn erfüllt.
[Kai Marius Schabram, April 2025]