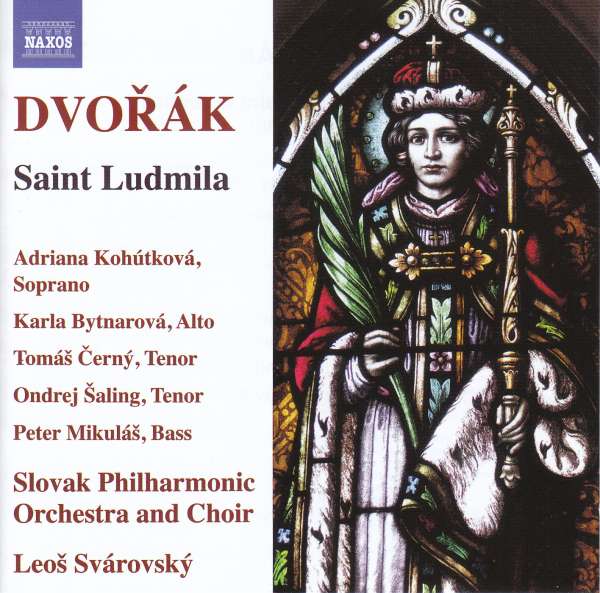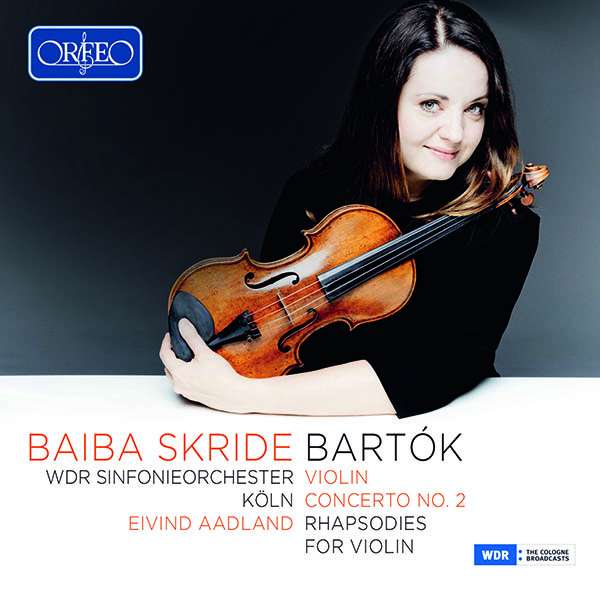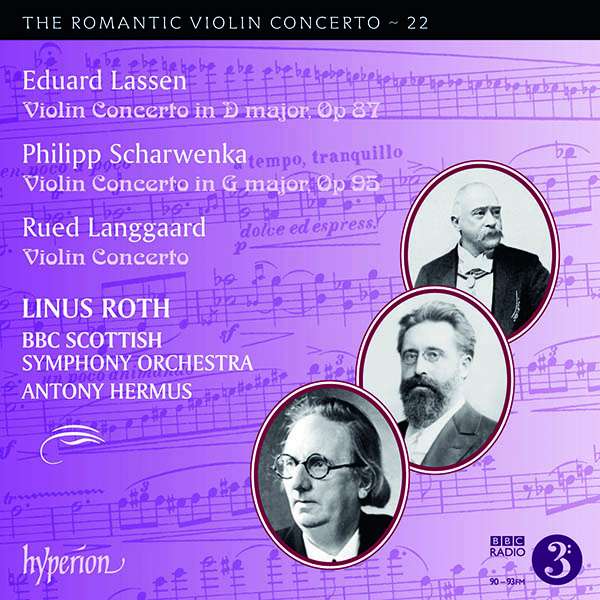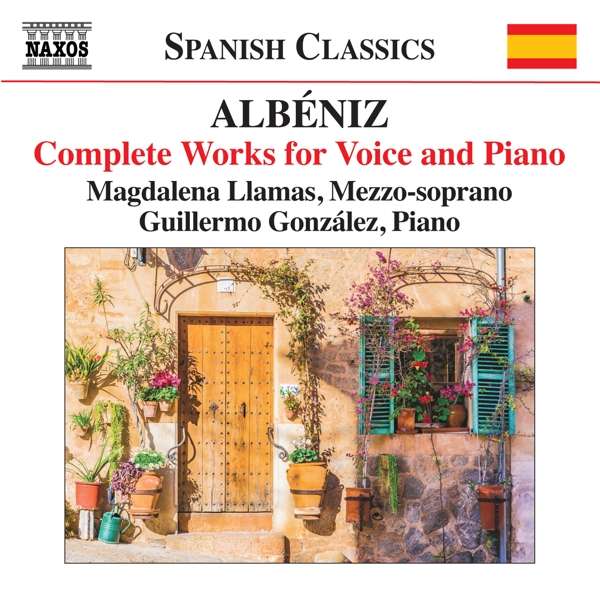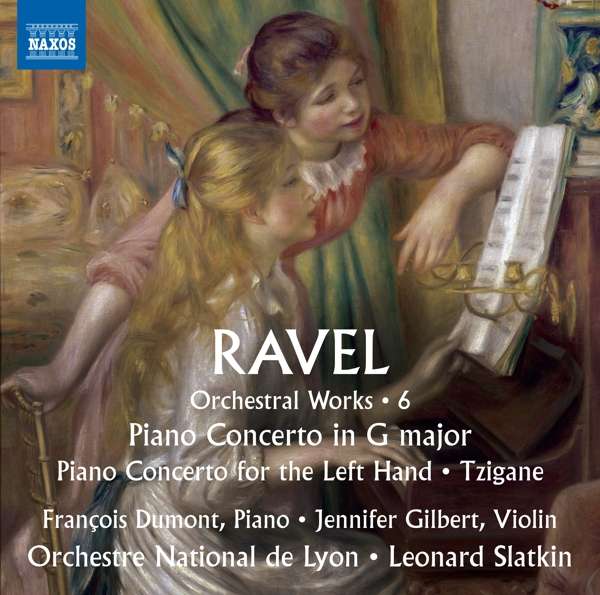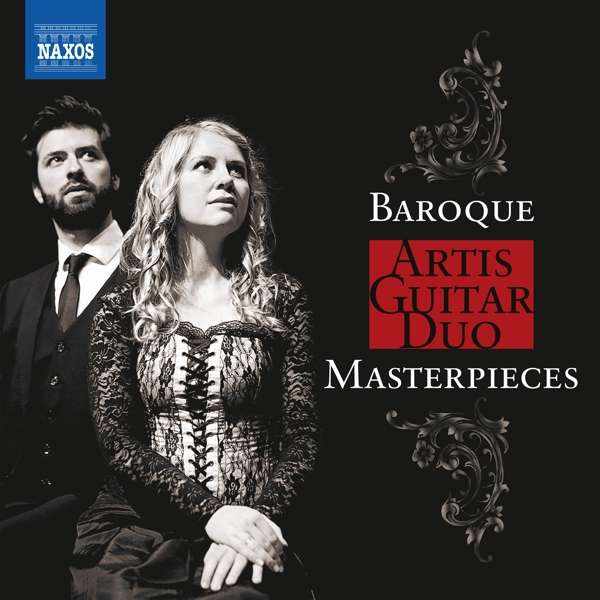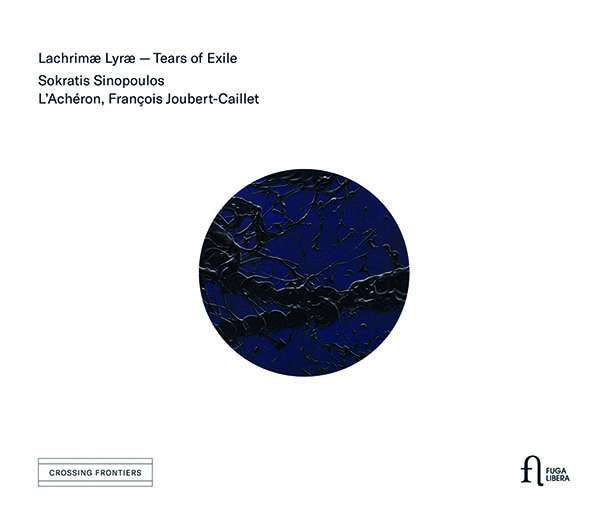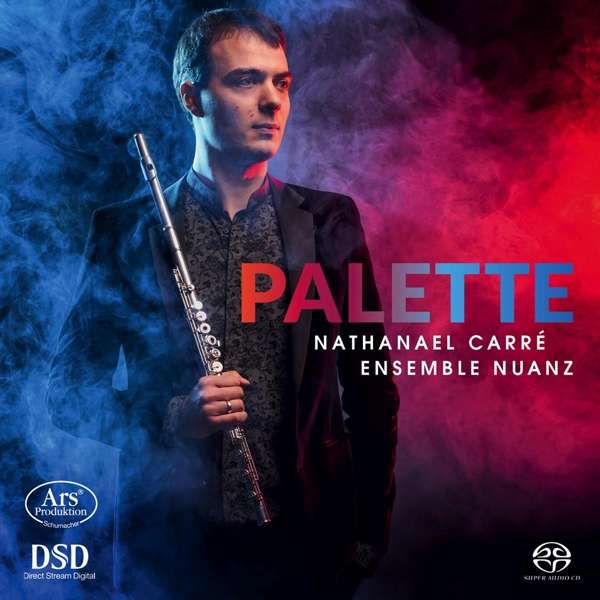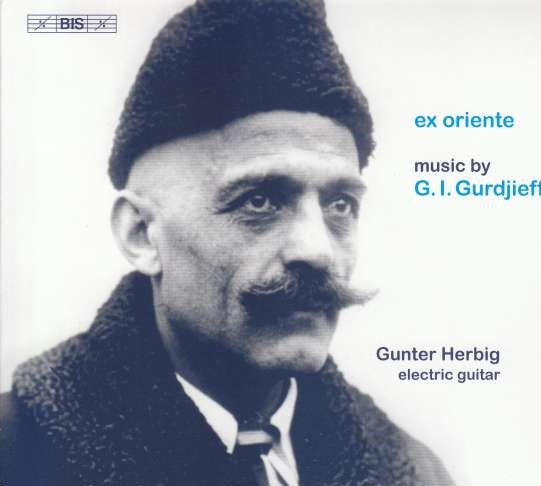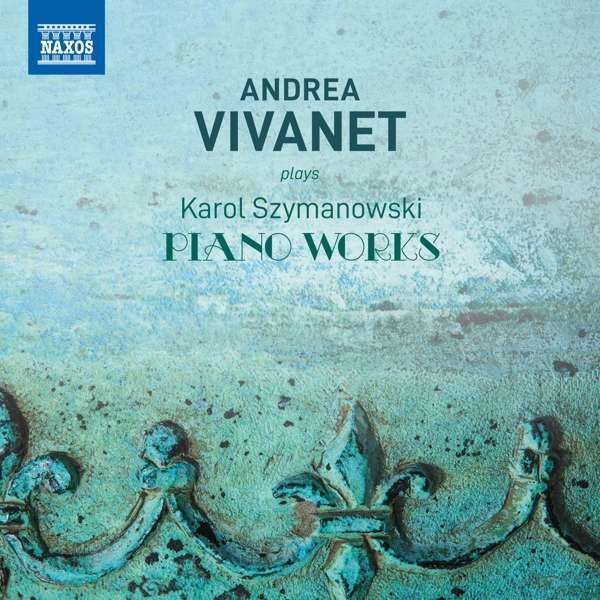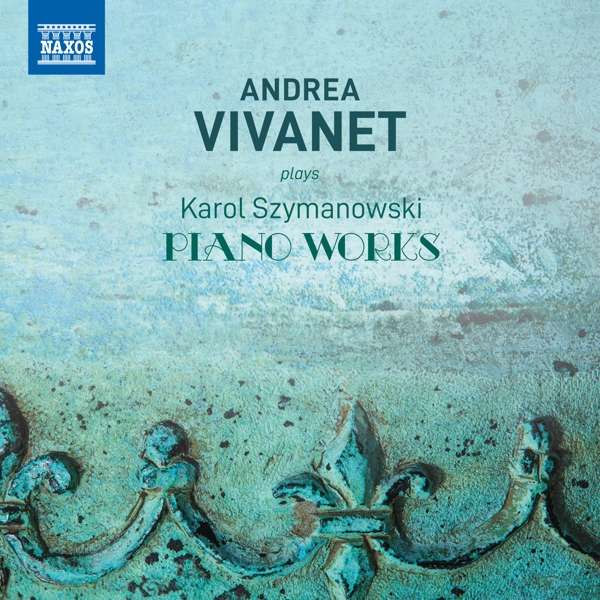Nathanael Carré geht seinen
eigenen Weg, wenn er seine Lieblingstücke für das Ensemble Nuanz neu arrangiert
Der Flötist Nathanael Carré holt unverbrauchtes, seltenes Repertoire aus der Versenkung und taucht scheinbar bekanntes in leuchtende Farben eines virtuosen Neuarrangements. So hat er aus den Klavierparts der Kompositionen von Gabriel Fauré, Jean Francaix, Jacques Ibert, aber auch selten gespielten Stücken von Georges Hüe, Paul Taffanel, André Jolivet oder Francois Borne etwas neues gemacht, nämlich kunstvoll differenzierte Orchestrierungen für das hellhörig aufspielende, von ihm im Jahr 2015 gegründete Ensemble Nuanz. Vereint sind hier die beiden Geiger Evgeny Popov und Alexander Jussow, Jan Melichar und Robin Porta an den Violen, der Cellist Jan Pas sowie Stefan Koch-Roos am Kontrabass.
Carrés profunden Erfahrungen als Orchestermusiker und Dirigent ist zu verdanken, dass er die einstigen Klavierparts in wirkungsvolle orchestrale Dimensionen hinein ausgeweitet hat. Alleinstellungsmerkmale finden, Klischeevorstellungen konterkarieren: Das ist die Devise des jungen Franzosen, der gerne mal das Spezialistentum von Wettbewerbsjurys fröhlich ignoriert und sich stattdessen über Crowdfunding-Kampagnen des Publikumserfolges und über seine Unabhängigkeit versichert. Auch über eine aufgeklärte künstlerische Haltung sprach er mit Stefan Pieper.
Herr Carré, Sie haben gerade
ein sehr ungewöhnliches Video veröffentlicht. Sie öffnen Ihren Flötenkoffer und
entnehmen ihm Farbe und Pinsel, beginnen zu malen. Welche Farben wollen Sie mit
dem Repertoire dieser CD kreieren?
Das Ziel war, zu zeigen, dass
die Palette französischer Musik viel breiter als Debussy und Ravel ist. Hier
gibt es doch so viele Klischees, die dringend überwunden werden müssen. Ich
musste sogar die Erfahrung machen, dass selbst manche Wettbewerbsjury von
Klischees dominiert ist: Als ich dort mal die Sonate von Poulenc spielte, wurde
mein Spiel abqualifiziert, der dritte Satz höre sich „unschön“ und wie
Straßenmusik an. Aber genau darum geht es doch hier! Nicht alles, was aus
Frankreich kommt, klingt wie Daphne oder Syrinx. Viele Menschen glauben,
französische Musik ist wie Chanel Nr 5. Georges Hüe kennt doch auch kaum
jemand, aber es ist eine berückende Musik. Oder betrachten wir André Jolivets
„Fantaisie Caprice“ – dieses Stück baut auf einer modalen Skala auf, die von
der balinesischen und afrikanischen Musik dominiert ist.
Sämtliche Stücke der neuen CD
sind im Original bzw. ihrer Ursprungsversion für Soloflöte und Klavier
geschrieben. Was für neue Aspekte wollen Sie aus den Kompositionen heraus
holen, wenn Sie sie einem Streichensemble auf den Leib geschrieben haben?
Ich wollte den Rahmen ausweiten.
Sechs Streichinstrumente erzeugen viel mehr Dynamik. Entsprechend entfaltet
sich das Stimmengeflecht der Kompositionen noch weiter. Außerdem wird das
Gefüge reicher, weil auf einmal sechs Menschen ihre ganze Sichtweise in die
Sache einbringen. Alles wird
transparenter und damit einfacher, die Musik als Ganzes zu verstehen. Die
Linien werden weiter ausdifferenziert. Jeder kann musikalisch seine Phrase
gestalten und ein größeres Ganzes kreieren, wo jede Stimme ihre Kraft hat. Mein
Dank gilt nicht zuletzt meiner Frau, die mich zur Verwirklichung der Idee
dieses französische Repertoire neu zu arrangieren ermutigt hat!
Herr Carré, kann es sein,
dass Sie in der schnöden Konnotation des Klavierparts als Begleitung eine
Diskriminierung sehen?
Musik wird erst lebendig, wenn
man aus einer rigiden Rolle heraustritt. Wenn ich verantwortungsvoll musiziere,
dann fokussiere ich mich ja auch nicht auf meine eigene Solostimme, sondern
konzentriere mich vor allem auf meinen Gegenpart. Schon meine Mutter, bei der
ich die ersten musikalischen Gehversuche machte, hat mich immer aufgefordert,
bei Lernen eines Stückes auf den Klavierpart zu hören. Wer dieses Prinzip
wirklich ernst nimmt, kann viel tiefer in die Musik eintauchen. Umso mehr wird
das Ganze erfahrbar und es gelingt, den Sinn des Komponisten weiterleben und
sprechen zu lassen.
Also ist Musizieren für Sie
vor allem eine Kunst des Zuhörens?
Ich möchte mit meiner Energie
und Persönlichkeit alles entfalten, was in der Musik enthalten ist. Musizieren
hat immer etwas mit höchster Aufmerksamkeit zu tun und ist ein Spiel mit der
Energie der anderen Musikern und des Publikums. So kann jedes Konzert
einzigartig werden. Durch diese Symbiose können tiefe Emotionen erreicht
werden.
Wie wird Ihr eigenes Spiel
durch die erweiterte Besetzung beeinflusst? Was ist anders, als wenn Sie mit
einem Klavier zusammen musizieren?
Diese Neuarrangements sind eine
sehr komplexe Kammermusik geworden. Jede Stimme ist anders. Es gibt keine
Wiederholungen. Ebenso muss ich kräftiger spielen, wenn ich sechs Instrumenten
gegenüber stehe. Außerdem muss ich dirigieren phasenweise. So etwas braucht im
Konzert deutlich mehr Energie. Meine Aufmerksamkeit ist überall gefordert.
Diese Kammermusik ist dreidimensional.
Der Klassikmarkt ist
übersättigt mit viel Standard-Repertoire, das sich wiederholt. Wenn Sie hier
etwas neues anbieten, ist es schwer, sich damit öffentlich durchzusetzen?
Ich habe mich immer sehr frei
gefühlt und es geht mir einfach nur darum, etwas Gutes und Interessantes
anzubieten. Es muss nicht unbedingt bekannt sein dafür. Für meine Debüt-CD habe
ich zum Glück ein Label gefunden, dass sehr offen für ungewöhnliche, zugleich
hochqualitative Projekte ist. Das Publikum war bisher sehr begeistert. Warum
soll ich etwas aufnehmen, was schon viele andere aufgenommen haben? Wenn es um
Standardrepertoire geht, kaufen die Leute doch von vornherein die Einspielung
mit dem prominenteren Namen. Da konzentriere ich mich lieber auf eigene
Projekte, die mir Spaß machen und finde meine eigene Richtung. Nur so kann ich
eine echte künstlerische Persönlichkeit entwickeln. Dieses Projekt liegt mir
auch besonders am Herzen, und ich wollte davon eine Spur in der Musikwelt
hinterlassen.
Es wird ja überall getönt,
dass die CD tot ist. Warum produzieren Sie und alle Ihre Kollegen weiterhin so
viele CDs?
Allein, weil es ohne CD schwer
ist, Konzerte zu bekommen. Man muss einfach eine CD machen! Sie ist und bleibt
ein Türöffner.
Welche Rolle haben
Wettbewerbe für Ihre Karriere gespielt?
Als Student hatte ich den
Wunsch, internationale Wettbewerbe zu machen. Sie werden als einfache Autobahn
zum Erfolg angesehen. Wer einen Wettbewerb gewinnt, bekommt ein paar Konzerte
und kann oft kostenlos eine CD aufnehmen. Ich selbst bin aber kein
Wettbewerbstyp – mein Profil deckte oft nicht die Vorlieben der ganzen Jury ab.
Deswegen musste ich einen anderen Weg finden: So habe ich eine Stelle im
Orchester bekommen und mich weiter als Künstler entwickelt. Das hat meine
Kreativität und Unabhängigkeit gestärkt.
Sie gehen aktuell einen sehr
modernen Weg, um sich über Crowdfunding ein Feedback über den eigenen
Publikumserfolg einzuholen. Wie kam es dazu?
Das hatte erstmal rein
praktische Gründe. Für dieses Projekt brauchte ich eine finanzielle
Unterstützung. Es ist auch eine interessante Möglichkeit, das Interesse an
meinem Projekt zu prüfen – obwohl ich schon sehr sicher über den Wert meiner
Arbeit war. Aber ich bin sehr dankbar, dass mich so viele Leute übers Netz und
darüber hinaus privat unterstützt haben.
Das Grundprinzip ist ja einfach:
Es geht darum, Menschen zu überzeugen. Keine Spezialisten-Jury, sondern ein
Publikum.
Ich habe mich immer um eine gute
Vernetzung mit vielen Menschen bemüht. Und gerade, weil ein Crowdfunding viel Netzöffentlichkeit
herstellt, ist es ein guter Weg, an mehr junges Publikum heran zu kommen. Das
Prinzip einer solchen Präsentation ist es, ein konkretes „Produkt“ anzubieten
und dafür Begeisterung zu wecken. Natürlich ist es wichtig, mit künstlerischer
Qualität zu begeistern und nicht mit kommerzielle Methoden.
Was muss ein gutes Produkt
ausmachen?
Wir leben in einer Zeit, in der
neue Erfahrungen wichtig sind. In jeder Werbung werden diese „neuen
Erfahrungen“ ja auch versprochen. Man muss aber zugleich etwas hervor bringen,
was qualitativ hervorragend ist. Das ist dringend nötig, um der klassischen
Musik ein neues Publikum zu bringen. Ich begegne immer wieder Menschen, die
keinen speziellen Bezug zur Musik haben, aber doch sehr neugierig sind. Es geht
darum, auch den Nicht-Spezialisten etwas zu bieten, was deren Erwartungen
übertrifft.
Welche persönlichen Ideale
verbergen sich dahinter?
Es gibt in unserer Gesellschaft
viele menschliche und geistige Einsamkeit. Die Musik, live erlebt, hat die
Kapazität, Menschen zu sammeln und in eine andere Sphäre zu bringen. Eine
Sphäre, die weit von Materialismus und menschlichen Sorgen entfernt ist. Jeder
Mensch hat das tiefe Bedürfnis, etwas mit anderen Menschen zu erleben und
teilzunehmen.
Was ist Ihr Zukunftsplan?
Die Arbeit mit größeren
Kammerensembles, aber auch Orchestern fasziniert mich sehr. Deswegen studiere ich aktuell auch das Dirigieren. Vor
allem möchte ich jetzt mit meinem Ensemble Nuanz und diesem Programm und später
mit anderem Repertoire möglichst viele Konzerte spielen. Ich wünsche mir, dass
ein breites Publikum diese wunderbare Musik erleben kann!
CD: Palette; Nathanae Carré, Ensebmle Nuanz – ARS Produktion 2019
Interview geführt von Stefan
Pieper, September 2019
.