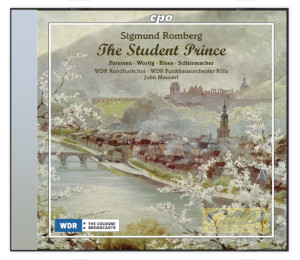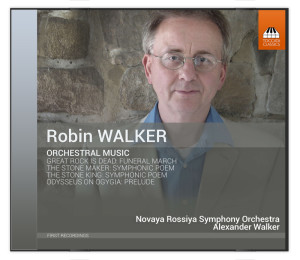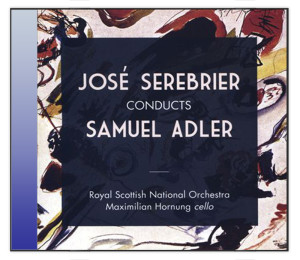Sigmund Romberg: „The Student Prince“
Dominik Wortig Tenor; Anja Petersen Sopran; Frank Blees Bass-Bariton; Arantza Ezenarro Sopran; Vincent Schirrmacher Tenor; Wieland Satter Bass-Bariton; Joan Ribalta Tenor; Theresa Nelles Sopran; Christian Sturm Tenor
WDR Rundfunkchor Köln; WDR Funkhausorchester Köln; Leitung: John Mauceri
Aufnahme: 18.-22.07. 2012, Köln, Klaus-von-Bismarck-Saal
cpo 555 058-2; EAN: 761203505821
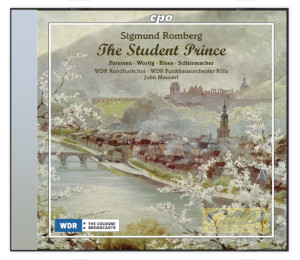
Wem in Deutschland sagt der Name „Sigmund Romberg“ oder dessen Werkes Name: „The Student Prince“ etwas?
Vielen vermutlich: nichts!
Es handelt sich um eine Broadway-Operette, die in einem vergangenen Deutschland spielt. Der Kronanwärter eines fiktiven Königreiches beschließt, wohlberaten, seine Jugend im studentischen Milieu auszukosten – vulgo: sich die Hörner abzustoßen.
In Heidelberg!
„Lange lieb‘ ich dich schon, möchte dich, mir zur Lust,
Mutter nennen, und dir schenken ein kunstlos Lied,
Du, der Vaterlandsschönste
Ländlichschönste, soviel ich sah“
…
Sträuche blühten herab, bis wo im heitren Thal,
An den Hügel gelehnt, oder dem Ufer hold,
Deine fröhlichen Gassen
Unter duftenden Gärten ruhn.“
… schrieb Hölderlin, der, wie wohl jeder, der einmal dort war, dem Charme dieses Städtchens erlag. Der Ort, so lieblich am Neckar gelegen, umsäumt von Wald und Berg, gekrönt von einer Ruine aus alter Zeit – wie kann der nicht verzaubern?
Heidelberg! Ein Topos heiterer Heimatlichkeit. Samt jokoser Studentenschaft, Frühlingsstimmung pubertärer Gelauntheit und dem tief schwelenden Gefühl der Zuversicht: hier ist es gut und so wird es bleiben!
Nun bequemt sich also der Thronanwärter in diese magische Stadt und verliebt sich in eine fesche Gastwirtin, die seine Gefühle erwidert. Es kommt, wie es kommen muss: des Prinzen Opa scheidet dahin, der Prinz wird König mit allen Verpflichtungen – samt standesgemäßer Ehe -, wie es das Amt gebeut. Aber er schwelgt in Sehnsucht nach der unbeschwerten Heiterkeit und Jugend in Heidelberg mit saufseligen Kumpanen und: seiner immer noch geliebten Cathy.
Es gibt ein Rendezvous. Prinz Karl-Franz und seine Cathy begegnen sich erneut, beide aber in der Einsicht, dass die Tage der unbeschwerten Jugend vorbei sind und jeder der beiden, einen eignen Weg – vielleicht nicht des Glückes, aber der Bequemlichkeit – beschreiten werden.
Kitschig? Klingt nach einer Schlicht-Version von Fontanes „Irrungen, Wirrungen“.
Tatsächlich fußt das Werk auf dem tränenseligen Theaterstück von Herren Meyer-Förster, das 1901 seine Premiere erlebte und bis in die 1920er ein großer Erfolg war. Nötig zu sagen, was Brecht darüber dachte?
Romberg, entgegen der Vorlage, verfällt nicht dem Naheliegenden: aus dem Stoff eine sentimentale Geschichte zu zimmern mit Schmacht, Tränen und Sehnsucht nach verflossenem Glück.
Frisch, heiter und mit Zunder geht es da zu! Gefühlvolles kommt nicht zu kurz, wird aber keineswegs über Gebühr breitgetreten. Studentischer Marsch wechselt sich ab mit Dreiviertelseligkeit. Immer klar im Klang, bewusst der zu erzeugenden Stimmung. Hörbar einem „deutschen“ Klangideal verpflichtet. Da ist noch gar nichts von schmalzübergossenem Broadway zu hören. Schlank und sinnlich breitet sich alles dem Hörer dar.
Romberg: er schüttet kein Füllhorn an musikalischen Ideen aus, vielmehr vertraut er auf einige Linien, die er variierend präsentiert, dass diese sich, wie der bekannte Wurm, in‘s Ohr bohren.
Was bleibt außer: ein ganz großes Lob, als den Pour-le-Mérite- an das ganze Ensemble zu vergeben für ein rundum-gelungenes Vergnügen?
Das kleine Nichts, was dieses Stück nun mal ist: es wird mit Freude und Können dargeboten. Keinen Moment fällt man in die so wohlfeile Gefühl-Falle. Im Gegenteil: diese „Sachlichkeit“ wertet auf.
Rhythmisch sicher – das Orchester, seiner Farben bewusst.
Der Chor: Glanzleistung!
Das Funkhausorchester Köln, nun auch weit über Nordrhein-Westfalen hinaus bekannt unter der Ägide von Wayne Marshall, versiert im Gerne der vermeintlich leichten Muse, vollbringt hier Großes.
Herrn John Mauceri als Leiter unterläuft kein Fehler.
Vokal: Frau Petersen, deren schlanke Stimme so sehr passt und den warmen Tenor von Herrn Wortig im Duo hell und klar umrankt!
Romberg schreib keine Musikgeschichte. Aber ein kleines, sympathisches Stück, das – wenn es wie hier so anrührend in leidenschaftlicher Perfektion gegeben – mehr als lässliche Nichtigkeit daherkommt.
Das Ganze: kein Eskapismus – nur Gedenken an das Vergangene. Erinnerung, die im Leben jeden Tag mehr und mehr die Zukunft frisst und das Gewesene über Maß vergoldet.
Beckmesser: Libretto im Booklet…Essig! Nun aber ist das Ganze auf Englisch gesungen! Da bedarf es doch eines nachvollziehbaren Textes! Mutmaßlich dürften die Rechteinhaber auf zu viel Entgelt bestanden haben. Diese „geldige“ Zielsetzung wird der weiteren Verbreitung des Stückes indes wenig helfen – und damit den potentiell Begünstigten selbst.
Volle Punktzahl! Für das ganze Ensemble. Eine seltene Freude!
[Stefan Reik, November 2016]
P.S. Es existiert eine Filmversion des Stoffes von Ernst Lubitsch. Verfügbar im Netz – und sehr sehenswert.
Bestellen bei jpc