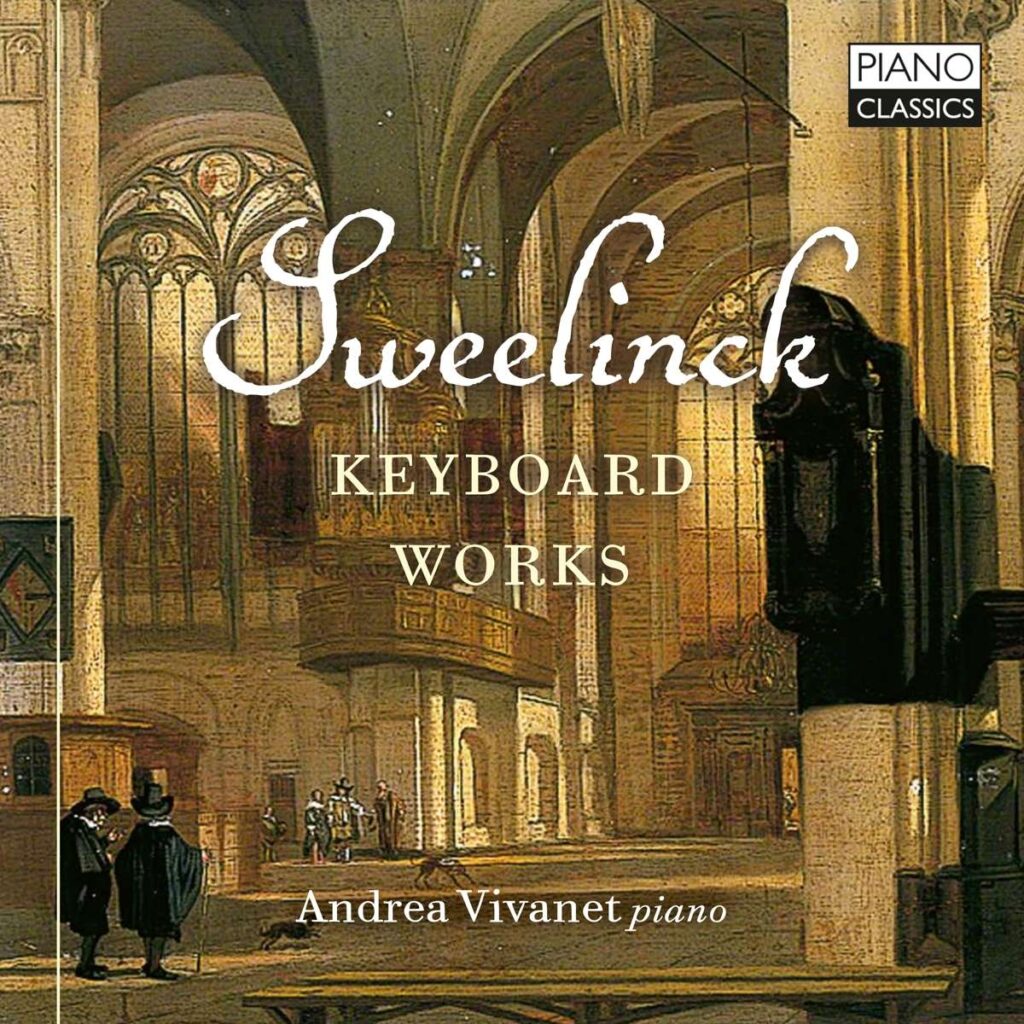Ein kurzer, nicht abschließender Bericht aus Wien in der Vorweihnachtszeit.
Die Inszenierung und Aufführung von Monteverdis Oper Il ritorno d’Ulisse in Patria in der Wiener Staatsoper war eine bunte und traurige Angelegenheit.
Eine Personenführung fand nicht statt, wo und wohin die Sängerinnen und Sänger sich bewegten, schien ratloser Willkür zu folgen, die teilweise schönen Stimmen waren im Vorfeld wohl nicht an die Klangwelt der Musik von Monteverdi herangführt worden; so blieb Penelope blass, auch Ulisses entfaltete keine stimmliche oder stilistische Strahlkraft, da die Regie aus ihm eine Karikatur des Monsieur Bonacieux aus der legendären Musketier-Verfilmung von Richard Lester aus dem Jahr 1973 machte (es gab also wenigstens eine Idee?), einzig Isabel Signoret als Minerva konnte wirklich darstellerische und stimmliche Präsenz entfalten. Erfreulich war auch das Trio der Freier von Penelope, die mit ihrer Stimmschönheit aber eher bei La Bohème ein Genuss zu hören wären, hier aber stilistisch nicht am rechten Platz waren.
Das Bühnenbild war ein sinnfreies Caroussel einer größeren Anzahl Sitzgruppen – den Göttern waren dabei originellerweise die Firstclass-Sitze eines Flugzeugs vorbehalten. Der Concentus Musicus als Platzhalter der Alten Musik in Wien lebt noch von der Vergangenheit: matt kam die Musik aus dem Graben, trotz der fordernden Gestik des musikalischen Leiters Stefan Gottfried, oder gerade wegen ihr: sie war zu viel des Guten, nicht am Metrum oder Takt, sondern meist am melodischen und rezitativischem orientiert; eine klare Eins hätte hier und da geholfen, und das Tastencontinuum wurde ja ohnehin von jemand anderem gespielt, was sein Wechseln vom Gestischen zum Tastenspiel in mindestens sportlichem Licht erschienen ließ.
Vielleicht ist es im Ganzen keine gute Idee, in einem Repertoirehaus solche Projekte in den Spielplan zu quetschen; möglicherweise gibt es einfach keine Zeit für eine der Sache Monteverdis angemessene gründliche Arbeit, um die Mühen der Freier, den Bogen zu spannen, nicht zu einem derartigen Klamauk verkommen zu lassen.
Stimmig und gefasst war alles erst am Ende mit dem Auftritt des Chores und dem abschließenden, innig gesungenen Duett von Penelope und Ulisses, die endlich ganz bei sich waren, wunderbar eingeleitet und gestützt vom Chor.
Der gewohnheitsmäßige Jubel erinnerte daran, welch herrliches Haus die Wiener Staatsoper im Bewusstsein seines Publikums dennoch ist und bleibt.
Den odysseischen Bogen vergeblich zu spannen versucht hat auch Klaus Mäkelä, umjubelter und gleichzeitig, da man nicht nur in Wien beginnt, dem Braten nicht mehr zu trauen, skeptisch und irritiert zur Kenntnis genommener Chefdirigent einer Handvoll internationaler Spitzenorchester bei seinem Debut mit den Wiener Philharmonikern. Gespielt wurde die Sechste Symphonie von Gustav Mahler.
Diese zweite seiner großen Instrumentalsymphonien überbordet vor tief empfundenen Einfällen, entbehrt aber größtenteils einer geschlossenen Form; speziell im langsamen Satz und im ausufernden Finale tritt dies als Schwäche zutage. Dieses weiß dann so gar nicht, wo es eigentlich hinwill, bis der erste Hammerschlag daran erinnert, welchem Umstand die Symphonie ihre Berühmtheit verdankt.
Der Schlag des Schicksals wurde hier allerdings geschönt, da man zwar zur Ausführung einen optisch spektakulär großen Holzhammer wählte, der, wie von Mahler vorgesehen, jedoch nicht, wie in der Partitur gefordert, „wie ein Axthieb“ wirkte und sich zu homogen in den Gesamtklang einfügte. So blieb es hier eher bei einer Visualisierung jenes Dramas, das eigentlich musikalisch hätte wirken sollen.
Und damit sind wir bei Klaus Mäkelä, auf den diese Beobachtung ebenso zutrifft. Als Kind seiner Zeit ist seine Gestik einfach und klar impulsorientiert. Eine dirigentische Schlagfigur, die ursprünglich den Sinn hat, über einen einfachen Impuls hinaus eine Phrase musikalisch zu ordnen und ihr eine weiterführende Perspektive zu verleihen, sucht man vergebens, und was wie Frische und Spontaneität juveniler Gefühlswelt erscheint, entpuppt sich bald als durchchoreographierte Pose.
Bereits nach der ersten rhythmisch geprägten Phase des ersten Satzes hat Mäkelä denn auch seine Geschichte auserzählt. Seine gestische Spezialität sind Akzente im tiefen Register, die er mit publikationswirksamem Nachwippen seines Kopfes, dem der Sinn für etwas darüber Hinausgehendes fehlt, unterstreicht. Gestus ohne Ductus, Augenblicksgewerkel ohne Ziel, Plan und Weitsicht, und ohne Idee für die sich ausbreitende Klangfläche einer Symphonie, die aufgrund ihrer Komplexität eine andere Herangehensweise benötigen würde.
Auch rein kapellmeisterlich ist Mäkelä der Aufgabe an manchen Stellen überraschenderweise nicht gewachsen: Bei diversen Tempowechseln im 3. Satz überlässt er das Orchester sich selber, da er nur mitschlägt, statt ein neues Tempo vorzubereiten, was aber schon zum Handwerk jedes 2. Kapellmeisters eines Provinzopernhauses gehört. Das Orchester reagiert instinktiv, so dass diese Momente kaum merklich vorbeigehen.
Es fehlt hier schlicht an einer geistigen Einstellung, die über die Wiedergabe der äußerlichen Effekte der phänomenal instrumentierten Partitur hinausgeht, vielleicht aber einfach an Bedarf und Interesse, oder auch an einer sorgsamen Ausbildung, die ihn über diese elementare Ebene hinaus orientiert hätte. Wer sich als Hörer am Klangspektakel berauschen mag, wird es zufrieden sein. Für alle anderen ist es schwer, diese Leere auszuhalten.
Es wäre nicht weiter tragisch, und hier liegt ein grundsätzliches Problem, wäre Mäkelä als Dirigent nicht Protagonist einer Generation junger, künstlerisch unbedarfter und mehr und mehr austauschbarer Dirigentinnen und Dirigenten; mithin schon jetzt ein Vorbild für einen Nachwuchs, für deren komplexe Profession er künstlerisch keine Perspektive aufzeigt, die über eine möglichst gute Wirkung auf Photos und Videoclips und einen damit gesteuerten Hype hinausgeht; ganz zu schweigen vom Publikum, das auf diese Weise von der Tiefe und unbedingten Wahrhaftigkeit der Mahler’schen Musik entweder entwöhnt wird, oder gar nicht erst mit dieser Tiefe der musikalischen Empfindung in Berührung kommt.
Es entbehrt nicht der Ironie, dass diese Dimension des menschlich-künstlerischen Ausdrucks, die Mahler durch seine unerreichte, aber doch sehr leicht als vordergründig misszuverstehende Kunst der Orchesterbehandlung erst möglich gemacht hat, hier als krachendes Orchesterspektakel von Mäkelä geradezu konterkariert wird.
Wo ist das Logentür-schmeißende, „Scandalo“-rufende Fachpublikum, für das Wien einst berühmt war? Stattdessen erfährt man in einer Pressenotiz im Internet, dass Mäkelä mit Freunden, Familie und seiner derzeitigen Freundin nach dem Konzert im Hotel Imperial speiste.
Neulich huschte ein Interview mit Egon Wellesz, der Mahler in seiner Jugend als Dirigenten erlebt hat, durch die sozialen Medien. Nach seinem Zeugnis waren Mahlers Dirigierbewegungen zurückhaltend und funktionell, fast benutzte er nur die rechte Hand, die linke fast nie, und er gebar sich keineswegs so wild, wie man es sich angesichts der berühmten Scherenschnitte von Otto Böhler vorstellen mag (Celibidache nannte ihn, Mahler, mehrfach den besten Dirigenten aller Zeiten). Diesem Beispiel zu folgen wäre eine andere Empfehlung für den Nachwuchs. Ein anderes kürzlich aufgetauchtes Video zeigt Otto Klemperer, wie er im hohen Alter die Siebte von Beethoven dirigiert. Dreht man den Ton ab, hört man trotzdem, was gemeint ist.
Als Chef großer Orchester ist jemand wie Mäkelä folglich nur geeignet, wenn er sich mit seiner Popularität für die Sicherung der Finanzierung und Marktbeteiligung der jeweiligen Institution einsetzt, und dafür im Gegenzug durch häufige Abwesenheit glänzt, da ansonsten der Klangkörper zwangsläufig leiden muss.
Wie gesagt, Mahlers Sechste ist ein sehr schwieriges Werk, und seine Kohärenz darzustellen ist nicht nur eine große Herausforderung, sondern auch die ureigenste Aufgabe eines Dirigenten. Eben darum gilt es, durch Verständnis für Gestalt und Form, aus dem alleine die künstlerische Aussage eines Werkes zum Leben erweckt werden kann, den odysseischen Bogen zu spannen. Dazu reichte es bei Mäkelä aber nicht. Es ist ein Scheitern, und das nicht einmal auf hohem Niveau.
Dirigierkarrieren starten früh und geben einer notwendigen Entwicklung, abgesehen von einer kommerziellen, kaum einen Raum. Die Ausbildung scheint vor allem intellektuell verkürzt und auf das Praktisch-Pragmatische und Persönlich-Willkürliche beschränkt; daraus muss dann eine Marke entwickelt werden – anders lässt sich die grassierende professionelle Oberflächlichkeit in der Ausübung dieses Berufs wohl nicht erklären.
Es ist vollkommen klar, dass auch die Karajans, Kleibers, Klemperers, Wands, Boulez‘, Abbados, Mutis, auch ein Janssons, und viele andere mehr (die gibt es übrigens auch heute, aber abseits der dirigentischen Popkultur) eine Entwicklung nehmen mussten, aber ihre Arbeit hatte eine Grundlage, die eine solche ermöglicht hat. Davon ist heute bei den dem Publikum als Maßstab präsentierten Dirigentinnen und Dirigenten wenig zu spüren.
Gerettet wird das wie immer von der stupenden individuellen Qualität der Orchestermusikerinnen und Orchestermusiker (die es nicht nur in den nominellen Spitzenorchestern gibt!), und ihrer geballten und zu oft unfair missbrauchten Routine. Man darf gespannt sein, wie lange sie das noch auszuhalten bereit sind, und wohin dieses unsinnige Theater noch führen soll. Swarowsky (nein, nicht der mit den Perlen, der andere) hat’s gewusst – in welchem Beruf ist es eigentlich noch möglich, dass Können und Karriere folgenlos so enorm auseinanderklaffen?
Genug davon, hinweg damit, denn es gibt auch gute Nachrichten: die wichtigste Konzertreihe der Stadt findet alle paar Wochen im kleinen Ehrbarsaal statt: Das „Echo des Unerhörten“, veranstaltet vom ExilArte Institut der mdw. Letztens war der ins Exil vertriebene Komponist Egon Lustgarten zu entdecken. Als nach dem 1. Weltkrieg die Musikzeitschrift Der Anbruch erschien, „fiel allgemein der Leitaufsatz “Philosophie der Musik” auf. Darin waren die subtilsten und tiefgründigsten Probleme der Musik mit großer Klarheit behandelt. Die künstlerische Eigenart Lustgartens kam schon damals voll zum Ausdruck: seine schöpferische Phantasie benötigt in gleicher Weise Wort und Ton….Eine Oper “Dante im Exil“ ist eben beendet worden; sie ist voll der zarten, doch eindringlichen Musiksprache, die ihn seit langen Jahren zu einem der bekanntesten Vertreter der gediegenen Wiener Schule gemacht hat.“ (Karl Wiener, 1937).
Hier, liebe Wiener Opernhäuser, und in anderen liegengelassenen Werken dieser erst annulierten, dann und jetzt peinlich vernachlässigten Generation, liegt eine wirkliche Chance für eine Erfrischung der Spielpläne.
Unbedingt lohnend ist auch der Besuch in der Kammeroper, wo die Neue Oper Wien einen szenisch und musikalisch umwerfenden Der Prozess von Gottfried von Einem nach Franz Kafka auf die Beine gestellt hat. Auf Alice von Kurt Schwertsik im Odeon (Sirene Operntheater/Serapion-Theater) und die zu Weihnachten allfällige, über das Publikum hinwegfegende und mit immer wieder großäugigem Staunen und Applaus bedachte Hexe in Hänsel und Gretel in der Volksoper freut sich der Rezensent auch schon.
[Jacques W. Gebest, Dezember 2024]