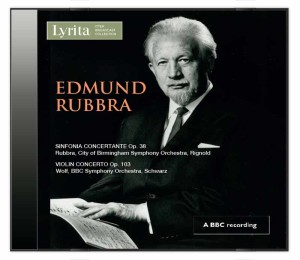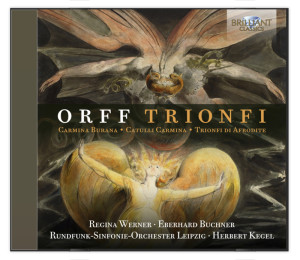Label: Hänssler Classic / Vertrieb: Hänssler – Art.-Nr.: HC16065 / EAN: 881488160659
Michael Rische (Klavier); WDR Sinfonieorchester Köln, Bamberger Symphoniker, Radio-Sinfonieorchester Berlin; Dirigenten: Gunter Schuller (Schulhoff), Steven Sloane (Honegger, Copland), Israel Yinon (Ravel), Christoph Poppen (Antheil), Wayne Marshall (Antheil, Gershwin)
Diese Einspielungen des ausgezeichneten Pianisten Michael Rische sind bereits in den 2000er-Jahren zum ersten Mal erschienen, damals beim recht kurzlebigen Low Budget-Label Arte Nova der BMG. Nun sind wahrscheinlich die Rechte an den Aufnahmen wieder frei geworden, und Rische hat die Einspielungen nun bei seinem heutigen Label Hänssler Classic unterbringen können.
Die Einspielungen sind heute so vorzüglich wie ehedem und bieten überwiegend seltenes Repertoire in sehr geschmackvollen Darbietungen. Während bei Arte Nova zwei Einzel-CDs im Angebot waren, ergeben beide Alben in der Hänssler-Ausgabe sinnvollerweise nun eine auch preislich attraktive Doppel-CD. Das Motto der Erstausgabe „Piano Concertos of the 20s“ ist gleichgeblieben und bereitet heute ebenso viel Hörvergnügen wie vor etwa 15 Jahren.
Es sind aber auch tolle Stücke, die es in diese Auswahl geschafft haben! Da wäre mit Erwin Schulhoffs „Konzert für Klavier und kleines Orchester“ aus dem Jahr 1923 zum Beispiel eine Art deutsche Alternative zu Dmitri Schostakowitsch. Der geniale Komponist Erwin Schulhoff, der 1942 auf tragische Weise in einem tschechischen Lager für politische Gefangene umkam, war zunächst einer der wenigen Vertreter eines musikalischen Dadaismus, wandelte später seinen Stil aber zu einer sehr gelungenen Mischung aus Expressionismus und Anklängen an die Spätromantik des Fin de Siècle. Sein Klavierkonzert zeigt Schulhoff als einen ungeahnt melodiebetonten Komponisten, der hier ein Stück schrieb, das reichlich Brillier-Potenzial für den Solisten bereithält und des Öfteren an Ravels Klavierkonzerte erinnert, zumal dieser mit Schulhoff auch seinen „jazzigen“ Einschlag gemeinsam hatte.
Auch Aaron Coplands Klavierkonzert von 1926 hat den Jazz inhaliert und gilt als eines der bedeutenden, wenn auch nicht gerade typischen Werke dieses bekannten US-Komponisten. Coplands typischer „Cowboy- Sound“ trifft in diesem Konzert auf die vielleicht im engeren Sinne modernste Musik, die dieser Komponist bis zu jenem Zeitpunkt vom Stapel gelassen hatte. Das Konzert ist als solches vordergründig nicht das, was man als „großer Wurf“ bezeichnen würde: Den Klavier-Solopart kann man kaum als sonderlich dankbar bezeichnen. Er ist schwierig in der Ausführung, kann hingegen kaum mit Passagen glänzen, die dem Publikum im Gedächtnis bleiben würden und wird überdies sogar häufig von dem vermeintlich viel interessanteren Geschehen im Orchester überflügelt. Bei näherer Betrachtung zeigt sich hier aber eine bemerkenswert visionäre Komponente: Man könnte fast der Ansicht sein, dass Copland in dem beinahe unauffälligen Klavierpart vielleicht doch manches von dem vorweggenommen hat, was wir später von Komponisten wie Morton Feldman und Philip Glass zu hören bekamen. Und ein wenig Satie-Anarcho-Feeling kommt in diesem Konzert auch auf. An sich ein herrlich schräges Stück!
Arthur Honeggers lediglich etwa elf Minuten kurzes „Concertino“ von 1924 ist ebenfalls ein ganz ungewöhnliches Stück. Mit dem für die damalige Phase Honeggers typischen Neoklassizismus entfaltet sich ein für die Group des Six ganz typisches Stück voller an Sarkasmus grenzender Heiterkeit. Es gehört sicherlich nicht zu den Meilensteinen des Honegger’schen Schaffens, das gewichtigere Meisterwerke kennt. Aber es ist doch ein auffälliges, reizendes Stück, in das der schweizerische Maestro sogar eine klassische Dreiteilung „schnell – langsam – schnell“ einzubauen vermochte. Originell!
Mit dem berühmten Klavierkonzert in G von Maurice Ravel wird das Doppelalbum seinem Titel ausnahmsweise untreu, denn das Stück stammt bereits aus dem Jahr 1930. Es existieren zahllose Referenzeinspielungen dieses Werks und im Spiegel derselben schlägt sich die vorliegende Einspielung sehr gut, wobei insbesondere im langsamen zweiten Satz deutlich wird, was für ein geschmackvoller, stilsicherer Pianist Michael Rische ist, der hier überzeugend dafür eintritt, dass wir es eben nicht mit einem Schmachtfetzen zu tun haben, wie es viele (gerade besonders namhafte) Pianisten gelegentlich missverstehen. Damit endet CD1 des Doppelpacks.
CD 2 widmet sich etwa je zur Hälfte George Antheil und George Gershwin. Die beiden Georges könnten abgesehen vom Vornamen unterschiedlicher kaum sein: Während Antheil Spaß an der Provokation und an der radikalen Moderne hatte, das Publikum immer wieder vor den Kopf stieß und (nach meiner Empfindung ganz unerklärlich) als „amerikanischer Schostakowitsch“ in viele Musiklexika einzog, ist Gershwin zwar vielleicht mehr als alle anderen Komponisten dieser Sammlung ein von Jazz geleiteter Komponist gewesen, doch lag ihm die Provokation fern. Er war vielmehr auf größtmögliche Breitenwirksamkeit seiner Musik bedacht und hat viele Stücke geschrieben, die wir heute sehr zu Recht als „Standards“ empfinden. Dazu zählt natürlich auch das „Concerto in F“ von 1925.
Bevor es dazu aber kommt, tauchen wir mit dem Ersten Klavierkonzert und der zu Antheils Lebzeiten sehr umstrittenen „Jazz Symphony“ in den bis heute außergewöhnlich anmutenden Klangkosmos George Antheils ein. Die Bamberger Symphoniker hatten hierbei allerdings nicht ihren besten Tag und standen zum damaligen Zeitpunkt ihren Kollegen vom WDR Sinfonieorchester Köln, das CD1 dieses Sets eingespielt hatte, doch in Präzision aber auch in schierer Klangästhetik um einiges nach.
Mit der schrägen „Jazz Symphony“ übernimmt dann das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Wayne Marshall und kann gleich mit mehr Dynamik und Verve punkten, wenngleich in einer unvorteilhaft halligen Aufnahme, die Antheils frecher Musik einiges an Schärfe und Chaos-Potenzial nimmt.
Bei dem Gershwin-Konzertboliden passt diese Klanglichkeit aber wiederum sehr gut und erinnert an manche RCA Living Stereo-Aufnahmen aus der Frühzeit der Stereo-Technik. Auch da mochte man zu diesem Repertoire so eine große „larger than life“-Bühne.
Fazit: Die eingespielten Stücke sind ohne Ausnahme interessant, der Solist der Aufnahme ist ausgezeichnet, die beteiligten Orchester, Dirigenten und Tonmeister zeigen eine gewisse Schwankungsbreite innerhalb grundsätzlich überzeugender Grenzen. CD1 macht allerdings wesentlich mehr Spaß als CD2.
Gut, dass diese lange vergriffenen Aufnahmen wieder erhältlich sind, wenn auch mit einem denkbar missratenen Cover-Artwork.
[Grete Catus, August 2017]