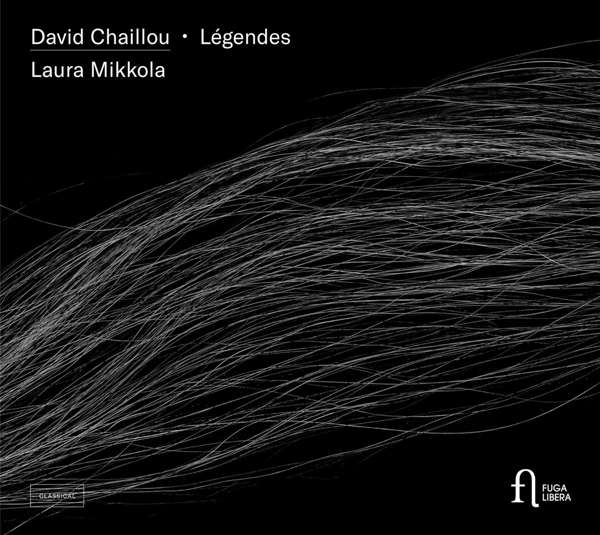Capriccio, C5423; EAN: 8 45221 05423 0

Mit der Veröffentlichung einer Rundfunkproduktion aus dem Jahr 1995 ist Egon Wellesz‘ Oper und Ballet verknüpfendes „kultisches Drama“ Die Opferung des Gefangenen nun erstmals auf CD zu hören. Unter der Stabführung Friedrich Cerhas wurde ein verdrängtes Meisterwerk wieder zum Klingen gebracht.
Viereinhalb Jahrzehnte nach seinem Tod ist Egon Wellesz vor allem als bedeutender Symphoniker bekannt, erschienen doch in den letzten zwei Jahrzehnten zahlreiche seiner Orchesterwerke auf CD, darunter sämtliche neun Symphonien. Sosehr es bereits angesichts dieser Werke berechtigt erscheint, Wellesz den großen österreichischen Komponisten des 20. Jahrhunderts zuzuzählen, sollte darüber nicht vergessen werden, dass er alle seine Symphonien zu einer Zeit komponierte, als er gar nicht mehr in Österreich lebte. Als er 1945, fast 60-jährig, mit der Arbeit an seiner Ersten begann, befand er sich schon sieben Jahre lang im englischen Exil. Es ist müßig zu fragen, wie sich Wellesz‘ Schaffen entwickelt hätte, wäre er nicht von den Nationalsozialisten vertrieben worden. In jedem Falle aber steht fest: Bis 1933 (in Deutschland) bzw. 1938 (in Österreich) war er einer der erfolgreichsten Bühnenkomponisten deutscher Sprache. Das auf der vorliegenden CD präsentierte Werk lässt verstehen, warum dies so war.
Die Opferung des Gefangenen vollendete Wellesz 1925, wenige Tage vor seinem 40. Geburtstag. Er bezeichnete das einaktige, knapp einstündige Werk als „kultisches Drama“, damit dem Umstand Rechnung tragend, dass es sich nicht ohne Weiteres einer musiktheatralischen Gattung zurechnen lässt: „Tanz, Sologesang und Chöre“ (so die Gewichtung der Akteure auf dem Titelblatt) wirken untrennbar miteinander zusammen, um die Handlung voranzubringen. Diese basiert auf Eduard Stuckens Übertragung eines alten Maya-Schauspiels, das Charles Etiénne Brasseur de Bourbourg 1856 in Guatemala aufgezeichnet hatte: Siegreiche Krieger führen Gefangene in den Palast ihres Königs, darunter einen Prinzen, der als Menschenopfer ausersehen ist. Sich in sein Schicksal ergebend, fordert er den König stolz auf, ihm Früchte und Tränke, dann kostbare Gewänder zu reichen, und tanzt mit den Sklaven und Sklavinnen, die ihm diese bringen. Er verlangt danach, mit der Tochter des Königs und anschließend mit dessen Kriegern zu tanzen, bevor er mit einem letzten Tanz Abschied von der Welt nimmt und sich opfern lässt. Diesen ritualisierten Verlauf charakterisierte Wellesz als „unentrinnbaren Mechanismus“. Gerade dass der Ausgang von vornherein feststeht, ohne dass sich die Möglichkeit bietet zu einem anderen Ende zu gelangen, dürfte den versierten Musikdramatiker, der als Historiker auch ein intimer Kenner der Operngeschichte war, gereizt haben. Die Figuren nehmen sich selbst als Teil eines Kosmos wahr, dessen Regeln feststehen. Das Leben, so sehr es gefeiert und genossen wird, wird nicht vom Tode losgelöst betrachtet. Widerspruchslos nimmt jeder seine Rolle darin ein und führt sie mit Würde zu Ende. Der Prinz weiß, dass er in der Rolle des Opfers seinen Bezwingern als gottgeweihtes Wesen gilt und nimmt daraus den Mut zu seinen Forderungen. An den siegreichen Kriegern bemerkt man, wie sich ihre Leidenschaften mäßigen: Verhöhnen sie den Gefangenen zu Beginn, und brausen noch auf, als er den Tanz mit der Königstochter fordert, verharren sie vor der Opferung in Ehrfurcht vor ihm und preisen ihn nach seinem Tod mit einem sakralen Hymnus. Der Komponist sah sich vor der Aufgabe, einer Mischung aus Erhabenheit, Grausamkeit und Transzendenz die adäquate dramatische und musikalische Form zu geben.
Wellesz versucht gar nicht erst, daraus ein traditionelles Drama zu machen, stattdessen spitzt er die Ritualisierung weiter zu. Natürlich werden auch aufführungspraktische Erwägungen eine Rolle bei der Entscheidung gespielt haben, die Handlung zwischen Sängern und Tänzern aufzuteilen, doch angesichts der Vorlage erscheint dieser Schritt geradezu als die geniale Konsequenz, durch die genau der richtige Grad an Stilisierung erreicht wird, den das Stück zu seiner Umgestaltung in ein Musiktheaterwerk noch nötig hatte. Der Prinz wird somit zu einer reinen Tanzrolle. Bei seinem ersten Auftritt und vor der Opferung lässt er seinen Schildträger für sich sprechen, zwischen den Tanzszenen übernimmt dies der Chor der gefangenen Krieger. Auch der König bleibt stumm und ordnet lediglich mit seinen Bewegungen das Geschehen auf der Bühne. An seiner Statt spricht der Älteste des Rates. Als dritte Gesangsrolle gestaltet Wellesz den Feldherrn des Königs. Die wiederholt zu hörenden Einleitungsformeln und Ehrfurchtsbekundungen der Sänger („So lautet die Rede des Prinzen“, „Der Himmel und die Erde seien mit dir“) tragen ebenso zum Eindruck archaischer Strenge bei wie die beständig durchgehaltene Wechselrede der Figuren.
Die musikalische Gestaltung des Stückes ist ein Triumph des Symphonikers Egon Wellesz – und das 20 Jahre bevor er seine Erste Symphonie komponierte! Die Unerbittlichkeit, mit der die Handlung voranschreitet, zeichnet auch die Musik aus. Wellesz beginnt sofort in lebhaftem Tempo und baut parallel zum Einzug der Krieger mit rastlosen Bassläufen und einem markanten Fanfarenthema eine enorme Spannung auf, die noch während der rezitativisch gestalteten Auftrittsreden der drei Solisten nachwirkt. Nirgends versiegt der kräftig strömende musikalische Fluss, führt durch grandios gesteigerte Chöre ebenso wie durch beinahe kammermusikalische Momente, in denen die Sänger schweigen und sich das Orchester auf wenige Instrumente reduziert, und verknüpft die kontrastierenden Einzelszenen miteinander zur höheren Einheit. Wenn der Schlusschor die Musik der Einleitung wieder aufgreift, ist ein Kreis durchschritten, eine Entwicklung zu ihrem krönenden Abschluss gebracht. So eindrucksvoll und musikalisch zwingend dieser Schluss ist: Die eigentliche Klimax des Werkes findet sich unmittelbar vor der Opferung. Zum einzigen Mal im Stück ist hier ein Duett zu hören, zum einzigen Mal singen solistische Frauenstimmen. Ihr wortloses Klagen hinter der Szene durchbricht die martialische Atmosphäre und stellt einmal kurzzeitig die Ordnung in Frage, der sich alle Figuren des kultischen Dramas ohne Wenn und Aber fügen.
Wellesz war nicht nur Schüler Arnold Schönbergs, sondern auch der Autor der ersten Schönberg-Monographie. Schönbergs Beispiel dürfte ihn dazu ermutigt haben, nicht vor der Anwendung schärfster Dissonanzen zurückzuschrecken, doch zeigt sich bei Wellesz‘ schon frühzeitig, dass er sich gegenüber seinem Lehrer die künstlerische Unabhängigkeit bewahrt hat. So lässt sich Die Opferung des Gefangenen stilistisch kaum mit einem Werk Schönbergs vergleichen. Nicht nur Wellesz‘ Sicherheit im Aufbau rascher Tempi und seine Vorliebe für klar gegliederte Formen zeigt, dass seine Ästhetik nicht mehr die des „Fin de Siècle“ ist. Auch in der Harmonik ist der Wille zur Klassizität deutlich zu erkennen. Mit den Worten seines Generationsgenossen Heinz Tiessen lässt sich sagen, dass es Wellesz darum geht, „auch die atonalsten Tonverbindungen als entferntere Ausstrahlungen“ des auf die Naturtöne gegründeten Tonsystems „restlos erfassbar werden“ zu lassen. Die kadenzgebundene Dur-Moll-Harmonik und die freie Dissonanzbildung des frühen Schönberg schließen für ihn einander nicht aus. Die Opferung des Gefangenen kann man durchaus als ein Musterbeispiel dafür anführen, wie gut beides in den Händen eines Meisters, der Musik als Kunst der Synthese denkt, zusammenwirken kann.
Wie Wellesz‘ übrige Opern und Ballette verschwand auch die Opferung nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten von den Spielplänen. Friedrich Cerha ist es zu danken, dass das Stück nach über 60 Jahren wenigstens eine konzertante Aufführung erlebte. Unter seiner Leitung entstand 1995 die nun von Capriccio veröffentlichte Aufnahme mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien und dem Wiener Konzertchor, in der als Solisten Wolfgang Koch (Feldherr), Robert Brooks (Schildträger), Ivan Urbas (Ältester), sowie Hoe-Seung Hwang und Patricia Dewey (Vokalisen) zu hören sind. Sie ist ein starkes Plädoyer für dieses Werk, das es verdient hätte, dem Repertoire der Bühnen zurückgewonnen zu werden.
[Norbert Florian Schuck, November 2020]