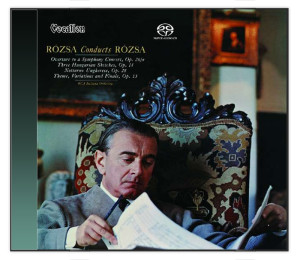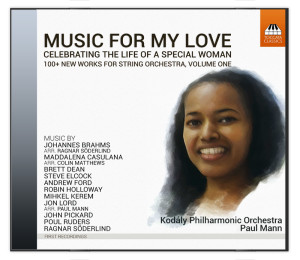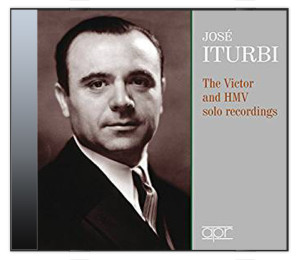Hans Erik Deckert: Mensch und Musik
Novalis Verlag, 2016; ISBN: 9783941664487
Hans Erik Deckert ist mir schon lange ein Begriff, und ich habe viele hervorragende, oftmals auch prominente Musiker, vor allem aus Skandinavien, getroffen, die ihm als Schüler, Studenten und Kollegen begegnet sind. Wir saßen in den gleichen Kursen bei Sergiu Celibidache in Mainz, und er hatte schon damals immer ein offenes Ohr für uns junge, naive Anfänger. Deckert wurde 1927 in Hamburg als Sohn eines deutschen Vaters und einer dänischen Mutter geboren. Am 15. Januar diesen Jahres zelebrierte er seinen 90. Geburtstag mit der Leitung und Einstudierung von Thomas Tallis’ 40stimmiger Motette ,Spem in alium’ mit 40 Cellisten bei einem Festkonzert in der Martinskirche Müllheim in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Er ist also ungebrochen aktiv und lebt seine Passion und Botschaft: die Kammermusik, deren Prinzipien er als einer der gefragtesten, legendären Mentoren unserer Zeit jungen Musikern aus allen Ländern nahebringt im Rahmen seiner ‚Cello-Akademie’. 1939-44 war er Schüler des Komponisten und Chordirigenten Kurt Thomas am Musischen Gymnasium in Frankfurt am Main und setzte seine Ausbildung 1948-52 in den Fächern Cello, Dirigieren und Musiktheorie an der Kopenhagener Musikakademie fort. Er hat Meisterkurse von Pablo Casals und – wie erwähnt – später bei Sergiu Celibidache besucht und pflegte intensiven Austausch mit vielen großen Musikern des 20. Jahrhunderts, die längst in die ewigen Klanggründe eingegangen sind. Viele Jahrzehnte wirkte er als Solist, Dirigent und Kammermusiker und sammelte jene Erfahrungen, von denen seither seine Studenten profitieren, die er nicht nur in Europa, sondern auch in Ägypten, Südafrika, Japan, Lateinamerika und den USA unterrichtet. Geistig steht er der Anthroposophie Rudolf Steiners nahe, was natürlich auch die Affinität zu Goethe und fernöstlicher Spiritualität einschließt, also eine zutiefst humanistische Musizierhaltung, wie sie eben auch bei solchen Meistern wie Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, Leo Weiner, Zoltán Kodály, Paul Hindemith, Celibidache, Casals, Edwin Fischer, Adolf Busch, Heinrich Neuhaus, Josef Vlách, Isaac Stern, Sándor Végh, Jean Louis Florentz oder Anders Eliasson in unterschiedlichster Ausprägung zu finden war, und wie sie heute von Musikern wie dem 80jährigen Berliner Streichquartett-Mentor Eberhard Feltz oder dem in Salzburg wirkenden Geiger und Dirigenten Lavard Skou Larsen verkörpert wird.
Es ist mithin naheliegend, wenn Deckerts so schnell vergriffenes und soeben in zweiter Auflage erschienenes Buch ‚Mensch und Musik’ heißt und dort viele Zitate eines Großteils der vorgenannten Legenden ihren Niederschlag finden. Das Buch ist eine Sammlung von Vorträgen und Aufsätzen Deckerts aus den Jahren 1981-2015. Deckert hat dabei stets nicht nur eine musikalische und soziologische, sondern eben auch eine ethische, ja moralische Botschaft zu vermitteln. Der verantwortungsbewusste Musiker hat gute Chancen, sich auch als verantwortungsbewusster Mensch zu bewähren – was ja keine Selbstverständlichkeit ist. Dabei ist Deckert stets zugleich Praktiker und Idealist. In einem der zentralen Essays – ‚Geben und Nehmen. Kammermusik als Schule der musikalischen Zusammenarbeit’ benennt er als die „drei Grundgesetze der Kammermusik“: das „Prinzip der rhythmischen Verzahnung“, das „Prinzip der Motiv-Übernahme“, und „das des aktiven, aus ganzer Seele teilnehmenden Begleitens“. Man könnte auch sagen: das Miteinander, das Ineinander, und das Füreinander – es geht hier also immer um den Gleichklang von Musikalität und Menschlichkeit, was sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch zieht, ob explizit benannt oder im Hintergrund anwesend. Kapitel wie ‚Das musikalische Phänomen’ oder ‚Musikalisches Bewusstsein’ führen auf eine zeitlosen Gesetzmäßigkeiten verpflichtete Weise in die Voraussetzungen bewussten, verantwortlichen Musizierens ein. Am Beispiel Beethovens wird aufgezeigt, wie äußerste Einfachheit der Melodiebildung zugleich Ausdruck höchster, reinster, leuchtender Größe der menschlichen Innenwelt ist – nicht das Material ist wirklich entscheidend, sondern der ausgerichtete Geist, der es empfängt und formt, eine Botschaft also, die diametral jener das Materialistische und das Emotionale trennenden Musikauffassung entgegentritt, wie sie seit dem Siegeszug der Atonalität im intellektuellen Diskurs so prägend für die Moderne und im Gefolge dessen überhaupt für die Musikausbildung geworden ist. Entschieden stellt sich Deckert der Popmusik und überhaupt jeder Form verstärkten und künstlich erzeugten Klangs entgegen, denn hier spiegelt sich der Triumph der unmenschlichen Kräfte wider, das mechanische Robotertum, das im narzisstischen Perfektionismus und der unerbittlichen Wettbewerbsmentalität unserer Zeit seinen entmenschlichten Niederschlag findet. Dazu ist freilich einzuwenden, dass der Jazz, die avancierte Rockmusik und andere daraus in der Übernahme weiterer Einflüsse wie Folklore, indigener Kunstmusik oder auch klassischer Musik hervorgegangene Strömungen und Fusionen höchst kreative Musiker hervorgebracht haben (ich denke z. B. an Erscheinungen wie King Crimson, Astor Piazzolla, Peter Michael Hamel, Oregon usw.). Trotzdem, es stimmt, es bleibt absolut wesentlich, dass wir Erfahrungen mit dem Klang in seiner reinen, natürlichen, ursprünglichen Form machen, und daraus hervorgehend mit der Korrelation der Klangphänomene zu höherer Einheit der Gestalt, was Voraussetzung ist, um die Identifikation mit der gegenständlichen Welt, die Abhängigkeit von den Dingen, die wir letztlich nicht mitnehmen können, transzendieren zu können. Deckerts Kritik am Zustand der musikalischen Welt muss intelligent gelesen werden, und dass wir uns in einer Epoche der Dekadenz befinden, können wir erkennen, wenn wir uns intensiv und unabhängig kritisch mit jenen Strömungen auseinandersetzen, die heute insbesondere in Mitteleuropa das feuilletonistisch verbürgte Siegel ‚Neue Musik’ tragen, das in den meisten Fällen mit erlebtem, also erlebbarem Zusammenhang nichts zu tun hat und uns vor allem in eine Welt der sinnlichen Effekte und spekulativen Methoden katapultiert, die uns so leicht von unserem inneren Erleben abschneiden können, indem sie uns eine aufregende Illusion der elaborierten Künstlichkeit offerieren. Natürlich gibt es auch heute große Komponisten, doch die müssen wir suchen, und wir werden sie weder in der etablierten ‚Avantgarde’ finden noch in ihren populären Antipoden, der Unterhaltungsmusik vom billigen Schlager über die sentimentalisierende Hollywoodsauce bis hin zur mechanistischen Minimal Music. Große Musik heute muss nichts ausschließen, überhaupt ist sie nicht eine Frage der Mittel an und für sich (man denke an die Melodik Beethovens!), und wer kennt schon einen so genialen Komponisten wie den Norweger Ketil Hvoslef, oder den vor wenigen Jahren verstorbenen Franzosen Jean-Louis Florentz, um stellvertretend nur zwei Namen zu nennen, deren Musik hinsichtlich des Materials und der sich daraus entfaltenden Dynamik verschiedener nicht sein könnte?
Deckert betrachtet eingehend die musikalischen Grundphänomene Rhythmus, Medodie und Harmonie (die Anders Eliasson, ein anderer ganz großer Meister unserer Epoche, als das H2O der Musik bezeichnete, denn „Musik muss fließen, und wenn man sie anschieben muss, ist es keine Musik“) und gibt dem Kammermusiker, sei er nun Anfänger, Amateur, Lehrer oder hochqualifizierter Virtuose, auf Schritt und Tritt wertvolle Hinweise. Und immer geht es dabei um das Menschliche, denn Musik wird von Menschen entdeckt, empfangen, gestaltet, um Menschen an einem zutiefst menschlichen Erleben teilnehmen zu lassen. Insofern ist Musik, um den großen dänischen Komponisten unserer Zeit Per Nørgård zu zitieren, ein „unendlicher Empfang“. In ‚Die notwendige Durchdringung des Individuellen mit dem Sozialen’ konstatiert Deckert:
„Immer wieder passiert es, dass jemand lange Zeit etwas gänzlich allein übt. Anstatt frühzeitig, wenn auch noch so skizzenhaft, sich um die für ihn zuständige musikalische Umgebung zu kümmern. Gerade dieser Sachverhalt zeigt an, dass etwas nicht in Ordnung ist. Dieser zweite Pol muss ständig wachsen. Die Hinwendung zum sozialen Element der Musik muss sich intensivieren, muss nach und nach bewusster werden. Geschieht dies nicht, dann kann es zum Verhängnis werden. Und leider ist es eben vielerorts so, dass dies nur unzureichend geschieht, unter Umständen sogar überhaupt nicht.“
Und in einem Abschnitt über ‚Musikalische Transzendenz schreibt er mit hymnisch ernüchternder Emphase:
„Gerade am Phänomen Kontrapunkt sehen wir die geradezu erschreckende Unterernährung unserer musikalischen Vorstellungswelt. Dieses Fach wird oft zur mathematischen Folter anstatt zur Entwicklung musikalischer Formkräfte. Es gleicht einem ausgetrockneten Flussbett, wo früher einmal ein lebensspendender Strom war.
So haben wir die Möglichkeit, die musikalischen Elemente als Kraftzentren, als geistige Realitäten zu empfinden, denen wir mit immer größerer Ehrfurcht und Hingabe gegenübertreten. Wir sind hier im Bereich des Allerheiligsten in der Musik. Meines Erachtens sollte hier jede musikalische Arbeit ihr Zentrum haben, hier sollte das eigentliche Hauptfach für jeden Musiker sein, für jede Musikausbildungsstätte, für jegliche Form des Musikunterrichtes: Es ist die Musikphänomenologie!“
Hans Erik Deckerts musikalisch-menschliches Credo, getragen von reicher Erfahrung, unterscheidungsfähigem Sachverstand, klarer Vorstellung und unbestechlichem Ethos, ist es wert, von jedem Musiker gelesen und in die aktive Arbeit einbezogen zu werden. Zuallererst von den Pädagogen, aber auch von Musikliebhabern und von begeisterten ebenso wie von frustrierten Berufsmusikern, die ihr ursprüngliches Ideal nicht aus den Augen verloren haben und einen verantwortungsbewussten, fruchtbaren und intelligenten Ansatz suchen, um sich zu orientieren in der von innerer Lebendigkeit getragenen Welt eigentlichen Musizierens jenseits der im besten Falle brillanten Oberflächlichkeit des normalen ‚Survival of the Fittest’-Musikbusiness. Denn, so Deckert:
„Was aber ist dieses Werdende? Es ist der musikalische Konsens in einer Gemeinschaft von Musizierenden, bewirkt durch die gemeinsame Aneignung objektiver musikalischer Gesetze. Dieser Konsens wird sich unmittelbar auf den aktiv miterlebenden Zuhörer übertragen. Eine subjektive Interpretation hat hier zurückzutreten gegenüber der übergeordneten Erkenntnis musikalischer Zusammenhänge. Ein Lehrer oder ein Dirigent kann zwar musikalische Gemeinschaften suggerieren, doch der Konsens, der durch das musikalische Erleben entstehen kann, beruht allein auf der Freiheit des Einzelnen in der Wahrnehmung der eindeutigen musikalischen Phänomene.
Wir können nicht sagen, was Musik ist. Aber wir können erleben, wenn Musik entsteht. Wir können erleben, wenn Töne korreliert werden und ein ewiges ‚Jetzt’ die Zeitdimension aufhebt. In der Kammermusik können die Mitwirkenden gemeinsam korrelieren, aber ohne sich selbst zu verlieren. Hier liegt das Mysterium der Musik, das jedem Menschen zugänglich ist, wenn er sich dafür öffnet. Hier liegt die Chance, die Musik als eine universelle Schule für den Menschen zu empfinden.“
[Christoph Schlüren, Januar 2017]