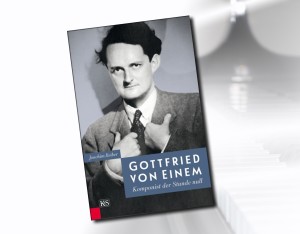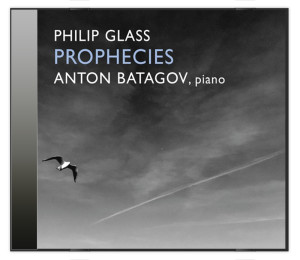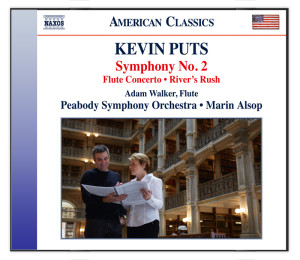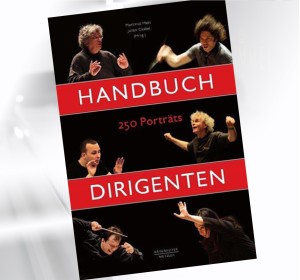Rémy Ballot, Eva Gevorgyan und die Stuttgarter Philharmoniker mit Mozart und Bruckner
Da Chefdirigent Dan Ettinger nunmehr zumindest bis Saisonende krankheitsbedingt nicht einsatzbereit ist, übernahm Rémy Ballot das Abonnementkonzert der Stuttgarter Philharmoniker am 16. Mai in der Stuttgarter Liederhalle, in welchem eigentlich eine Puccini-Gala gegeben werden sollte, und leitete das Orchester stattdessen in einem Mozart-Bruckner-Programm, welches ansonsten dem Stuttgarter Publikum vorenthalten geblieben wäre. Das ist eine insgesamt bemerkenswerte Entwicklung, da Ballot ja zunächst – mit maximalem Erfolg, wie man das wohl nennen muss – in Bruckners Fünfter Symphonie (seiner komplexesten) eingesprungen war. Dies geschah, da er als ‚Bruckner-Spezialist‘ empfohlen wurde, was insofern auf der Hand liegt, als er ja gerade für das führende österreichische Klassik-Label Gramola den ersten Zyklus der zehn reifen Bruckner-Symphonien vollenden konnte, der jemals in der Stiftsbasilika St. Florian eingespielt wurde – also an dem Ort, an welchem sich Bruckners eigene Klangvorstellung einst entscheidend ausgebildet hat. Und natürlich hat Ballot – unter akustisch weit unproblematischeren Bedingungen als in dem sehr halligen Kirchenraum unweit Linz – die Stuttgarter, das Hausorchester des frischgebackenen deutschen Fußball-Vizemeisters, auf fulminant klare, den geistigen Gehalt der Musik, ihr Drama des freien Kontrapunkts ohne Schielen auf Effekte oder Stilisierungen entfaltende Weise durch dieses Werk geführt, wie mir von mehreren Seiten, deren Wort schon des öfteren mit der Realität in Einklang stand, zugetragen wurde – eine Ansicht, die unter anderem auch, und das wiegt nun wahrlich nicht gering, von vielen der Orchestermusiker getragen wird.
Daraufhin lud man Ballot ein, auch die beiden Konzerte in Norditalien zu dirigieren, in welchen zunächst die großartige junge armenisch-russische Pianistin Eva Gevorgyan (Jewa Geworgjan) in Mozarts großem A-Dur-Klavierkonzert KV 488 begleitet wurde, bevor diesmal Bruckners Vierte – in der definitiven 3. Fassung von 1887–88 – erklang. Man spielte dieses Programm beim Klavierfestival in Brescia sowie in Bergamo, der Heimstätte der frischgebackenen Leverkusen-Bezwinger. Und, man kann es ja fast nicht glauben, man spielte dabei die Erstaufführung der Vierten Bruckner – seines zusammen mit der Siebten populärsten Werks – in Bergamo. Also nicht nur in musikalischer, sondern auch in historischer Hinsicht eine entscheidende Tat.
Dieses Programm hätte das Stuttgarter Publikum also nicht zu hören gekommen, hätte nicht Ettingers Puccini-Herzensprojekt auf dem Programm gestanden, welches man dem erkrankten Chef – dem dringend gute Besserung zu wünschen ist – nicht entreißen, sondern auf einen späteren Zeitpunkt verlegen wollte.
In Stuttgart gab es nun – einem Saison-Motto folgend – zwischen Mozart und Bruckner, besetzungsbedingt nach der Pause vor der Symphonie, An Oddment for Orchestra, ein One-Minute-Piece einer Kompositionsstudentin der Stuttgarter Hochschule, der 1997 geborenen Flämin Eveline Vervliet, als Uraufführung – eine Art stehender Klangbildung, ein bisschen gleich einem Tierchen, das auf einer Lichtung um sich schaut und überlegt, wohin es sich denn bewegen soll. Nun denn – zu Bruckner, und das deutet sich auch in den Klängen an, die da in recht bruchstückhafter Weise aufeinanderfolgen (der Titel, dadaistisch-technokratisch, könnte auch eine Hommage an Elon Musk sein). Eine freundliche Talentprobe, die das Publikum nicht beleidigt.
Zuvor gab es einen vor allem im Kopfsatz ganz wunderbaren Mozart, und Eva Gevorgyan ist eben nicht nur eine phänomenale Virtuosin, wie sie anschließend vor allem in den Finessen der Paganini-Campanella in Liszts rhapsodischer Formung in das Publikum absolut in Bann schlagender Weise bewies, sondern eine Musikerin, die in dieser niemals stillstehenden, immerfort sich organisch entwickelnden Musik vollkommen präsent ist, die harmonischen Verläufe sinnfällig aushört, die Kontrapunktik auch da deutlich hervortreten lässt, wo viele andere nur charmantes Figurenwerk durchnudeln. Eine wirklich spannende, dabei auch ganz natürliche Darbietung mit einem adäquat hellwachen Orchester als lebendig changierendem Gegenpart. Im langsamen Satz spielte Eva Gevorgyan sehr fein und stimmungsvoll, auch durchaus klar und äußerst kultiviert, jedoch können die Spannungsverläufe der Phrasen noch viel bezwingender erscheinen, zumal wenn die extreme introvertierte Spannung der Neapolitaner-Akkorde tiefgreifender begriffen würde. Aber das lässt sich ja noch entwickeln, erweitern… Im Finale herrschte geistvoller Dialog, lediglich leicht gebremst durch ein etwas zu geschwind genommenes Starttempo, aber hier ist es viel leichter, das natürliche Idiom des Komponisten zu Wort kommen zu lassen, wenn man nicht den ideologischen Flausen der sogenannten ‚historischen Aufführungspraxis‘ mit ihren nivellierenden Verzerrungen aufsitzt – und diese Gefahr bestand in keinem Moment. Der kleinen Einwände eingedenk also eine vortreffliche, grundmusikalische Darbietung aller Beteiligten.
Auf der gleichen Höhe bewegte sich die Bruckner-Symphonie. Es ist nicht möglich, dies angemessen zu beschreiben. Als Leitfaden möge dienen, dass Ballot definitiv von dem Lehrer und Meister geprägt ist, dessen jüngster Dirigierschüler er am Ende von dessen Leben war: von Sergiu Celibidache. Und da scheiden sich natürlich die Geister von den Ungeistern. Aber lassen wir die Ungeister außer Acht, die können sich ja an Wand, Harnoncourt, Skrowaczewski, Tintner, Thielemann und minderen Gesellen orientieren. Entscheidend ist, dass Ballot es einerseits überhaupt nicht nötig hat, sich irgendwie von Celibidache zu distanzieren, sondern dass er schlicht ein ergebener Diener der Musik ist, wie dies einst, in Zeiten vor dem alle Qualität niederwalzenden Starkult, das Ideal aller seriösen Musiker war. Und das Schöne ist, dass Ballot bei aller Nähe zum von Celibidache Erlernten doch ein ganz anderes Naturell ist. Spezifisch für ihn ist eine Leichtigkeit, Geschmeidigkeit, ein grundsätzlicher Optimismus, ja eine immer spürbare Freundlichkeit und Fröhlichkeit des Wesens, und das begünstigt auch die Transparenz des Orchesterklangs und überhaupt die kollektive Tongebung. Und es bedeutet keineswegs, dass es an Drama mangele! Das Scherzo ist so virtuos, wie es sein soll, und keine gemütliche Veranstaltung (das Trio hingegen selbstverständlich genau das). Kopfsatz und langsamer Satz gelingen vortrefflich, und es steht zu vermuten, dass fast niemand in Orchester und Publikum diese Musik bisher je so wunderbar gestaltet im Konzert erleben durfte. Und überwältigend, wie es eben sein muss, setzt das Finale dem Ganzen die Krone auf, um in einer apotheotischen Coda, wie dies nur möglich ist, dem Himmel zuzustreben. Ganz im Sinne seines Lehrmeisters gelingt es Ballot hier, aus dem Gegensatz der kantablen Harmoniepracht des modulierenden Bläsersatzes und dem markierten Schreiten der Streichertriolen als rhythmischer Erdung eine Wirkung zu manifestieren, die so magisch ist, dem sich nur entziehen kann, wer dümmlicherweise dagegen ist. Und welcher musikalische Geist wäre das? So geht Bruckner, und Ballot ist wohl nicht der einzige, der das heute versteht und verwirklichen kann, aber einer der ganz wenigen. Die Stars gehören jedenfalls bislang nicht dazu. Möge er also kein solcher werden wie diese, sondern seinem eigenen Stern ohne Eitelkeit und Selbstsucht folgen, wie dies bisher ganz offensichtlich der Fall zu sein scheint, und möge ihn der zunehmende Erfolg geistig nicht zu Fall bringen. Ich traue ihm das jedenfalls zu. Ich hätte mir lediglich gewünscht, dass er nicht so pedantisch die Zweier-Gruppen bei der Bruckner-Manie des halb-Zweier, halb-Dreier-Alla-breve-Takts unterschlagen hätte. Auch wenn ihm womöglich die verfügbare Probenzeit ein bisschen knapp gewesen sein mag (was vor allem für den langsamen Satz gilt), so viel Kontrolle war hier nicht nötig, und das Orchester tat, was ihm nur möglich war, um in dieser Art von Bruckner-Spiel, die in jedem Fall so ganz anders als das Gewöhnliche und so ganz neu war, mit Hingabe aufzugehen. Wie schön, wenn ein Orchester so fühl- und spürbar aufblüht und mit solchem Selbstbewusstsein das entdeckt wie beim ersten Mal, was man längst zu kennen glaubte. Großartig.
Was ist das Besondere an dieser Art des Musizierens? Kurz, allzu kurz gesagt: der organische Zusammenhang, der uns alle vier Sätze in bezwingender Weise als Einheit der Form erleben lässt. Und vielleicht sogar die Symphonie als Ganzes, wenngleich jenseits des Erklärbaren, auch wenn das Hauptthema des Beginns am Ende wieder da ist, wie ein Symbol des Ewigen. Diese einmalige Kunst des Musizierens kann man nicht eben mal erklären. Das erlebt man. Sogar als Kritiker ‚von Statur‘ hätte man die Möglichkeit…
[Annabelle Leskov, Mai 2024]