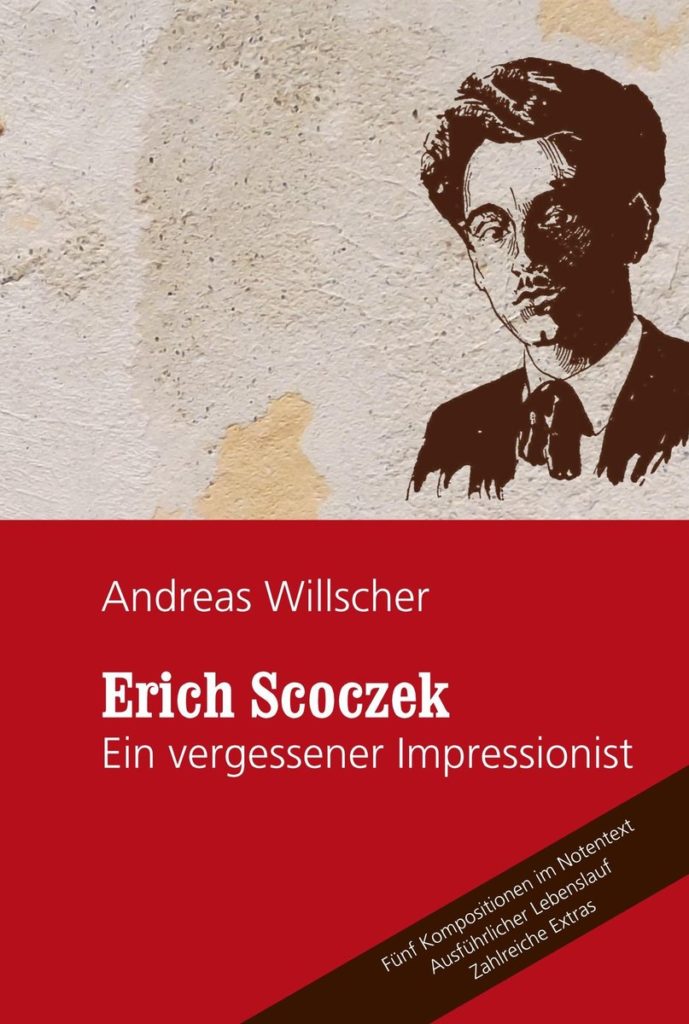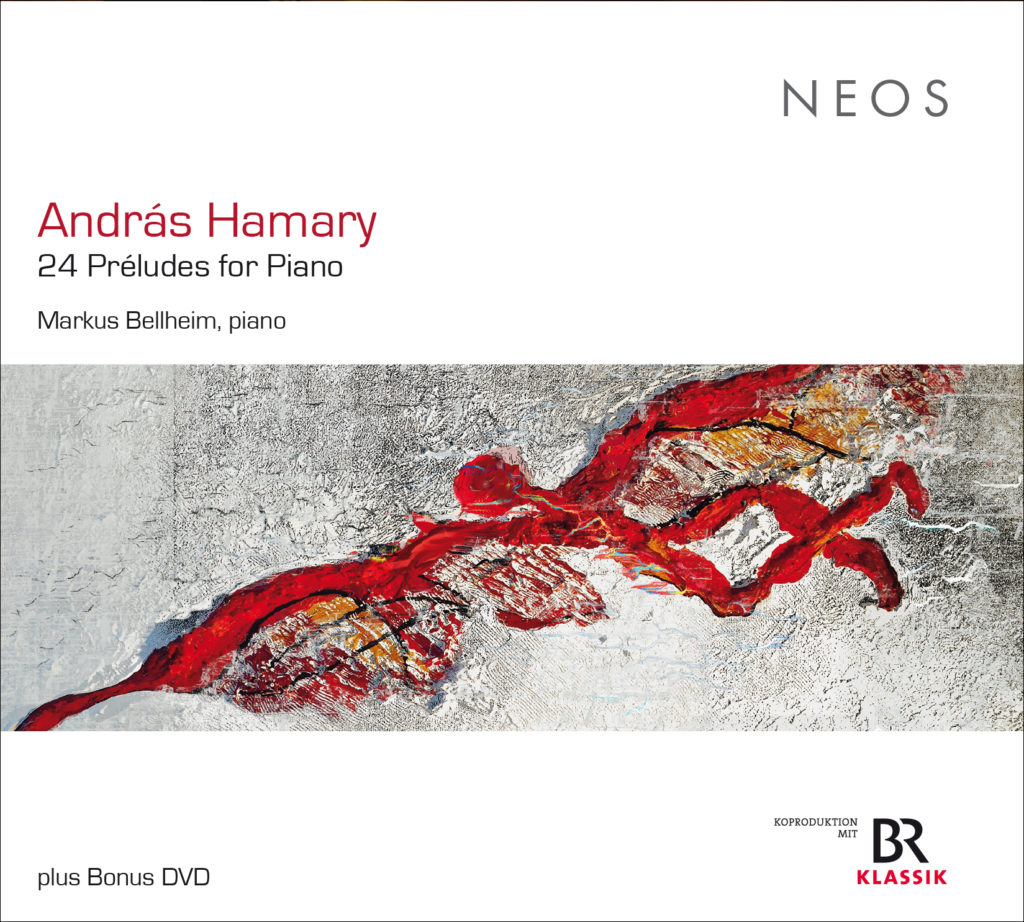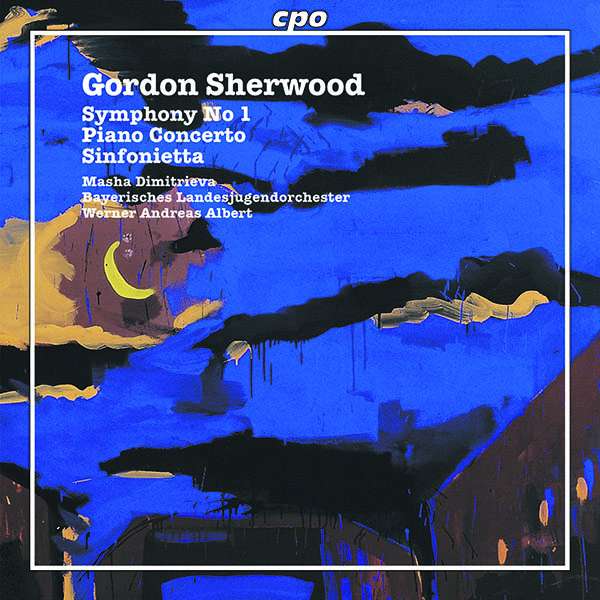Selbstverlag Andreas Willscher, Hamburg 2021; ISBN: 978-3-9823800-0-1
Die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts kennt die Namen zahlreicher Musiker, die durch Krieg, Vertreibung und politische Verfolgung einen gewaltsamen Tod gefunden haben. Mit der Auslöschung ihrer physischen Existenz ging in der Regel die Zerstörung ihres künstlerischen Erbes einher. Auch zahlreiche wertvolle Dokumente, die über den Lebenslauf der Künstler Auskunft hätten geben können, gingen verloren. Biographie und Schaffen wurden gleichermaßen fragmentiert.
Als ein solches Fragment stehen heute Leben und Werk des sudetendeutschen Komponisten Erich Skoczek vor uns, einem der konsequentesten Adepten des französischen Impressionismus im deutschsprachigen Kulturraum. Der 1908 im mährischen Olmütz geborene Skoczek hatte in Wien studiert und war dort in den späten 1920er Jahren als Orgelvirtuose zu Ansehen gelangt. Neben seinem musikalischen Wirken war er auch als Maler und Schriftsteller tätig. 1941 in seine Geburtsstadt zurückgekehrt, wurde er kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, im Mai 1945, während einer gegen die deutsche Bevölkerung gerichteten Verhaftungsaktion in das nahegelegene Konzentrationslager Hodolein deportiert, wo er wenig später zu Tode kam. Die tschechischen Behörden ließen seine Wohnung ausräumen, wobei auch die Manuskripte seiner Kompositionen auf den Müll geworfen wurden. Dass immerhin ein winziger Teil von Skoczeks Nachlass erhalten blieb, ist dem Organisten Anton(ín) Schindler zu verdanken, der sich die Bewilligung verschaffte, „zur Stampfe“ vorgesehene Papiere zu sichten. Durch seine Umsicht ist u. a. das umfangreichste heute noch vorhandene Werk Skoczeks, das 1928 komponierte Konzert für Orgel und großes Orchester op. 20, auf uns gekommen.
Nun hat es Andreas Willscher, einer der meistgespielten Orgelkomponisten unserer Zeit, Förderer wenig bekannten Repertoires und ausgewiesener Kenner der sudetendeutschen Musikgeschichte, unternommen, das Wissen über Erich Skoczek zusammenzutragen. Sein im Selbstverlag erschienenes, 170 Seiten umfassendes Buch dokumentiert nicht nur sämtliche bislang bekannte Quellen zu Skoczeks Biographie, sondern macht auch mit dem Großteil seiner erhaltenen Kompositionen bekannt. Nicht weniger als fünf Orgelstücke, die zu Lebzeiten des Komponisten veröffentlicht worden waren, finden sich bei Willscher vollständig abgedruckt, zwei davon auch in Fassungen für Klavier. Es sind:
Basilica di Roma op. 33
Eine holländische Mondnacht. Sinfonisches Intermezzo op. 39 (auch Fassung für Klavier 4-händig)
Deux piéces polytonales op. 42, Nr. 1: À Claude Debussy. Poème symphonique
Deux piéces polytonales op. 42, Nr. 2 Chanson
Eine Seelenwanderung op. 55 (auch Fassungen für Klavier 2-händig)
Studiert man diese Kompositionen, die zusammen etwa 2/3 des Bandes ausfüllen, wird sofort deutlich, dass Skoczek, der spätestens seit op. 42 seinen Vornamen zu „Eric“ französisierte, unter den deutschen und österreichischen Orgelkomponisten seiner Zeit eine der originellsten Erscheinungen gewesen ist. Sein großes Vorbild war offensichtlich Claude Debussy, dessen freie, von der klassischen Funktionsharmonik gelöste Akkordbildung und Stimmführung er auf die Orgel überträgt. Auch hinsichtlich der Registrierung gibt Skoczek sehr differenzierte Anweisungen. So nimmt es nicht Wunder, dass sich aus diesen Stücken ein wahres Füllhorn aparter, zauberischer Klänge ergießt.
Auszugsweise macht uns Willscher mit dem Orgelkonzert op. 20 und der Apotheose des Namens BACH op. 26 bekannt, einem Orgeltriptychon, in dessen Finale ein Sopransolo „Bach’s Verklärung im Himmel“ schildert. Als weitere musikalische Dokumente finden wir noch die einzig erhaltene Bassstimme des Chorwerks Christi Geburt op. 27 sowie den Anfang des von Skoczek erstellten Klavierauszugs einer Opernouvertüre von Arthur Johannes Scholz (1883–1945) mitgeteilt.
Als Musikschriftsteller lernen wir Skoczek mit einer kurzen Einführung in Beethovens letzte drei Klaviersonaten kennen, von der leider die Besprechung des Finales von op. 111 fehlt, sowie mit einem für eine Olmützer Zeitung verfassten Aufsatz über „Musik im Radio“, in welchem sich der Komponist zu den Verwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Instrumente unter den Bedingungen des damaligen Rundfunks äußert und zu dem Schluss kommt: „Um die Feinheiten des Werkes feststellen zu können, muß man dieses aus erster Hand hören, das nur im Konzertsaal möglich ist, nicht durch den besten Radioapparat.“
Neben der Biographie des Komponisten, einem Verzeichnis seiner Werke (das 62 Opuszahlen umfasst), einer Übersicht über die Interpreten seiner Musik, und einer Sammlung zeitgenössischer Konzertkritiken, enthält der reich bebilderte Band weiterhin einen kurzen Abschnitt, in welchem sich Willscher kritisch mit den Thesen des Musikschriftstellers Anton Popovici auseinandersetzt, der 1935 eine kleine Monographie über Skoczek veröffentlicht hatte. Besonders dieser Teil des Buches lässt ahnen, über welch umfassende Kenntnisse der Orgelliteratur Andreas Willscher verfügt. Im Anhang finden sich außerdem das von Skoczek in seinem op. 26 vertonte Gedicht „Bach’s Verklärung“ von Grete Jank, sowie drei Improvisationsthemen, die der Retter des Orgelkonzerts, Anton Schindler, für Willscher aufgezeichnet hat.
Kritisch anzumerken wäre, dass das Buch besser hätte lektoriert werden müssen, denn leider sind einige Druckfehler stehen geblieben. Der erste findet sich bereits auf dem Einband, wo der Name des Komponisten „Scoczek“ geschrieben wird (was dazu führen kann, dass das Buch bei einer Suche schwerer gefunden wird). Auf S. 159 erfahren wir zwar die genauen Lebensdaten und einen knappen Lebenslauf des Komponisten des „Phantasiegemäldes mit Gesang in drei Aufzügen“ Der Zeitgeist oder Ein Besuch aus der Vorzeit von 1841, nicht aber dessen Namen Adolph Müller. Auch hätte man sich im Verzeichnis der Werke Skoczeks präzisere Angaben gewünscht. Zwar liest man dort die Titel aller bekannten Kompositionen (einige Opuszahlen konnten nicht zugeordnet werden) und auch, welche davon zu Lebzeiten gedruckt wurden, doch wird bei den anscheinend Manuskript gebliebenen nicht klar, welche verschollen und welche erhalten sind. So erhält man zum erhaltenen Orgelkonzert und zur fragmentarisch überlieferten Christi Geburt nicht mehr Informationen als zu anderen Kompositionen, deren Uraufführungsdatum bekannt ist. Gerade weil uns aus dem ganzen Buch die Liebe entgegenschlägt, mit der der Autor es geschrieben und gestaltet hat, wirken diese Einzelheiten störend! Dennoch muß betont werden, dass es sich um eine außerordentlich wichtige Veröffentlichung handelt, die Beachtung verdient. Musikwissenschaftler sollten sich davon zu weiteren Forschungen über Erich Skoczek anregen lassen, und Musiker dazu, seine Werke wieder zu Gehör zu bringen. Den Organisten hat Willscher hier genug Material an die Hand gegeben. Mögen sie es nutzen!
Um einen Eindruck von Skoczeks Klangwelt zu vermitteln, sei noch auf Auszüge einer Aufführung seines Orgelkonzerts durch die Mährische Philharmonie unter Petr Šumník mit Kateřina Chroboková an der Orgel hingewiesen:
Erich Skoczek – Concerto for Organ and Orchestra 1 – YouTube
Erich Skoczek – Concerto for Organ and Orchestra 2 – YouTube
Norbert Florian Schuck [Mai 2023]