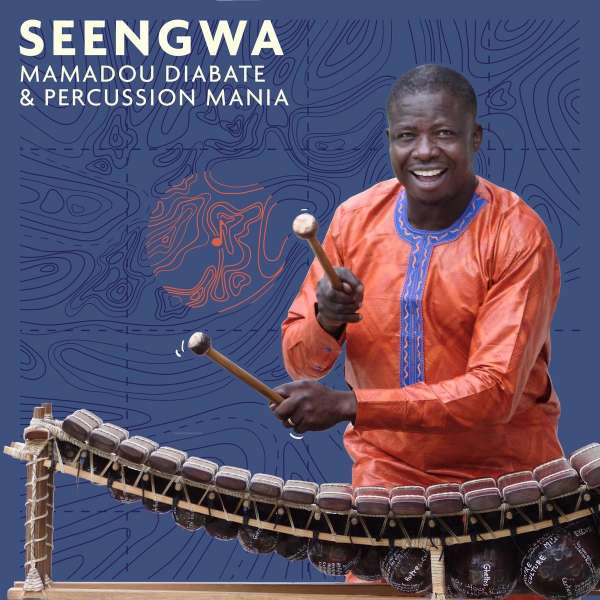Ars Produktion, ARS 38 339, EAN: 4 260052 38339 1

Das Duo Les Connivences Sonores spielt fünf Originalwerke des 20. Jahrhunderts für Flöte und Harfe, komponiert zwischen 1919 und 1996. Die Komponisten und ihre Werke decken dabei eine breite Palette an Ländern und Stilen ab, die sich vom französischen Impressionismus und der Musik des Nahen Ostens bis hin zur Illustration des Stundenbuchs erstreckt; auch Schostakowitsch findet hier – musikalisch – Erwähnung.
Seit 2014 bilden die französische Flötistin Odile Renault und die Schweizer Harfenistin Elodie Reibaud ein Duo, und wie der Name „Les Connivences Sonores“ bereits nahelegt, setzen sich die beiden Musikerinnen insbesondere für selten gespieltes Repertoire ein. Ihre erste (SA)CD, fast ein wenig unscheinbar als „Musikalische Perlen“ tituliert, ist als Streifzug quer durch das Originalrepertoire des 20. Jahrhunderts für diese Besetzung angelegt. Alle hier versammelten Werke bewegen sich im Rahmen einer frei gehandhabten, oft modal gefärbten Tonalität und ergeben ein facettenreiches, unterhaltsames und anregendes Programm.
Am Beginn der CD steht die Sonatine für Flöte und Harfe op. 56 (1919) von Désiré-Émile Inghelbrecht (1880–1965), einem Freund Debussys, der vor allem als Dirigent französischer Musik Bekanntheit erlangte; eine ganze Reihe seiner Einspielungen sind auch heute noch ohne Probleme auf CD zu beziehen. Seine Kompositionen spiegeln seine Vorlieben und Schwerpunkte als Dirigent deutlich wider: Musik im Fahrwasser der französischen Spätromantik und ganz besonders des Impressionismus, deren Reize nicht in einem sonderlich individuellen Tonfall liegen, sondern eher in der gekonnten, apart gestalteten Bezugnahme auf bereits Vorhandenes. Seine dreisätzige Sonatine ist ein leicht melancholisches, insgesamt aber doch eher lichtes Werk in e-moll. Die an zweiter Stelle stehende Sicilienne lässt (auch) ein wenig an Gabriel Fauré denken, aber in der Totalen ist Debussy sicherlich der dominierende Einfluss, besonderes deutlich etwa im Finale, das ziemlich direkt die Fêtes aus den Trois Nocturnes in Erinnerung ruft. Ein reizvolles, charmantes, leicht ins Ohr gehendes Werk.
Ist Inghelbrechts Sonatine das älteste hier eingespielte Werk, so folgt mit der Sonate für Flöte und Harfe op. 56 des Amerikaners Lowell Liebermann (* 1961) sogleich das jüngste. Komponiert 1996, erfreut sich dieses Stück ganz augenscheinlich großer Beliebtheit; so listet die Internetpräsenz des Komponisten nicht weniger als acht(!) weitere Einspielungen auf. In der Tat handelt es sich um ein attraktives, dankbares Werk, das insbesondere auch dramatische Akzente setzt. Knapp viertelstündig und in einem Satz angelegt, beschreibt die Musik einen Bogen, der von einem gespannt-ahnungsvollen langsamen Beginn (Grave) ausgeht. Über dem langsamen Pochen der Harfe (auf H) entfalten sich lyrisch-expressive Melodiebögen in der Flöte, die variiert, entwickelt und gesteigert werden, um schließlich in einen schnellen, triolisch geprägten Mittelteil zu münden, der unter anderem Schostakowitsch Referenz erweist (in Form des D-Es-C-H-Motivs). Am Ende kehrt die Musik des Beginns in leicht abgewandelter Form wieder, und die Sonate endet in der Atmosphäre angespannter Ruhe, mit der sie auch begann. Ein interessantes Werk, das nicht zuletzt durch seine dicht gewobenen thematischen Verflechtungen überzeugt. Man beachte etwa den Beginn, wo vieles absichtsvoller geschieht, als es zunächst wirken mag: über dem H der Harfe setzt die Flöte mit den Tönen c-d-dis (bzw. es) an, und was hier erst einmal der Anfang einer orientalisch anmutenden Skala ist, entspricht in anderer Anordnung später eben genau der Tonfolge D-Es-C-H. Die Triolen, die die Melodielinien der Flöte am Beginn ausschmücken, bilden die rhythmische Grundlage des Mittelteils.
Es folgt die Arabeske Nr. 2 (1973) des israelischen Komponisten Ami Maayani (1936–2019), Teil eines Zyklus von sechs Arabesken für unterschiedliche Instrumente, der in loser Folge zwischen 1961 und 2010 entstand. Maayani ließ sich häufig von hebräischer und nahöstlicher Folklore inspirieren, und so basiert auch seine Arabeske Nr. 2 auf einem arabischen Maqam, also einem Modus (die Form des Mugham, Muğam, Maqam, Maqom etc. spielt überhaupt in der Musik zahlreicher Komponisten aus dem Nahen Osten, Aserbaidschan und Zentralasien eine große Rolle, man denke etwa an Fikrət Əmirovs drei Sinfonische Muğamen oder an die großartig-archaische Sinfonie der Maqoms des Tadschiken Sijodullo Schahidi / Ziyodullo Shakhidi). Maayanis Arabeske beginnt rhapsodisch, wie improvisiert anmutend, der prächtige, reich ornamentale Harfenpart lässt Maayanis besonderes Interesse an diesem Instrument, das er mit etlichen Kompositionen bedacht hat, erkennen. Im Mittelteil festigen sich die rhythmischen Konturen, und die Musik gewinnt an Entschlossenheit, ehe das Ende wieder offener gestaltet ist. Kraftvolle, farbenfrohe Musik.
Ned Rorem (* 1923) darf mittlerweile als Nestor der US-amerikanischen Komponisten gelten. In besonderem Maße als Komponist von Liedern hervorgetreten, besitzt auch seine Instrumentalmusik in der Regel gesangliche Qualitäten. In seinem Book of Hours (1975) vollzieht er in acht kurzen Sätzen die Stundengebete nach. Den Rahmen bilden mit Matins und Compline zwei schlicht gehaltene, aufeinander Bezug nehmende Sätze in gedämpftem Tonfall, die unter anderem Glockenschläge (in der Harfe), aber auch sehr suggestiv Pausen in der Lesung imitieren. Dazwischen spielt sich eine reichhaltige Palette an Stimmungen und musikalischen Situationen ab. Der vierte und längste Satz, Terce, etwa besteht aus zwei großen Abschnitten, die jeweils einem der beiden Instrumente vorbehalten sind, und wenn die Harfe ihr Solo beginnt, dann mit geradezu romantischer Emphase, ein veritabler Gegenpol zur stillen Einkehr der Ecksätze. Andere Sätze, z. B. das an zweiter Stelle stehende scherzoartige Lauds, sind konzertant (durchaus auch im Sinne eines spielerischen Wettstreits) angelegt, und generell erweist sich Rorem als großartiger, einfallsreicher musikalischer Illustrator (man vergleiche etwa seine eigenen Anmerkungen zu diesem Werk im Beiheft).
Die CD wird mit den Drei Fragmenten (1953) des großen polnischen Komponisten Witold Lutosławski (1913–1994) beschlossen, ganz kurze Gelegenheitswerke für den Rundfunk, ausgesprochen hübsch gemacht. Sehr schön etwa das Schillern, das Changieren zwischen Dur und Moll in der einleitenden Magia, und das abschließende Presto in D-Dur bildet einen effektvollen Abschluss dieser CD. Zurecht weisen die beiden Musikerinnen im Beiheft darauf hin, dass Lutosławski in diesen Stücken gar nicht einmal so weit vom französischen Impressionismus entfernt ist, und so schließt sich auch in dieser Hinsicht der Kreis zum Beginn der CD.
Die Interpretationen von Renault und Reibaud bestechen durch eine gelungene Mischung aus Temperament und Subtilität. Die Charakteristika der hier versammelten Werke werden vorzüglich nachvollzogen, zahlreiche Details sorgfältig herausgearbeitet. Insbesondere ist das Duo ausgesprochen gut aufeinander abgestimmt und lässt so die dialogischen Strukturen, die den Werken innewohnen, ausgezeichnet zur Geltung kommen. Die Variabilität der beiden Musikerinnen ist exemplarisch am Facettenreichtum von Rorems Book of Hours nachzuvollziehen: so wissen Renault und Reibaud etwa sowohl den Sonnenaufgang nebst Scherzo in Lauds (Nr. 2) als auch die Intimität und den leisen Windhauch in Prime (Nr. 3) eindrücklich zu realisieren. Ihre Fähigkeiten zur Gestaltung größerer Formen, zum Bilden und Aufrechterhalten von Spannung belegt wiederum die Aufnahme von Liebermanns Sonate. Der Klang der CD ist sehr gut, das Beiheft informativ. Eine sehr schöne Veröffentlichung.
[Holger Sambale, September 2022]