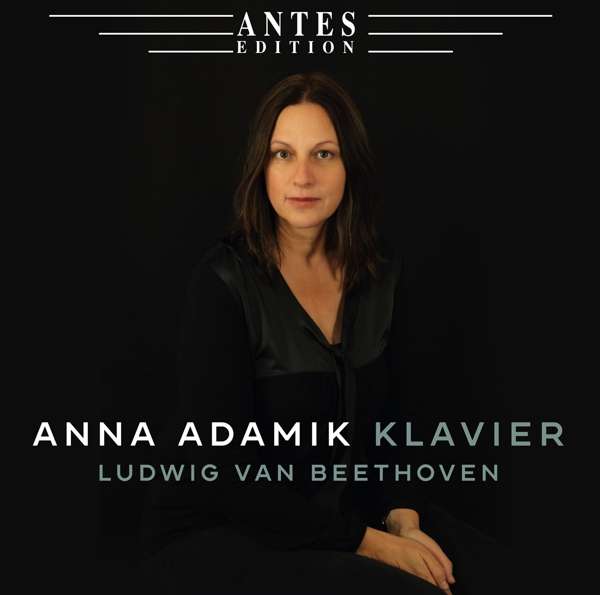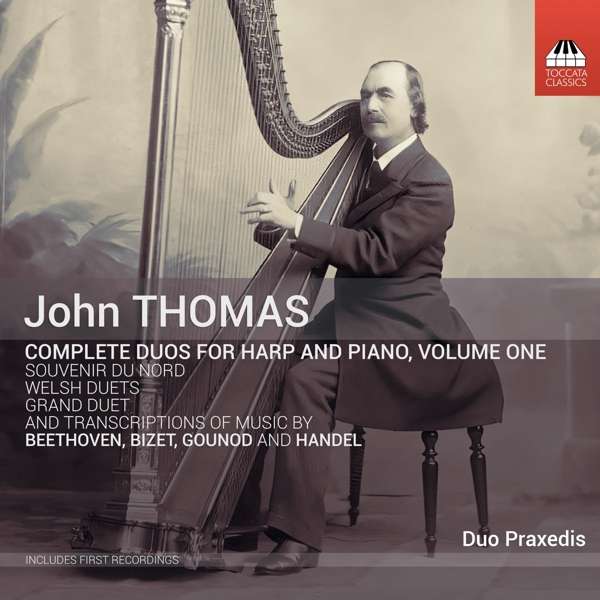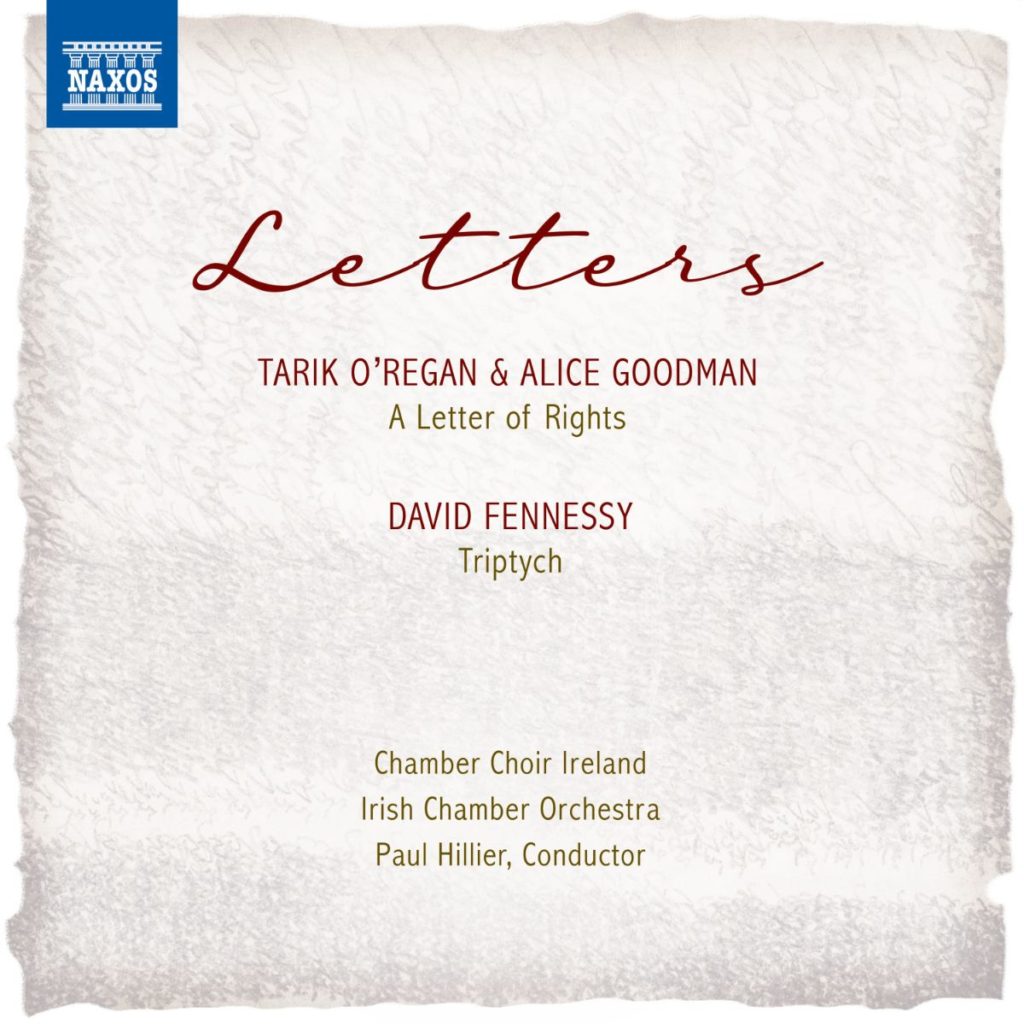Aldilà Records, ARCD 014; EAN: 9 003643 980143

Das Trio Montserrat, bestehend aus Joel Bardolet (Violine), Miquel Córdoba (Viola) und Bruno Hurtado (Violoncello), hat für Aldilà Records eine Anthologie kontrapunktischer Meisterwerke für Streichtrio eingespielt. Es erklingen drei Fugen aus Johann Sebastian Bachs Wohltemperiertem Clavier, arrangiert und mit Einleitungen versehen von Wolfgang Amadé Mozart, Paul Büttners Triosonate in sieben kanonischen Sätzen, die Kammersonate von Heinz Schubert und das Streichtrio von Reinhard Schwarz-Schilling.
Wer die Veröffentlichungen von Aldilà Records aufmerksam verfolgt hat, wird gemerkt haben, daß das Werk Johann Sebastian Bachs ebenso zu den Schwerpunkten der verdienten Münchner Musikproduktion gehört wie die Erkundung der Spuren, die die Beschäftigung mit Bach im Schaffen späterer Komponisten hinterlassen hat. Letztere hat erfreulicherweise zu einer Anzahl Einspielungen (z. T. Ersteinspielungen) von Werken Heinrich Kaminskis (1886–1946) und seiner beiden wichtigsten Schüler Reinhard Schwarz-Schilling (1904–1985) und Heinz Schubert (1908–1945) geführt, und auf diese Weise einen nicht zu unterschätzenden Beitrag dazu geleistet, der musikalischen Öffentlichkeit den Wert dieser drei hochbedeutenden Komponisten und ihrer expressiv-kontrapunktischen Musik ins Gedächtnis zurückzurufen. So erschien 2018 Hugo Schulers Einspielung der Goldberg-Variationen gekoppelt mit Klavierwerken Kaminskis und Schwarz-Schillings. Christoph Schlürens 2019 mit den Salzburg Chamber Soloists entstandene Aufnahme der Kunst der Fuge enthielt auch Schwarz-Schillings dreistimmige Studie über B-A-C-H. 2020 wurde das Solo-Album Gateway Into the Beyond des Geigers Lucas Brunnert veröffentlicht, auf welchem Bachs a-Moll-Sonate BWV 1003 von Werken des 20. Jahrhunderts umrahmt wird, darunter Heinz Schuberts Phantasie für Geige allein. Die nun vom katalanischen Trio Montserrat vorgelegte Streichtrio-Anthologie German Counterpoint schließt nahtlos an diese Reihe an: Wieder bildet Bach den Ausgangspunkt der Programmgestaltung, und wieder ist, mit Heinz Schubert und Reinhard Schwarz-Schilling, der Kaminski-Kreis vertreten (von Kaminski selbst existiert kein Streichtrio); hinzu kommt mit Paul Büttner ein Meister aus einer anderen deutschen Kontrapunktiker-Tradition, der Schule Felix Draesekes.
Joel Bardolet (Violine), Miquel Córdoba (Viola) und Bruno Hurtado (Violoncello) beginnen die Vortragsfolge mit drei der Fugen aus dem Wohltemperierten Clavier (I: es-Moll, II: Fis-Dur und fis-Moll), die von Wolfgang Amadé Mozart für Streichtrio gesetzt und mit langsamen Einleitungen versehen wurden. Mozart, der die Fugen aus einer Auswahl-Abschrift kannte, die die originalen Präludien nicht enthielt, ging seine Aufgabe gewissenhaft an, bemüht den Meisterstücken Bachs jeweils ein ihnen würdiges Vorspiel voranzustellen. Das Resultat ist höchst reizvoll, denn Mozart ist selbst eine so in sich gefestigte Künstlerpersönlichkeit, dazu auch zu sehr von anderen Ausgangsbedingungen geprägt, als dass ihm eine völlige stilistische Angleichung an Bach gelingen würde. So stehen hier zwei Meister verschiedener Epochen einander Auge in Auge gegenüber, ihre Zuhörer zu aufmerksamem, stilvergleichendem Hören einladend.
Dass der nächste Programmpunkt Paul Büttner gewidmet ist, dessen Geburtstag sich im Dezember 2020, wenige Tage vor dem Beethoven-Jubiläum, zum 150. Male jährte, ist zunächst schon allein deswegen erfreulich, da Büttner bislang auf CD nur durch eine einzige Veröffentlichung mit historischen Aufnahmen seiner Vierten Symphonie und der Heroischen Ouvertüre (Sterling) repräsentiert war. Mit der Einspielung seiner Triosonate wurde nun nicht nur zum ersten Mal eines seiner Kammermusikwerke auf Tonträger vorgelegt, sondern überhaupt erstmals eine Komposition Büttners direkt für die CD aufgenommen. Man kann nur wünschen, dass dies ein Anfang ist, denn die geringe Anzahl der bisherigen Veröffentlichungen steht in eklatantem Missverhältnis nicht nur zur Qualität der Büttnerschen Musik, sondern auch zu dem Ansehen, dass der Komponist zu Lebzeiten nachweislich genoss: Zwischen 1915 und 1933 waren seine vier Symphonien in ganz Deutschland regelmäßig zu hören, berühmte Dirigenten wie Arthur Nikisch, Paul Scheinpflug, Carl Schuricht, Fritz Busch und Paul van Kempen setzten sich für ihn ein. Dass diese Rezeption jäh abbrach, hat politische Gründe: Als Sozialdemokrat und Ehemann der jüdischen SPD- bzw. ASPS-Politikerin Eva Büttner wurde Paul Büttner nach jahrelanger Tätigkeit als künstlerischer Direktor des Dresdner Konservatoriums, Kompositionslehrer, Musikkritiker und Arbeiterchorleiter von den Nationalsozialisten aus allen Ämtern gedrängt. In erzwungener innerer Emigration starb er 1943. Nach dem Krieg bewahrte ihm die DDR zwar ein ehrendes Andenken, seine Werke wurden noch gelegentlich in Ostdeutschland aufgeführt, doch galt er als altmodischer Spätromantiker, als nicht mehr „zeitgemäß“; auch eine wissenschaftliche Beschäftigung mit Leben und Werk des Komponisten setzte damals nicht ein.
Wer Büttner von der Sterling-CD her als hervorragenden Gestalter groß dimensionierter symphonischer Architektur kennt, wird vielleicht angenehm überrascht sein, ihn in der Triosonate von einer ganz anderen Seite kennen zu lernen, nämlich als ebenso meisterlichen Miniaturisten. Es handelt sich weder um ein barockisierendes oder bachisierendes Stück, noch um eines in traditioneller Sonatenform, sondern um „Kanons mit Umkehrungen im doppelten Kontrapunkt der Duodezime“, wie der Komponist im Untertitel vermerkt. Die Bezeichnung „Sonate“ ist dahingehend zu verstehen, dass die sieben kurzen Sätze (sie dauern zwischen 39 Sekunden und 3 ¾ Minuten) keine Sammlung darstellen, sondern einen Zyklus bilden – was durch dezente Anspielungen untereinander ebenso bestätigt wird wie durch die tonale Gruppierung um das Zentrum G. Mit diesem Werk demonstriert Büttner, welch souveränes kontrapunktisches Handwerk er sich als Meisterschüler Felix Draesekes erworben hat, und legt ein Kabinettstück vor, dem man durchaus in der Geschichte des „deutschen Kontrapunkts“ einen Ehrenplatz zugestehen darf. Allen Sätzen liegt das gleiche Prinzip zugrunde: Zwei Stimmen spielen im Kanon, die dritte ergänzt freie Töne. Aber es herrscht nicht akademische Prinzipienreiterei in diesem Werk, sondern die Phantasie eines großen Künstlers. Zunächst zeigt sich diese in den verschiedenen Charakteren der einzelnen Sätze und der geschickten Ausnutzung der klanglichen Möglichkeiten der Streichinstrumente. Für Abwechslung sorgen weiterhin technische Kunstgriffe wie Stimmentausch oder Änderung des Einsatzintervalls. Noch wichtiger erscheint jedoch, dass Büttner die Sätze unterschiedlich streng anlegt. Stellt etwa in Nr. 2 und Nr. 4, worin die Imitation im Abstand eines Taktes erfolgt, die kanonische Konstruktion den entscheidenden musikalischen Gedanken dar, so erscheint sie in den beiden langsamen Sätzen Nr. 3 und Nr. 5 beinahe zu einem bloßen Wandern der sich über mehrere Takte erstreckenden Melodien von Stimme zu Stimme gemildert und tritt an Bedeutung gegenüber dem „vollen Gesangston“ (Vortragsanweisung im dritten Satz) zurück. Auch tragen die nicht-kanonischen Takte und die freie dritte Stimme Wesentliches zum Gesamteindruck bei.
Wenige Jahre trennen Büttners wahrscheinlich um 1930 entstandene Triosonate von der zwischen 1934 und 1937 komponierten Kammersonate des eine Generation jüngeren Heinz Schubert. Formal und stilistisch unterscheiden sich beide Werke stark. Lässt sich Büttners Stück insgesamt als heiter und extravertiert charakterisieren (der Freund des werktätigen Volkes lässt es sich auch im strengen Stil nicht nehmen, gelegentlich volkstümliche Töne anzuschlagen), so wirkt in Schuberts Sonate jeder Ton von der Welt abgewandt. „Ach Gott, vom Himmel sieh darein“ bildet in chromatischer Verschärfung die Grundlage für den chaconneartigen Mittelsatz. Ob es sich um einen Kommentar zu den gesellschaftlichen Verhältnissen der Entstehungszeit des Werkes handelt? Es fällt jedenfalls auf, dass Schubert später in seinem zu Beginn des Zweiten Weltkriegs komponierten Hymnischen Konzert ausgerechnet die „Heerscharen“ (Sabaoth) des Te-Deum-Textes nicht vertont und seinem Ambrosianischen Konzert für Klavier und Orchester, dem letzten Werk, das er vor seinem Kriegstod vollendete, der Choral „Verleih‘ uns Frieden gnädiglich“ zugrunde liegt.
Am Anfang der Kammersonate steht ein Stück, das wie eine Improvisation anhebt, präludierende Figurationen wechseln mit Tonrepetitionen ab, wie sie auch Schuberts Vorbild Heinrich Kaminski häufig verwendet. Während sie allerdings bei Kaminski in der Regel an das ehrfürchtige Stammeln eines verzückten Beters erinnern, stellt sich dieser Eindruck hier nicht ein; eher möchte man an das Atemholen eines zutiefst Erschütterten denken. Wie Schubert in diesem Satz, ohne irgendwelchen vorgefertigten Schemata zu folgen, mittels polyphoner Interaktion der Stimmen das Geschehen immer weiter verdichtet und der Musik zunehmende Stringenz verleiht, ist schlicht faszinierend. Eine strenge, unablässig vorangetriebene Introspektion scheint hier Musik geworden zu sein. Am Schluss des Werkes steht eine Fuge, deren Thema während des Verlaufs variiert wird, wobei das Tempo allmählich zunimmt. Der Schluss berstet schier vor Ausdruckskraft. Schuberts Harmonik basiert auf einfachen tonalen Grundverhältnissen, er erkundet in seinem Schaffen jedoch ausgiebig die Möglichkeiten dissonanter Linienführung. Eine diesbezüglich besonders aufschlussreiche Passage aus der finalen Steigerung wurde zur genaueren Veranschaulichung noch einmal separat und und in Zeitlupentempo aufgenommen und dem eigentlichen CD-Programm als Anhang beigegeben. Auch wurden die entsprechenden Noten im Beiheft abgedruckt.
Im Gegensatz zu Heinz Schubert war es Reinhard Schwarz-Schilling vergönnt, ein Spätwerk schaffen zu können, zu welchem sein 1983, zwei Jahre vor seinem Tod, komponiertes Streichtrio gehört. Es besteht nur aus zwei Sätzen, einer mäßig bewegten Rhapsodie und einem langsamen Notturno, die zusammen etwa 10 Minuten dauern. Sie gehören zum Edelsten und Abgeklärtesten, das sich in der Kammermusik des 20. Jahrhunderts finden lässt. Kein Ton ist zuviel, keiner zu wenig. Alles klingt hier entrückt, als ob das Stück sich gar nicht darum zu kümmern schiene, ob jemand zuhört oder nicht. Gelassen und vollkommen in sich ruhend entfaltet es seine klingenden Phänomene. Die stilistischen Grundlagen sind ganz ähnliche wie in Schuberts Kammersonate, doch wie anders klingt diese späte Musik Schwarz-Schillings!
Die drei Musiker des Trio Montserrat sind einander perfekte Partner. Technisch ist ihnen nichts zu schwer, wie man etwa an der makellosen Ausführung der raschen Flageoletts im Vierten Satz des Büttner-Trios hören kann. Zugleich ist sich jeder der Bedeutung seiner Stimme völlig bewusst, was gerade für das Streichtriospiel von essentieller Wichtigkeit ist, kommt es ja hier noch stärker auf jeden einzelnen Ton an als beim Musizieren in Quartett- und größeren Besetzungen, in denen die Vielstimmigkeit von den Ausführenden zwangsläufig erfordert, zwischen „Vordergrund“- und „Hintergrund“-Geschehen zu unterscheiden. Dieses Gespür für das Zusammenwirken der Stimmen ermöglicht dem Trio Montserrat nicht nur ein tadelloses Zusammenspiel, die Musiker bedenken offenbar auch in jedem Moment den Gesamtverlauf der einzelnen Stücke. Sie entwickeln zielstrebig die Phrasen auf die tonalen Schwerpunkte hin – besonders schön zu hören in den Mozart-Präludien –, wodurch sich die jeweilige musikalische Handlung ganz ungezwungen, wie von selbst entfaltet. Keiner der hier zu hörenden Komponisten betrachtete Kontrapunkt als bloße akademische Disziplin. Er war ihnen allen Stilmittel poetischen Ausdrucks, etwas Natürliches, das selbstverständlich zur Kunst dazu gehört. Das Trio Montserrat bringt diese Natürlichkeit zum Klingen.
[Norbert Florian Schuck, Februar 2021]