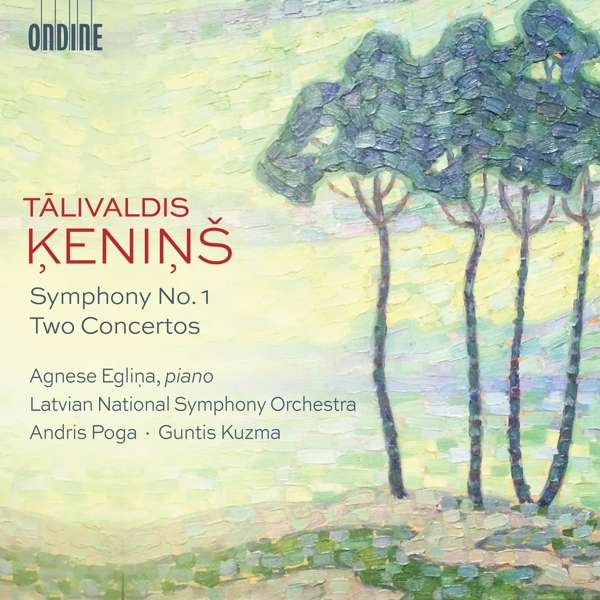Sonus Eterna, 37423; EAN: 4 260398 610069

Auf dem zweiten Teil der Gesamteinspielung aller Klavierwerke Gordon Sherwoods von Masha Dimitrieva hören wir Stücke, die eine gewisse Hommagefunktion erfüllen: Die „Air“ der „Sieben beschreibenden Klavierstücke“ op. 6 steht im Zeichen Bartóks, die zwei „Rondos im klassischen Stil“ op. 4 greifen die Musik Haydns und Schuberts auf, die „Drei Stücke op. 22“ bekennen sich zu Hindemith. Komplexer werden solche Zuordnungen bei den längeren Werken dieser CD: Die Sonate op. 111+11 bezieht sich auf Beethoven, ist aber in Motto und Klang in buddhistischen Sphären errichtet. Die abschließenden Blues-Variationen op. 33 konzipierte Sherwood auf ein Thema von Peter Heaton, widmete das Werk Fats Waller – in seinem Innersten ist es jedoch eine Hommage auf die gesamte Ragtime-, Blues und Barpiano-Szene.
Das Unglaubliche in der Musik Gordon Sherwoods ist seine Fähigkeit, in jedem Stil er selbst zu bleiben. Mühelos, gar schwerelos, mäandert er zwischen Bach, Wiener Klassik, Romanik und Moderne bis hin zum Jazz, nimmt sich dabei das Beste aus jedem Stil heraus und fusioniert es zu einer eigenen, vielseitigen wie facettenreichen Tonsprache. Nie gleichen sich zwei Werke Sherwoods bezüglich ihrer Tonsprache und doch erkennt man eines seiner Stücke sofort anhand mancher Harmonieabfolgen, Muster oder Figurationen, die er favorisiert. In meiner Rezension über den ersten Teil der Einspielung seiner Klavierwerke vermerkte ich noch: „Charakteristisch für ihn ist lediglich, dass sein Schaffen keinen verfestigten Stil aufweist.“ [Zitat: siehe den Beitrag „Weltbüger und Bettler“] Heute würde ich ergänzen, dass er trotz aller Divergenzen doch einen Funken aufweist, die ihn unverkennbar macht in seiner Kompositionsweise. Wie genau sich dieser niederschlägt, das wäre ein spannender Ausgangspunkt für die Musikforschung.
Was seine Biographie angeht, so könnte man alleine viele Seiten füllen, denn Sherwood führte ein filmreich anarchisches, von allen hiesigen Konventionen befreites Leben. Er opferte eine geordnete Lebensführung als Komponist (den Erfolgen seiner frühen Jahre nach zu urteilen sicherlich als gefeierter Star der zeitgenössischen Musik) seinem Drang nach Freiheit; so das Geld es zuließ, reiste er und ließ sich in Afrika oder Asien zu neuer Musik inspirieren. Wo es finanziell fehlte, ging er nach Paris, um dort „Self-Sponsoring“ zu betreiben, also Passanten auf der Straße um eine Bezahlung für seine Musik zu bitten. Wer von den Passanten hätte wissen können, dass einer der Meisterschüler Coplands, Jarnachs und Petrassis, dessen Symphonie op. 3 durch Mitropoulos durchschlagenden Erfolg feierte, gerade um Gaben bettelte. Nur wenige Freunde und Verehrer seiner Kunst wussten um das wahre Genie Sherwoods; erst der Film „Der Bettler von Paris“ verlieh ihm in Deutschland kurzzeitig Aufmerksamkeit – auch Masha Dimitrieva sah diesen Film und versuchte sogleich, diesen wundersamen Mann zu kontaktieren. Über mehrere Ecken klappte dies schließlich und führte zu beidseitig inspirierenden Begegnungen: Gordon Sherwood erhielt den Funken, sein lang geplantes Klavierkonzert gemeinsam mit Masha Dimitrieva in die Tat umzusetzen; auch widmete er ihr andere seiner Kompositionen. Unter anderem steht sie in der Widmung der hier zu hörenden Sonate op. 111+11. Masha Dimitrieva ist es auch, die nach dem Tod Sherwoods sein geistiges Erbe verwaltet und sich als Leitfigur für seine Musik einsetzt. Nicht nur sämtliche seiner Klavierwerke spielt sie aktuell ein, sondern auch alle Lieder.
Die große Herausforderung liegt in diesem Unterfangen auf der Hand: Die Musik Sherwoods verlangt eine souveräne Beherrschung sämtlicher Stile verschiedener Epochen oder gar von Personalstilen einzelner Komponisten, darüber hinaus das Verständnis, hinter diese oberflächlichen Eigentümlichkeiten zu sehen und den Sherwood eigenen Kern zu entdecken.
Direkt nach seiner neutönerischen Symphonie op. 3, durch welche er zu einem der spannendsten jungen Tonsetzer gekürt wurde, schrieb er die Zwei Wiener Rondos op. 4. Auf den ersten Blick mögen sie wie Studienwerke klingen, geschrieben um sich den Stilen der großen Meister anzunähern, doch es steckt mehr dahinter: Sherwood präsentiert nicht nur meisterliche Beherrschung der Handschriften von Haydn und Schubert, sondern kann sie auf unvergleichliche Weise eigenständig weiterführen. Bereits hier bricht er mit den Konventionen und schreibt wissentlich wider die Art der Musik, die ihn neulich noch bekannt machte. Leichter kann man auch als Sherwood-unerfahrener Hörer seine kompositorischen Eigentümlichkeiten in den Sieben beschreibenden Klavierstücken op. 6 und den später entstandenen Drei Stücken op. 22 durchhören. Beide nähern sich zwar ebenso anderen Komponisten an, mit Hindemith und Bartók zwei Meistern der Moderne, doch können in den hier freieren, dissonanteren Tonräumen mehr von Sherwoods favorisierten Wendungen auftreten. Besondere Beachtung verdienen die Zwölf Variationen auf ein Blues-Thema op. 33. Sherwood arbeitete lange Zeit als Barpianist und machte sich so mit den tanzbaren Rhythmen vertraut, mit den Eigenheiten des Blues, aber auch damit, wie man ihn durchbrechen kann. In den Variationen nimmt er den Blues in seine Mikroteilchen auseinander und durchdringt die Form bis ins kleinste Detail, um sie auf teils gar widerborstige Weise neu zusammenzusetzen. Manche der Variationen könnten ohne Weiteres in einer Bar erklingen, andere strotzen vor Dissonanzen und gespannten Momenten, wieder andere glühen vor rhythmischer (Tanz-)Energie. Halsbrecherisch virtuos spielt Sherwood genau mit der Bruchstelle zwischen sogenannter ernster und leichter Musik, zeigt verstohlen heimlich beiden die lange Nase. Hier hört man am deutlichsten, welche Harmoniewendungen Sherwood präferiert, welche Motivschnipsel ihn beschäftigen und was seine Handschrift ausmacht. Den Höhepunkt der CD macht die halbstündige Sonate op. 111+11 aus, die in zweisätziger Faktur einen gewaltig großen Aufbau zeichnet, wie man ihn in dieser Stringenz selten in der Musikgeschichte erlebt. Die Sätze beschreiben zwei buddhistische Entwicklungsstadien: Sotapanna (Vorbereitendes Stadium des buddhistischen Heilsweges. Brodelnd vor Wut, Bitterkeit und gerechtem Zorn. Gier und Selbstsucht sind überwunden, aber noch nicht Ärger und Angst) und Arahat (Endgültiges Stadium des buddhistischen Heilsweges. Besänftigt durch tiefen inneren Frieden, Gelassenheit und Behagen. Ärger, Bitterkeit und Angst sind überwunden). Diesen Weg der Reinigung zeichnet Sherwood – selbst praktizierender Buddhist – in der Musik nach und führt uns hin zu einem verheißenden Höhepunkt. Der Weg wirkt mühsam, voller Verlockungen und Hindernissen, doch die Erleuchtung lockt und zieht uns das Stück entlang. Erzählend, beschreibend, verheißend bannt uns die Musik und lässt uns nicht los, ehe wir einen kurzen Blick auf die Freuden werfen konnten, welche der Heilsweg verspricht.
Masha Dimitrieva führt uns durch diese Musik, angetrieben von der tiefen Zuneigung zu jedem der Stücke und von ihrer Mission, die Musik des „Bettlers von Paris“ erstmalig und vollständig zugänglich zu machen. Nicht nur technisch meistert sie jede Hürde mit Bravour, sondern auch musikalisch durch tiefes Verständnis zu jedem Stil und zum Kern, Sherwoods omnipräsente Handschrift. Perlend klar und heiter klingen die Wiener Rondos, swingend leichtfüßig die Blues-Variationen, verhaltener die Air und perkussiv fokussiert die Stücke op. 22. Aus der Sonate holt Dimitrieva alles heraus, was man sich als Hörer wünschen kann. Durch den allmählichen Aufbau und die Beibehaltung eines kontinuierlichen Stroms nach vorne, der über sämtliche Abbiegungen und Ausschweifungen der Musik hinweg spürbar bleibt, bannt sie uns in die Musik und zelebriert die buddhistische Philosophie durch ihr Spiel.
[Oliver Fraenzke, Dezember 2020]