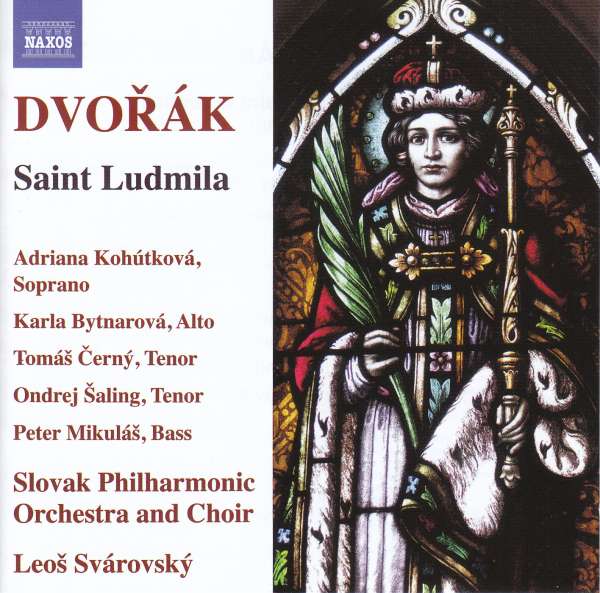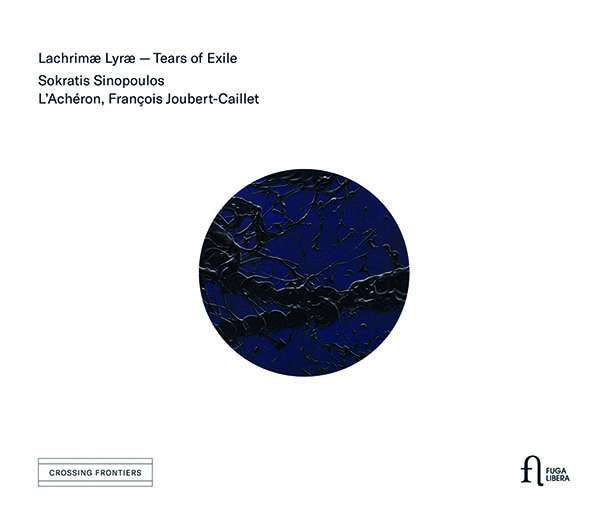Freitag, 25. Oktober 2019 in Salzburg, Campus der Rudolf Steiner-Schule, Dorothea Porsche Saal – Konzert „Kunst der Fuge“ ; Christoph Schlüren, Dirigent; Salzburg Chamber Soloists (Leitung: Lavard Skou-Larsen); Werke von Bach, Schwarz-Schilling, Schumann und Aho
Johann Sebastian Bach: Die Kunst der Fuge – Contrapunctus I – XI; Finale, Quadrupelfuge, unvollendet; Choral, Vor Deinen Thron trete ich hiermit; Spiegelungen I und II a 4; Robert Schumann (1810-1856) Orgelfuge g-Moll über BACH Op.60/3 a 4 2019 transkribiert von Dan Turcanu; Reinhard Schwarz-Schilling (1904-1985) Studie über BACH a 3; Finale Quadrupelfuge, 2012 vollendet von Kalevi Aho (geb.1949)
Er ist und bleibt das A&O der Musik, Johann Sebastian Bach. Das ist die ganz einfache (?) Feststellung nach dem gestrigen Konzert im Dorothea Porsche Saal im Salzburger Odeion.
Nach einer Einführung mit dem Dirigenten des Abends, Christoph Schlüren, begann um 19 Uhr mit dem Contrapunctus 1 ein Abend der überwältigenden Musik. Die Salzburger Chamber Soloists mit ihrem Konzertmeister Lavard Skou-Larsen musizierten unter der Leitung des Münchener Dirigenten Christoph Schlüren ein intensives Programm mit ausgewählten Stücken aus dem letzten Meisterwerk Bachs, der „Kunst der Fuge“. Und was für eine Kunst sich da entfaltetete! Immer neue und unvermutete Aspekte des Eingangs-Themas wurden aufgeblättert und im Entstehen aus der Taufe gehoben. Geleitet vom gelassenen und dennoch energischen Dirigieren wurde dieser Riesen-Kosmos aus Klängen, Rhythmen, Harmonien und Stimmführungen von den mit intensivstem geistig-seelisch-musikalisch spielenden Musikerinnen und Musikern zum hörgewaltigen Erleben. Was waren in den vertracktesten Kombinationen, den ausgefeiltesten Zusammenklängen, den kraftvollsten Durchdringungen der einzelnen Stimmen für Offenbarungen vor unsere Ohren, Augen und Herzen gestellt.
Alle 11 Contapuncti – jeder einzelne eine eigene Welt – offenbarten nicht nur die unglaubliche und immer wieder aufs Neue faszinierende Meisterschaft des „Alten Bach“, sie gaben im zweiten Teil auch den Nährboden für zwei Kompositionen von Robert Schumann und Reinhard Schwarz-Schilling und regten eben auch den finnischen Komponisten Kalevi Aho 2012 zu der Vollendung der letzten Fuge an. Welche Steigerung auch oder gerade heute möglich ist, zeigte dieser Komponist und mit ihm die auf allerhöchstem Niveau Spielenden. Die schier bis zu einer unmöglich scheinenden Ausbreitung der Kontrapunktik und der musikalischen Energie ließ einen denkwürdigen Abend ausklingen, der sicher zum allertiefsten gehört, was ich bisher in meinem Leben erleben durfte.
Dank an alle Beteiligten für diesen Abend!
[Ulrich Hermann, Oktober 2019]