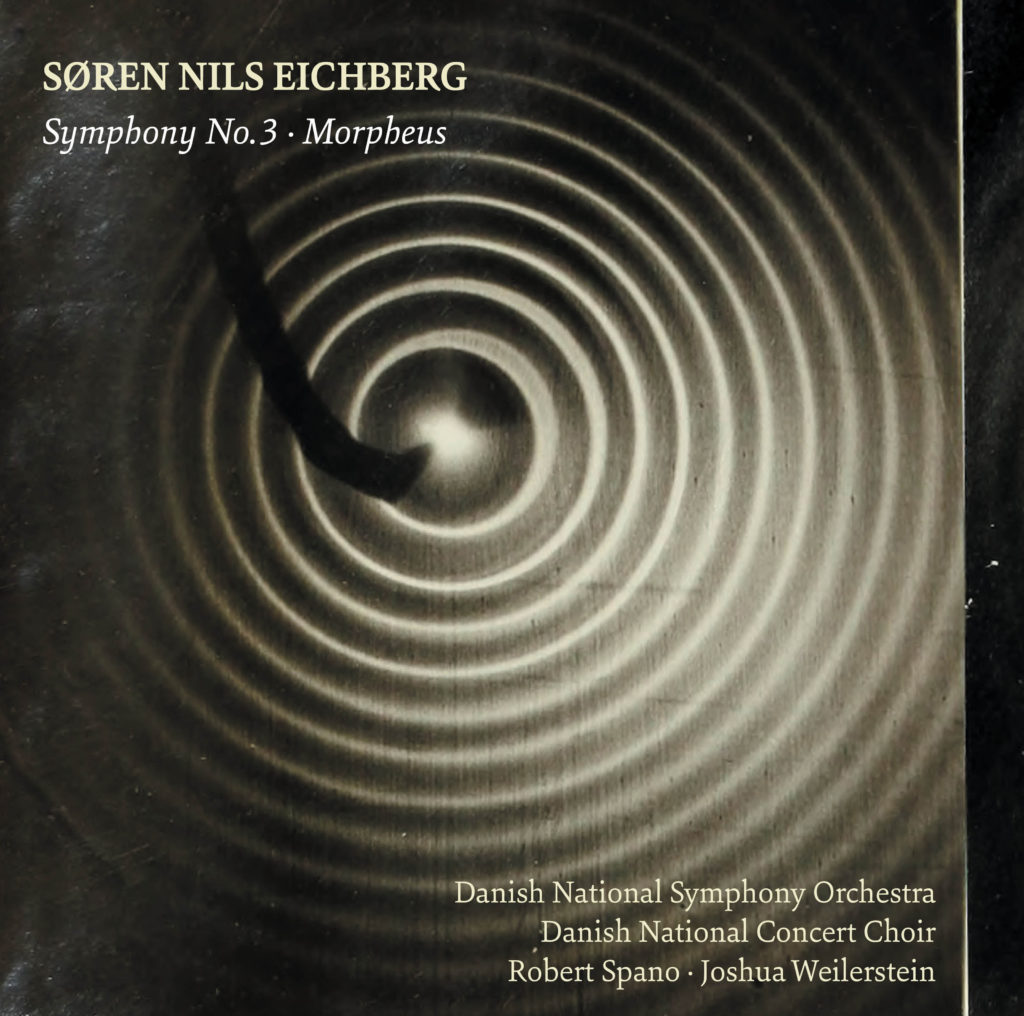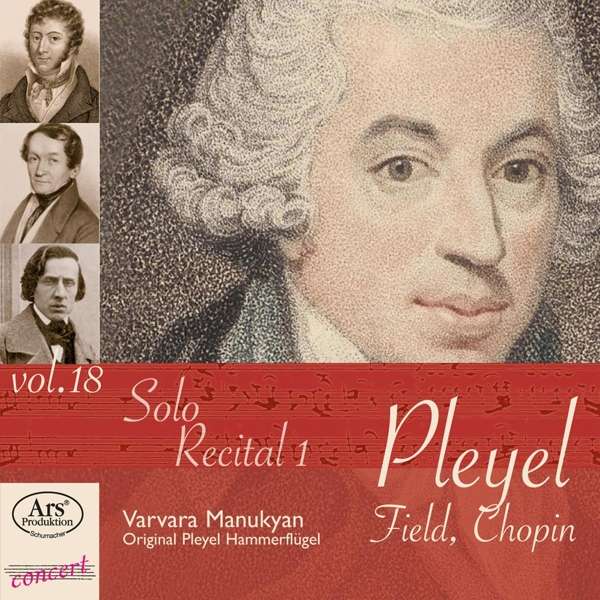Zhen Chen sprach mit Stefan Pieper über die Kunst, einen intensiven durchgängigen Bogen herzustellen, aber auch über die imaginäre Linie, jenseits derer sich ein respektvoller Interpret mit dem Willen des Komponisten auseinandersetzt. Anlass ist die neue CD mit Johannes Brahms drei Sonaten für Klavier und Violine, die für Zhen Chen zugegebenermaßen der Annäherung an einen Giganten gleichkommt.
Zusammen mit der Violinistin Elmira Darvarova kam es zu einer neuen Art der Darbietung, die vor allem den ungefilterten Blickwinkel favorisiert. Zurück zum Notentext, zurück zu dem, was Brahms mit seinen Kompositionen sagen will jenseits aller aufgesetzten Manierismen und exaltierten Rubati; das war das selbst auferlegte Gebot!
Die drei Sonaten von Johannes Brahms
fangen eine ganz andere Stimmung ein, als jene, wie ich mir Ihre
Lebenswirklichkeit im dynamischen, schnell getakteten New York
vorstelle. Spielt dieser Kontrast eine besondere Rolle für Sie?
Welche Haltung haben Sie als junger in New York lebender Musiker in
Bezug auf Johannes Brahms?
Wenn wir über Brahms reden, ist das
eine sehr ernsthafte Sache. Unsere Haltung wollen wir letztlich mit
der Covergestaltung der CD unterstreichen: Unsere Herangehensweise
ist klassisch, ja in gewisser Hinsicht sogar altmodisch. Aber dafür
sehr natürlich und ehrlich. Eben so, wie wir beide uns auf dem
Coverfoto präsentieren. Das drückt schon aus, wie wir Brahms
spielen wollen.
Welche Ideale verfolgen Sie bei der Darbietung?
Wir wollen die Musik fließen lassen. In den letzten Jahren haben wir vor allem an diesem Musizierideal gearbeitet. Wir haben dafür viele Aufnahmen gehört, aber kaum eine ging in jene Richtung, die wir verfolgen wollten. Jeder spielt Brahms. Viele Aufnahmen klingen sehr dunkel und sind voller Schwere. Warum spielen das alle Leute so? Vermutlich produziert dies jene landläufige Meinung, dass Brahms ja naturgemäß langweilig, oder lang-atmig und voller Schwere ist. Dieser Eindruck liegt wirklich an zu vielen Spielern, die bei diesen Stücken die Zeitmaße zu sehr ausdehnen. Wenn ich mir aber die Noten ganz vorurteilsfrei ansehe, sehe ich keine Anweisungen, die darauf hindeuten. Deswegen suchen wir unseren eigenen Weg. Die Musik soll wieder natürlich und fließend sein. Ich glaube, es gibt keine Aufnahme wie unsere aktuelle. Wir haben ganz bewusst die Tempi gestrafft. Unser erster Satz ist gerade mal 9 Minuten kurz. Bei vielen andere Interpretationen läuft es auf fast 11 Minuten hinaus.
Nicht falsch verstehen: Ich möchte nicht bevormunden. Ich bin noch sehr jung und respektiere die Erfahrung anderer. Aber man muss das Stück als Ganzes sehen, als Stück für Klavier und Violine. Wenn Du zu viele Rubato einbaust, zerschneidest Du sehr schnell alles und es entstehen keine Bögen mehr dabei. Klar, dass sich das Publikum dann verzettelt. Wir beabsichtigen mit unserer Herangehensweise andere Wirkungen. Nach einem Konzert in Seattle kam eine Zuhörerin in den Backstagebereich und wollte wissen, warum sie diese Musik so anders, so neu erlebt hat bei uns. Ich bin sehr glücklich über so ein Feedback. Fazit: Brahms ist eben nicht langatmig und auch alles andere als langweilig. Es kommt eben auf die Art zu spielen an. Wir spielen nicht einfach nur schneller. Aber wir übertreiben die Rubatos nicht und verzetteln uns darin nicht.
War dies ein langer Weg?
Im Jahr 2010 habe ich die erste Sonate
gespielt. Es war erstmal unglaublich schwer. Ich blieb manchmal
mittendrin stecken. Nicht wegen der Technik, sondern wegen des
mentalen Spannungsbogens. Wenn man wirklich diese weitgespannten
Linien konsequent ausgestaltet, fordert dies immens. Ich bin so oft
an meine Grenzen gestoßen dabei. Ich habe dann auch die Sonaten Nr.
2 und Sonate Nr. 3 erarbeitet. Das Verständnis wuchs immens und
daraus auch verschiedene Wege, sie zu spielen.
Welchen Gewinn bringt es, sich mit
dem Urtext auseinanderzusetzen?
Wir entnehmen
alles vom Originaltext. Allein das gibt schon ein Gefühl für das
richtige Tempo. In dieser Hinsicht liegen viele Interpretationen
meiner Meinung nach falsch. Das hat einen Verlust des Storytellings
zur Folge. Dadurch verspielen viele Interpreten die Chance, wirkliche
Emotion zu zeigen.
Welche Bedingungen mussten im Duo
erfüllt sein für diese Herausforderung?
Mit meiner Partnerin auf der Violine besteht eine hervorragende gemeinsame Basis. Elmira Darvarova ist eine sehr leidenschaftliche Spielerin mit extrem viel Energie. Sie hat einen viel größeren Erfahrungshorizont, allein, weil sie älter ist als ich. Ich habe mir viel von ihr abgeschaut – vor allem, wenn es um das nötige Selbstbewusstsein geht, um ein solches Werk darzustellen. Ich gewinne auf jeden Fall immer mehr persönliche und künstlerische Stärke durch diese Verbindung. Wenn Elmira spielt, erzählt dies immer eine Geschichte.
Was ist die größte Herausforderung
bei diesen Sonaten?
Es geht darum, die Intensität zu
steigern. Du kannst wirklich in einen harten Widerstreit mit der
Melodie eintreten. Und es sind ja auch zwei Instrumente, die bei
aller Symbiose auch einen intensiven Widerstreit pflegen. Um diese
Dramatik geht es – und sie geht sehr schnell verloren, wenn die
Balance nicht mehr stimmt.
Sie sind sehr fasziniert davon, die
Dinge von Grund auf zu erforschen. Diskutieren Sie beide solche
Prozesse kontrovers oder ergibt sich alles von selbst aus dem Spiel
heraus?
Wir reden viel, vor und während der
Proben. Elmira und ich reflektieren und testen verschiedene
Spielweisen aus. Es klingt daher auch immer wieder anders. Es gibt
aber ein Leitprinzip: Wir versuchen, uns in die Art und Weise hinein
zu versetzen, wie Johannes Brahms es gesehen und gefordert hat. Aber
wir wollen auch eigene Gefühle zeigen. Nach jedem Spiel lesen wir
nochmal den Notentext und reflektieren, was wir vernachlässigt
haben. Wir nähern uns dadurch immer mehr an dem Zustand an, wie
Brahms ihn eingefordert hat. Es ist sehr viel vorgegeben in den
Noten, immens viele Vortragsbezeichnungen. Fast könnte man meinen,
dass Brahms ein echter Kontrollfreak war (lacht!).
Wo bleibt der Raum für
eigenständigen Ausdruck?
Die Räume für eigene
interpretatorische Freiräume sind von Brahms sehr eng gesteckt.
Trotzdem möchten wir in diesem Rahmen individuelle Farbe bekennen
und ein subjektives Verständnis unserer Musik zeigen. Aber es geht
es vor allem immer darum, was Brahms wirklich wollte. Dann darfst Du
nicht zu viel auftragen an persönlichen Extravaganzen.
Also ist es ein Dialog zwischen
Ihren Emotionen von heute und dem Personalstil von Johannes Brahms?
So kann man es
nennen. Ich habe einiges über die biografischen Hintergründe von
Brahms gelesen. So etwas muss man wissen. Meine eigene Rolle ist hier
die eines Geschichtenerzählers. Aber es geht nicht um meine
Geschichte, sondern um die, die der Komponist geschrieben hat. Der
Komponist ist ein Mensch und ich auch. Ich respektiere den
Komponisten. Es bleibt eine imaginäre Grenze, die ich als
verantwortungsvoller Interpret nicht überschreiten kann. Ich muss
dem Komponisten folgen. Klar, ich kann rubato machen, es ist
schließlich ein romantisches Stück. Aber es muss kontrollierbar
bleiben. Ich darf die Linie, die der Komponist gelegt hat, nicht
zerstören.
Sie sind beide in recht vielseitigen
musikalischen Disziplinen unterwegs. Sie komponieren selber Musik für
die Gegenwart und beschäftigen sich mit klassischer chinesischer
Musik. Elmira ist auch im Jazz und anderen heutigen Musikgenres
zuhause. Wie wird Ihre Brahms-Interpretation durch solche Erfahrungen
bereichert? Andersherum: Wie sehr beflügelt die Auseinandersetzung
mit Brahms Ihre freien Betätigungen?
Das ist eine sehr
interessante Frage. Ich begann 2015 mit dem Komponieren und hatte bis
dahin auch Brahms sehr gründlich studiert. Daraus ging ein tiefes
Verständnis für kompliziertere Strukturen hervor – und die halfen
wieder meinem Feeling, um eigene Stücke zu kreieren. Brahms ist ein
Meister, der immer haushoch über meinem Versuchen rangieren wird.
Aber ich lerne eine Menge aus solchen Meisterwerken. Etwa, wie ich
mit Harmonien Emotionen erzeuge, wie man eine lange Linien aufbauen
kann und es dadurch nicht länger beliebig ist. Ich lerne so viel.
Wie sehr fühlen Sie sich von New
York inspiriert?
In New York
bekommt man so viele Impulse: Diese Stadt markiert die Vereinten
Nationen wie in einem Mikrokosmos. Alle Farben, Kulturen,
Traditionen, sämtliche Arten zu leben und zu feiern sind hier auf
engem Raum versammelt. Du hörst afrikanische Musik oder Klänge aus
Indien. Diese Metropole macht offen, sensibel, hellhörig und wach.
Es ist eine gute Stadt für Musiker. Der Ideale Ort, um lebendig zu
sein. Man lernt Menschen kennen und Menschen finden Dich, dass sich
immer wieder neue Chancen und Möglichkeiten ergeben. Ich bin sehr
glücklich, hier leben zu können.