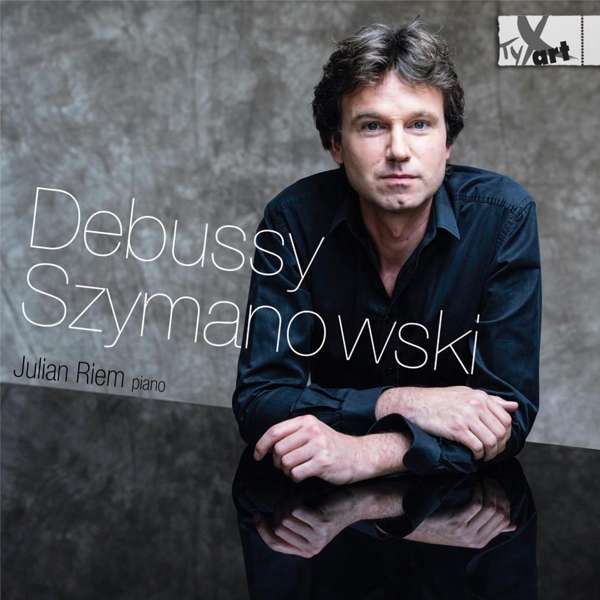Die Sopranistin Charlotte Schäfer hat mit dem Orchester „Concerto con Anima“ unter Leitung von Michael Preiser Arien aus der Feder verschiedener bekannter, aber auch unbekannter Komponisten aufgenommen, die alle auf dem Libretto zur Oper Demofoonte basieren. Dieser Text von Pietro Metastasio kann als literarisches Manifest für ein neues Menschenbild der Aufklärung betrachtet werden. Entsprechend groß war die zeitgenössische Ausstrahlung: Der Text wurde von fast 80 (!) Komponisten vertont. Solche gewaltigen Dimensionen entfachten den idealistischen Forschergeist der Sängerin Charlotte Schäfer, ebenso den der Musikwissenschaftlerin Christine Lauter. Letztere hat viele Monate in internationalen Bibliotheken zugebracht und zahllose bis dahin verborgene Schätze für die Musikwelt zugänglich gemacht. Für die finale Auswahl der Stücke, die dann als Weltersteinspielungen auf dieser neuen CD vereint wurden, entschied schließlich das Bauchgefühl. Ein großer Verdienst kommt auch Michael Preiser zu, der die ausgewählten Arien schließlich in heutige Notenschrift übertragen hat. Charlotte Schäfer wird hier interviewt von Stefan Pieper:
Sehen Sie eine CD-Produktion
auch in Zeiten stagnierender Tonträger-Absätze noch als Türoffner für die
eigene Karriere?
Das kann ich unbedingt bestätigen. Schon durch mein erstes CD-Album ging eine neue Welt für mich auf. Ich wurde plötzlich ganz anders wahrgenommen und es ergaben sich neue Kontakte. Die Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten für Alte Musik wurde intensiver und häufiger; Ich bin in den Rundfunk gekommen und so ging es weiter. Es ist ein Traum: Die Leute schalten das Radio ein und hören Dich dort.
Was für ein künstlerisches
Anliegen stand am Ursprung dieses Projekts?
Ich verspüre eine große
Sehnsucht nach dem Sinn in meiner Kunst und mir ist es wichtig, in erster Linie
als Interpretin wahrgenommen zu werden. Es geht mir eben nicht nur darum, als
Sängerin oder Sänger auf der Bühne die eigenen Gefühle auszuleben. Das sei
jedem gegönnt. Aber mein Anliegen reicht über den eigenen Adrenalinkick weit
hinaus. Ich bin überzeugt, dass die Komponisten von Demofoonte dieses Musik
geschrieben haben, um den Zuhörern eine Botschaft zu vermitteln. Nämlich: Habe
Mut, Dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
Sie haben ja in einer
regelrechten Grundlagenforschung neue Quellen erschlossen. Wie kam der Prozess
in Gang?
Bei der Beschäftigung mit Mozarts Konzertarie „Non curo l`affetto“ weckte das zu Grunde liegende Opernlibretto Demofoonte meine Neugier. Ich erfuhr, dass nicht nur Mozart, sondern geschätzt circa 80 weitere Komponisten immer wieder den Demofoonte-Stoff vertont haben. Mir wurde klar, dass diese Oper wahnsinnig beliebt gewesen sein muss. Also wollte ich mehr herausfinden und so habe ich mich zwei Kollegen anvertraut, nämlich der Musikwissenschaftlerin Christine Lauter und dem Dirigenten Michael Preiser. Christine Lauter hat hier die Quellenrecherche übernommen und Michael Preiser die musikalische Leitung und Edition.
Beide haben eine unvorstellbare Forschungsarbeit geleistet. Sie machen ihren Beruf, weil sie etwas damit sagen wollen.
Schon der erste Stapel, den Christine entdeckt hat, war voller Goldschätze. Schließlich hat sie in verschiedenen Bibliotheken in Europa und Amerika 60 Vertonungen aufgestöbert. Wir gehen inzwischen davon aus, dass diese Oper insgesamt 79 Mal komplett vertont worden ist. Das ist der Wahnsinn – stellen Sie sich vor, so viele Komponisten hätten damals die Hochzeit des Figaro vertont! Da muss den Leuten ein Thema wirklich unter den Nägeln gebrannt haben.
Welche Kernaussage wird hier
transportiert ?
Dieses Libretto ist von einem großen Dichter der Zeit. Pietro Metastasio war ein großer Aufklärer. Oberflächlich geht es um eine komplizierte Verwechslungsgeschichte: um ein Paar, das nicht standesgemäß ist. Die Braut kommt aus der bürgerlichen Schicht und darf eigentlich den Prinz nicht heiraten. Beide sollen sogar für diese „verbotene“ Liebesverbindung zum Tode verurteilt werden. Es kommen aber zwei Figuren von außen dazu, welche das ganze Dilemma mitbekommen und für die beiden Liebenden Partei ergreifen. Deutlich wird, dass die beiden Liebenden hier doch unschuldig sind; und es wird versucht, sie zu befreien. Jeder kommt hier in einen Konflikt mit dem herrschenden Gesetz. Letztlich entscheiden sich alle Beteiligten für ihr Herz. Das Paar wird deshalb schließlich begnadigt. In all dem steckt ein flammender Appell für Freiheit und Menschenrechte. Hier treten mutige Menschen aus ihrer Untertanenrolle heraus und riskieren etwas, damit es andere, menschlichere Wege gibt. Das ist ein faszinierender Aspekt.
Sie unterstreichen Ihr
idealistisches Anliegen im Booklet mit einem persönlichen Appell an die
Menschenwürde. Was kann so ein Stoff dem heutigen Publikum vermitteln?
Die Grundaussage transportiert einen berühmten Appell: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Man kann so viel bewegen, wenn sich jeder Einzelne darauf besinnt, sich etwas zu sagen traut, was er als falsch empfindet: und dafür auch einsteht. Gleich eine ganze Reihe von Charakteren steht in dieser Oper für dieses Menschenbild.
Es ist heute schon wieder von
einer post- oder antiaufklärerischen Zeit zu lesen. Populistische Herrscher
kommen an die Macht, weil sich immer mehr Menschen davon verabschieden, ihren
Verstand zu nutzen und sich manipulieren und gängeln lassen.
Diese Manipulierbarkeit durch reale und behauptete Macht ist erschreckend. Menschen hören sich allen möglichen Quatsch an und hinterfragen diesen nicht. Dabei wäre genau dies dringend notwendig, damit Gesellschaften wirklich frei bleiben. Ich kann als Künstlerin einen gewissen Beitrag leisten dafür, so dass ein aufgeweckter Hörer diese Botschaft dann unter seinen Mitmenschen weiter streut. Diese Hoffnung ist mit ein Grund, warum ich diesen Beruf mache.
Viele Musiker, aber auch
Veranstalter und Labels trauen sich gar nicht, neues Repertoire zu erschließen
und damit Horizonte zu erweitern. Hat Sie dieser Schritt Überwindung gekostet?
Ich kenne viele Kollegen, die
sagen pauschal, „Randrepertoire“ mache ich nicht. Ich finde das sehr schade.
Natürlich kostet es Mut, eine neue Interpretation zu behaupten. Die
soundsovielte Aufnahme der „Königin der Nacht“ zu veröffentlichen und sich hier
nur an einer bereits hochgelobten Referenzaufnahme zu orientieren, ist
sicherlich der Weg des geringeren Widerstandes. Neues, unbekanntes Repertoires
führt einen auf Anhieb auf einen ganz anderen Weg. Man wird dadurch zwar
angreifbarer, verspürt aber sofort eine viel größere Freiheit. Es entwickelt
sich ein unmittelbares Gefühl für die Musik, wenn es nur die Primärquelle des Notentextes
gibt.
Ich finde es toll, mich einem Stück nur mit dem unmittelbaren Instinkt zu nähern. Umso mehr fängt die Musik dann an, zu leben und selbstständig zu werden.
Erzählen Sie mir von der
Zusammenarbeit mit dem Orchester!
Die hat mich einfach nur sehr glücklich gemacht. Jeder versuchte, sich auf seine Art zu konzentrieren und wollte sein bestes geben. Wir hatten nur eine Woche Zeit, um zu beobachten, was da entstehen kann, das stachelte zusätzlich unsere Begeisterung an. Ich finde es ganz toll, wie das Orchester reagiert hat.
Der Dirigent des Orchesters
spielte ja im musikologischen Part auch eine wichtige Rolle!
Michael Preiser hat nicht nur
das Orchester dirigiert, sondern er hat sich viel Zeit für eine intensive Auseinandersetzung
mit den alten Handschriften genommen. Viele Autographe sind heute nicht mehr
gut lesbar, allein, weil es viele andere Konventionen bei der Notation gab. Oft
musste Michael Preiser Entscheidungen treffen, wenn nicht mehr klar war, was der
Komponist oder Kopist damals meinte. Er hat schließlich am Computer gut lesbare
Noten erstelltund wir hatten zugleich einen intensivst vorbereiteten
Dirigenten.
Dem fortschrittlichen Geist
des Librettos entspricht eine zukunftsweisende Neuausrichtung des musikalischen
Stils an der Schwelle vom Barock zur Frühklassik. Welche Ideale werden bei der
Interpretation verfolgt?
In Barockopern gibt es oft
stilisierte Figuren. In der Klassik kommt aber dann immer mehr der
Humanitätsgedanke auf. Da ist nicht länger ein rigides schwarzweiß in der
Musik, also ist auch die barocke Terrassendynamik weitgehend überwunden. Der
frühklassische Stil leistet sich spürbar fließendere Bewegungen z.B. durch
Crescendi. Das liefert ganz neue Mittel, die seelische Verfassung der Protagonisten
zu beschreiben.
Dirigent Michael Preiser hat
hier klare Vorstellungen bei der dynamischen Gestaltung. Das Tor zur
Frühklassik ist bei diesen Arien auf jeden Fall weit offen. Wir haben uns daher
für eine Aufnahme in 430 hz entschieden. Die Instrumente der Frühklassik
klingen einen Viertelton höher als barocke Instrumente und dieser Klang hat
eine ganz eigene Wärme. Die Instrumentierung stellte eine besondere
Herausforderung bei diesem Unternehmen dar: Eine Arie ist mit Kontraoboen
besetzt. Wir fanden heraus, dass es davon ganze 7 Stück in Deutschland gibt.
Aber dieses Orchester hier hat zwei davon.
Was sind die gesanglichen
Herausforderungen hier?
Vor allem die Koloraturen sind technisch herausfordernd. Mein Anspruch ist dabei, dass man ihren Sinn erkennt. Wenn da zum Beispiel das Wort „Freude“ steht, singe ich es mit einem anderen Ausdruck, als wenn da etwa „Erstaunen“ steht. Je nach Ausdruck setzte ich unterschiedliche Gesangstechniken ein. Insgesamt reißt mich am meisten die Schlussarie von Guiseppe Sarti mit. Als ich sie zum ersten Mal gelesen habe, bekam ich erst mal Wasser in den Augen und sagte, ich kann das nicht. Ich dachte einfach, die Arie ist größer als ich. Aber dann hat es mich gepackt und ich dachte, es ist kein Zufall, dass diese Musik und ich zusammengefunden haben. Später bei der Aufnahme hatte ich dann das Gefühl, ganz bei mir zu sein und ich war überglücklich. Die Schlussarie war auf jeden Fall der weiteste Weg und ich habe lange mit meinem Lehrer Jan Kobow dran gearbeitet.
So bestechend diese
SACD-Aufnahme geworden ist, so ist sie doch vor allem eine Hinführung zu einem
Live-Konzerterlebnis, was ich mir jetzt sehr wünschen würde. Gibt es
Perspektiven für eine Aufführung?
Wir würden das ganze so gerne
mal in einem Konzert aufführen. Ich hoffe, dass wir mittelfristig einen
geneigten Produzenten oder Veranstalter dafür finden.
[Stefan Pieper, Januar 2019]