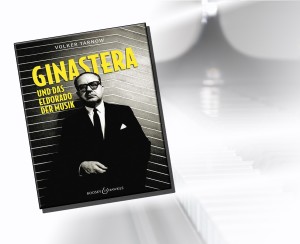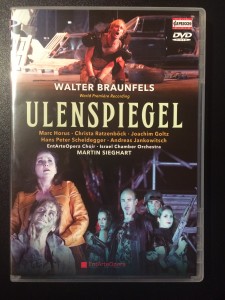Volker Tarnow – GINASTERA und das Eldorado der Musik
Boosey & Hawkes, Berlin 2017; ISBN 978-3-7931-4164-8
Vor circa einem halben Jahr bekam ich Nicolas Slonimskys Autobiographie „Perfect Pitch“ in die Hände und las sie mit allergrößtem Vergnügen. Ich kannte vorher weder den Autor noch die Rolle, die er in der Musik des 20. Jahrhunderts spielte. Sein „zweites Bein“ als Verfasser verschiedenster lexikographischer Bücher bescherte mir kurze Zeit später sein „Music of Latin Amerika“. Es öffnete mir die Augen für die ungeheure Fülle mir bis auf Villa-Lobos und wenige andere unbekannter Musiker und ihrer Musik. Diese Tatsache teile ich vermutlich mit den meisten anderen Europäern.
Und da kam im April 2017 das Buch über den größten argentinischen Komponisten Alberto Ginastera. Von dem hatte ich bei einem Konzert hier in München von Hugo Schuler, dem jungen argentinischen Pianisten, die „Danzas Argentinas“ gehört. Der Name Ginastera war mir als Gitarrist durchaus geläufig, aber von seiner Musik hatte ich eben bislang wenig bis gar nichts gehört.
Welche Rolle Alberto Ginastera in der argentinischen und allgemein in der amerikanischen Musik spielte und spielt, das ist das große Thema in Volker Tarnows neuem Buch. Wie auch seine beiden anderen Bücher über „“Das romantische Schweden“ und über „Jean Sibelius“ liest es sich hervorragend.
Nimmt man es in die Hand, so wundert man sich zu allererst einmal über das Gewicht. Man ist bei heutigen Büchern selten überrascht, was das Papier angeht, aber bei Volker Tarnows neuem Buch hat der Verlag (Ginasteras Exklusivverlag Boosey & Hawkes) weder am Papier noch an der Aufmachung gespart. Hin und wieder denkt man, man hätte zwei Seiten umgeblättert, bis einem aufgeht, dass es wirklich so ein exquisites Papier ist. Das gelbe Lesebändchen als Orientierungsgeber gehört natürlich auch dazu.
Neben den „Äußerlichkeiten“ überzeugt das Buch aber vor allem durch seinen Inhalt, durch die Bilder und Fotografien, durch Lebenslauf, Werkverzeichnis und Anmerkungen. Bei allem ausgebreiteten Wissen über Leben, Werk, Werdegang und die einzelnen Kompositionen liest es sich flüssig und ist durchaus unverkennbar mit dem Tarnow’schen Humor gewürzt, der mir auch in seinen anderen beiden Büchern schon so gut gefallen hat. Natürlich kennt sich der Autor nicht nur in musikalischen Dingen hervorragend aus, er lässt vor uns den ganzen Reichtum der südamerikanischen Musikkultur entstehen, angefangen mit der präkolumbianischen über die peruanische bis zur aktuellen argentinischen. Ginasteras Leben wird im Zusammenhang mit der politischen Situation in Buenos Aires und dem ganzen Land geschildert, seine Aufs und Abs als Musiker, auch als Leiter der verschiedensten musikalischen Institutionen, seine Auslands-Aufenthalte und die Freundschaften mit den verschiedensten Musikern vor allem in den USA, später dann auch in Europa, wo er in Genf mit seiner zweiten Frau – der Cellistin Aurora Nátola – lebte.
All das wird mit leichten Ton geschildert, dazwischen natürlich die Beschreibung seiner einzelnen Kompositionen, seien sie für Orchester, seien sie kammermusikalisch, seien sie für die Bühne oder für den Film. Bei einem Lebenswerk von „nur“ 60 Opera ist die Verschiedenheit der Kompositionen doch erstaunlich, auch drei gewaltige Opern sind dabei, und das Werkverzeichnis listet sie natürlich alle chronologisch auf. Die Verbindung – mal mehr, mal weniger – zur ursprünglichen indianisch oder invasorisch gauchoesk gefärbten indigenen Musik und ihren Instrumenten wird ausführlich dargestellt, auch die Verbindung zu seinen Kollegen in Brasilien oder Mexiko, in Peru oder Kolumbien.
Und Tarnow räumt mit einem Vorurteil auf, welches die Musikwissenschaft lange immer wieder aufs Neue tradierte: Auch die Inkas kannten weit mehr als die in der Forschung aufgedeckte Pentatonik primitivster Art. Wobei wir natürlich leider ob der oftmals schlechten Quellenlage originale Inka-Musik nur in geringem Maß erkunden können. Zu barbarisch haben die Eroberer in Süd- und Mittelamerika gehaust und gewütet. Was heute an „Volksmusik“ aus den Andenregionen und von anderswoher zu uns kommt, ist weitestgehend bloßer Kommerz wie die nervenden Bläsergruppen vor den Kaufhäusern.
Was dieses neue Buch so spannend macht, ist die Tatsache, dass es einen Komponisten umfassend sichtbar und erlebbar macht in seinem ganzen Lebensumfeld und seinem Werdegang. Die nächste Stufe wird also sein, dass ich die Musik dieses bedeutendsten argentinischen Komponisten neben dem viel einfacheren Astor Piazzolla suchen und hören werde. Denn Volker Tarnows Buch hat das geschafft, was ein Buch über ein staunenswertes „Phänomen“ – einen bisher ziemlich unbekannten Musiker namens Alberto Ginastera – so lebendig werden lässt, dass das Anhören seiner Musik der zwangsläufig nächste Schritt sein muss.
[Ulrich Hermann, Mai 2017]