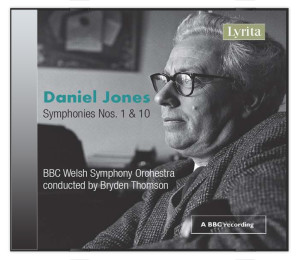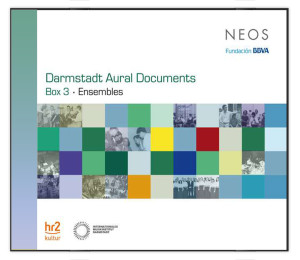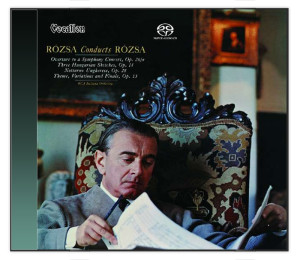Darmstadt Aural Documents: Box 3, Ensembles (7 CD)
© 2016 NEOS Music GmbH, 1952-2010 Hessischer Rundfunk, Internationales Musikinstitut Darmstadt
NEOS 11230, EAN 4 260063 112300
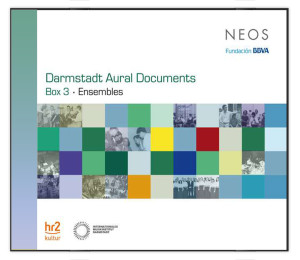
Komponisten: Mark Barden (*1980), Richard Barrett (*1959), Günther Becker (1924-2007), Pierluigi Billone (*1960), Herbert Brün (1918-2000), John Cage (1912-1992), Julián Carillo (1875-1965), Jean-Claude Eloy (*1938), Robert Erickson (1917-1997), Julio Estrada (*1943), Franco Evangelisti (1926-1980), Johannes Fritsch (1941-2010), Marta Gentilucci (*1973), Erhard Grosskopf (*1934), Wieland Hoban (*1978), Robin Hoffmann (*1970), Maki Ishii (1936-2003), Charles Ives (1874-1954), Hanns Jelinek (1901-1969), Ben Johnston (*1926), Hans-Klaus Jungheinrich (*1938), Arghyris Kounadis (1924-2011), Thomas Lauck (*1943), Hans Ulrich Lehmann (1937-2013), Genoël von Lilienstern (*1979), Liza Lim (*1966), Walter Marchetti (1931-2015), Eduardo Moguillansky (*1977), Enno Poppe (*1969), Henri Pousseur (1929-2009), Stefan Prins (*1979), Horatiu Radulescu (1943-2008), Michael Reudenbach (*1956), Rolf Riehm (*1937), Frederic Rzewski (*1938), Tadeusz Wielecki (*1954), Iannis Xenakis (1992-2001)
Darbietende Künstler: Végh Quartett, LaSalle Quartett, Parrenin Quartett, Kronos Quartett, Arditti Quartett (Roger Heaton, Bassklarinette; Fernando Grillo, Kontrabass), Kairos Quartett, Internationales Kranichsteiner Kammerensemble (Bruno Maderna, Leitung; Pierre Boulez, Leitung; Akemi Karaki, Sopran), The Gregg Smith Singers (Gregg Smith, Leitung), Ensemble Incontri musicali (Bruno Maderna, Leitung), Contemporary Chamber Players, Schola Cantorum Stuttgart (Nicole Rzewski, Sprecherin; Frederic Rzewski, Klavier; Bernhard Kontarsky, Leitung), Ensemble Köln (Robert HP Platz, Leitung), Freiburger Schlagzeugensemble (Bernhard Wulff, Leitung), Orchester zum 13. Ton Nürnberg (Martine Joste, Klavier; Ulf Klausnitzer, Leitung), Teilnehmer der Darmstädter Sommerkurse 1998 (Julio Estrada und Isao Nakamura, Leitung), Teilnehmer der Darmstädter Sommerkurse 2006 (Wieland Hoban, Percussion; Lucas Vis, Leitung), Teilnehmer der Darmstädter Sommerkurse 2008 ( Christian Dierstein, Leitung), Ensemble Courage (Tadeusz Wielecki, Kontrabass; Titus Engel, Leitung), Ensemble Recherche (Christoph Grund, Klavier; Christian Dierstein, große Trommel), Fathom String Trio, Ensemble ascolta, Nadar Ensemble (Daan Janssens, Leitung), Klangforum Wien (Emilio Pomárico, Leitung)
Ich erinnere mich noch gut, als ich 1968 die schwere 6-LP-Box der Deutschen Grammophon Gesellschaft mit der schlichten Diagonal-Aufschrift avantgarde, vorne schwarz auf weiß, hinten weiß auf schwarz, in Händen hielt. Der eigenartige (und unerklärliche) Löwenzahngeruch des Neuen und der Anblick der leuchtend monochromen LP-Hüllen verband sich mit der Erwartung von Abenteuern, von den 12 versammelten Komponisten kannte ich gerade mal Kagel, Ligeti und Stockhausen dem Namen nach. In den 3 nachfolgenden Jahren kamen dann Vol. 2,3 und 4 heraus. Ja, das waren goldene Zeiten, in denen ein Rainer Werner Fassbinder noch 14-teilige Filme fürs öffentlich rechtliche Fernsehen produzieren durfte … Wenn DGG heute seine Archive öffnet für die x-te Zusammenstellung historischer Aufnahmen mit Boxen zu 30, 50 oder 100 CDs, so setzt sie nur noch auf große Namen wie Karajan, Beethoven oder Mozart, scheut aber bei ihren Schätzen an neuerer Musik jedes Risiko. Einiges findet man noch verstreut in der Serie 20th Century Classics, und das war’s dann. Auf eine Remaster-Ausgabe dieser 4 avantgarde-Boxen, inzwischen Kult und im Internet für dreistellige Euro-Preise gehandelt, wartet man vergebens.
Da kommt Trost vom tapferen kleinen Münchner Label NEOS. In der Reihe „Darmstadt Aural Documents“ gibt es bereits Box 1, „Composers Conducting Their Own Works“, mit 6 CDs, Box 2 ist eine John Cage gewidmete Einzel-CD, und Box 4 mit 6 CDs ist ganz der neueren Klaviermusik vorbehalten. Die hier vorliegende Box 3 besteht aus 7 CDs und befasst sich ausschließlich mit Ensemble-Musik, in der zeitgenössischen Musik vielleicht ohnehin die interessanteste Sparte.
Wenn Ihnen der Name Darmstadt in musikalischem Zusammenhang nichts sagt, dann sind Sie auf jeden Fall ein Neuling im Fach „Zeitgenössische Musik“. Die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt, 1946 von Wolfgang Steinecke, dem damaligen Kulturdezernenten der Stadt mithilfe der amerikanischen Militärregierung ins Leben gerufen, entwickelte sich schnell zu einem der wichtigsten Foren für junge Komponisten, Musiktheoretiker und Interpreten. Nach den Anfängen mit den berühmten „Seriellen“ wie Boulez, Stockhausen und Nono kamen dann Kagel, Lachenmann, Rihm und viele andere große Namen, die Darmstadt berühmt gemacht haben (oder die durch Darmstadt berühmt wurden wie z. B. Giacinto Scelsi). Und immer schon wurde fleißig polemisiert, sogar von Alex Ross in seinem Buch „The Rest is Noice“, in dem er sonst überaus unterhaltsam und erfolgreich auf die Musik des 20. Jahrhunderts neugierig macht. Alle waren sie dort, auch Cage und Feldman (sehr empfehlenswert seine „Darmstadt Lectures“). Und eines hat Darmstadt mit Rom und der Katholischen Kirche gemeinsam: Nirgends wird so viel gelästert bei gleichzeitig höchster Konzentration von Autorität, oft totgesagt und doch quicklebendig.
Und nun liegt also sowohl für Kenner, als auch für Einsteiger hier ein Kompendium an spannender Musik vor, ein wahres Schatzkästlein, noch dazu sehr hübsch und geschmackvoll wie alle Boxen der NEOS-Reihe als ansprechendes Digipack.
„Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen; und jeder geht zufrieden aus dem Haus“. Da soll sich Goethes Schauspieldirektor (Faust I) mal nicht so sicher sein! Man staunt zwar, wie viel Schönes die zeitgenössische Musik bereithält (z.B. Johannes Fritsch oder Horatiu Radulescu), aber natürlich gibt es auch ausgesprochen Sperriges und Hässliches, und wer nicht zugeben will, dass manches dieser Stücke „experimenteller Musik“ nur nervt, der möchte sich vielleicht geschmacklich nur vom gemeinen Volk („des ist koa Mussig“) absetzen. Aber eines bestätigt sich überhaupt nicht (und hat auch nie gestimmt): dass diese Musik akademisch konstruiert und trocken daherkommt. Man sieht auch, dass die als „seriell“ bezeichneten Künstler sich meist selbst nicht an ihre Komponier-Regeln gehalten haben. Und: Es wird nie langweilig. Herrlich zum Beispiel Ben Johnstons „Knocking Piece“ aus der Darmstädter Stadthalle mit den Pfiffen und Rufen („Buhh! Aufhören …“) am Ende!
Es werden in 8 Stunden 37 Werke geboten, die meisten von etwa 20 Minuten Dauer, die älteste Aufführung von 1952, die jüngste von 2010, und viele dieser Mitschnitte des Hessischen Rundfunks sind jetzt schon von historischen Rang (z.B. der oben erwähnte Ben Johnston, oder auch Evangelisti, Xenakis, Cage, Jungheinrich …). Es gibt ja oft relativ wertlose Zusammenstellungen von Minihäppchen, welche die Neugier der Anfänger wecken sollen, sie dabei aber nur nervös machen. Davon kann hier keine Rede sein: Es werden nur ganze Werke präsentiert, und es haben fast alle das Prädikat „World première“, manchmal auch „European première“ oder zumindest „German première“. Nur zwei der hier vertretenen Komponisten (Ives und Carillo) sind nicht im 20. Jahrhundert geboren, und auch der Nachwuchs (z. B. Mark Barden, Jahrgang 1980) ist gut repräsentiert.
Als Schwerpunkt finden wir die klassische Formation Streichquartett. So beginnt CD 1 mit Hanns Jelineks Streichquartett Nr. 2, dargestellt 1962 vom legendären Végh Quartet, eine wahre Trouvaille. Auch das LaSalle Quartet fehlt nicht. Dann kommt das Kronos Quartet, ein immer abwechslungsreicher, für Überraschungen guter, fast schon „populärer“ Türöffner für zeitgenössische Musik seit den 80er Jahren, hier mit der Weltpremiere der Thirty Pieces for String Quartet von John Cage. Das Werk wurde damals eigens für das Kronos Quartet komponiert, und die Aufnahme ist eine absolute Rarität, gab es doch bisher nur eine Einspielung vom Arditti Quartet, die dazu noch vergriffen ist. Übrigens gibt es ein sehr interessantes Videoclip, http://exhibitions.nypl.org/johncage/node/263, auf dem David Harrington, der Primarius von Kronos, der Geigerin Emily Ondracek-Peterson die von ihm empfohlenen Spielweisen für diese Stücke erläutert. CD 2 wird ganz vom Arditti Quartet (mit dem vorzüglichen Cellisten Rohan de Saram) bestritten. CD 3 ist exklusiv dem Internationalen Kranichsteiner Kammerensemble gewidmet, dies allein ist schon die Anschaffung dieser Box wert. Auch viel Schlagzeug ist geboten, so z.B. Liza Lims „City of Falling Angels“ für 12 Perkussionisten.
Zahlreiche weitere höchst originelle Produktionen warten darauf, entdeckt zu werden. Das, was damals vor fast 50 Jahren für mich die schöne DGG-Cassette war, das könnte heute gut diese NEOS-Box für manchen werden: ein idealer Einstieg in die Moderne Musik.
[Hans von Koch, Februar 2017]