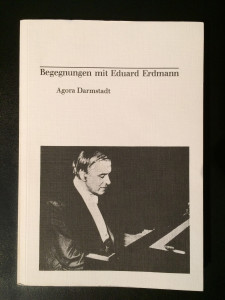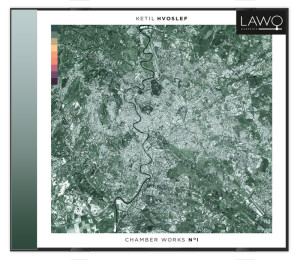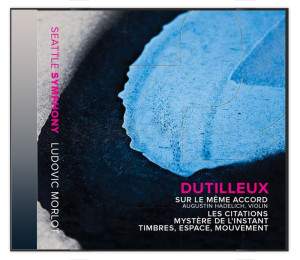Möglichst viel möglichst billig – das scheint beim Münchner Publikum nicht zu ziehen. Aus welchen Gründen auch immer, die Philharmonie im Gasteig war kaum zur Hälfte besetzt beim Prokof’ev-Klaviersonaten-Marathon im Rahmen des Festivals MPHIL 360°. Vielleicht ist ‚Marathon‘ nicht unbedingt die geschickteste Vokabel, um dem Publikum ein Konzertereignis schmackhaft zu machen. Ich habe die zwei Konzerte am Samstag Nachmittag, bei denen vier Pianisten das gesamte Klaviersonaten-Œuvre Prokof’evs spielten, jedenfalls nicht als Marathon empfunden. Das liegt an der Vielgestaltigkeit und dem Abwechslungsreichtum innerhalb des Prokof’evschen Sonatenschaffens, das zugleich seinen Autor nie verleugnet. Es zeichnet fast die gesamte Biographie des Komponisten nach und daneben auch ein gutes Stück Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Es ist ein wahrer Kosmos, der in mehrerlei Hinsicht einzigartig dasteht und in pianistischer Schwierigkeit, kompositorischer Originalität und Konsequenz höchstens noch mit Skrjabins zehn Sonaten zu vergleichen ist.
Den sportlichen Aspekt brachten dann aber doch die Interpreten hinein: allesamt junge Männer der Marke No-Name, wenn man das Pianisten-Business global betrachtet, hungrig nach Profilierung im harten Geschäft, voller Enthusiasmus und sicher auch Testosteron, was die Veranstaltung in einen wahren Pianistenkrieg verwandelte. Und man vergleicht dann doch immer. ‚Höher, schneller, weiter‘ schien auch das Motto ihrer Interpretationen zu sein. Kein Satz, der nicht im Maximaltempo und mit maximalem Wumms genommen wurde, ein piano ohne Pathos gab es diesen Nachmittag einfach nicht.
Der erste Pianist des Nachmittags, Dmitry Masleev kam, sah und pedalisierte. Sobald er mit großer Zielsicherheit am Flügel platzgenommen hatte, stand sein Fuß schon auf dem rechten Pedal und blieb dort auch für den Rest seiner Darbietung. Die Sonaten eins bis drei waren dann auch wie aus einem Guss. Nach der nur einsätzigen Nummer eins vergisst das Publikum zu klatschen. Egal, weiter. Bitte, mich nicht falsch zu verstehen: Da saß kein schlechter Pianist, ganz im Gegenteil. Stupende Fingertechnik verlor sich aber in einer Klangwolke, über die sich nur einzelne Sforzato-Spitzen vernehmbar zu erheben vermochten. Das liegt vielleicht auch daran, dass ausschließlich Fingertechnik zum Einsatz kam und all die Möglichkeiten, die der Pianistenkörper vom Handgelenk an sonst noch bietet, ungenutzt blieben. Seine Stärken spielte Masleev aus, wo es grotesk und abgründig wird, wie im Scherzo der zweiten Sonate und vor allem in deren Schlusssatz – da ist bereits alles da, was Prokof’ev ausmacht.
Sein Scarlatti schoss aber den Vogel ab. Man traute seinen Ohren kaum, dieser Scarlatti könnte Prokof’evs Bruder sein: keinerlei Unterschied, ungebremste Wucht. Man meinte nicht Domenico zu hören, sondern irgendeinen Herrn Scarlatti vom Roten Platz. Überhaupt, das ist auch so ein diskussionswürdiger Punkt: die Programmplanung, die den Prokof’ev-Nachmittag mit Scarlatti-Sonaten durchspickte, welche einst als Einspiel-Übung von Vladimir Horowitz geschmäht wurden. Es war wohl kaum so, dass vier Pianisten mit der Idee kamen, dass ein jeder Scarlatti als Zugabe spielen könnte. Vielmehr wird sich ein Heißsporn von einem Konzertdramaturgen gedacht haben: Hey, das wäre doch cool, wenn wir auch noch Scarlatti spielten. Wer bei Verstand ist, den wird die Frage nicht mehr loslassen, was das soll. Aufmerksamkeit um jeden Preis.
Nein, im Ernst: Die Prokof’evsche Wucht verlangt ja schon nach Abwechslung, wäre wahrscheinlich ohne sie viel schwerer zu ertragen. Und die Scarlatti-Sonaten waren auch ein Lackmustest, der die verschiedenen (oder auch ähnlichen) Temperamente der vier Pianisten offenbarte. Und doch wurde es mit jeder Scarlatti-Sonate langweiliger, im Schatten der Prokof’evschen Komplexität verblassten sie ziemlich schnell.
Die Sonaten eins bis sechs bilden einen unentrinnbaren Abwärtssog aus, unterbrochen höchstens von der fünften. Dem amerikanischen Pianisten George Li fiel die etwas unangenehme Aufgabe zu, zwei geradzahlige Sonaten aus dieser Gruppe zu interpretieren. Ich notiere meine nächste Frage an die Programm-Dramaturgie, die mich beschäftigt: wieso die zusammengehörende dritte und vierte Sonate auseinandergerissen wurden. Die merkwürdig zurückgenommene vierte ist leider die wohl am wenigsten eingängige der Sonaten Prokof’evs. Es folgte die sechste, eine der längsten und schwersten, wenn sich das überhaupt über eine im Prokof’ev-Kosmos sagen lässt. Der Pianist schuftete sich durch diese Herkulesaufgabe mit bravouröser Meisterschaft, die keinen Wunsch offen lässt. Anschließend kommt sein Scarlatti so perlend daher wie ein Mozart, so wie er eben sein soll, als hätte es die gerade erst verklungenen Monstrositäten nie gegeben. Das ist fast zu viel der Perfektion.
Lukas Geniušas gibt am Klavier ein imposantes Bild ab. Sein Spiel ist nicht unbeteiligt, doch ungemein geerdet. Mit der fünften Sonate kommt Prokof’ev dem am nächsten, was als Westliche Moderne angesehen wird, zu der man aber beispielsweise auch Karol Szymanowski zählen müsste. Sie ist von geradezu quälender, unerbittlicher Klarheit und Geniušas spielt sie nicht ohne die erforderliche Schärfe. Apropos Klarheit: seiner höchst ausdifferenzierten Pedaltechnik ist zu verdanken, dass kein einziger Ton unter den Tisch fällt, sondern dass ein jeder plastisch dasteht. Auch er begnügt sich für sein Spiel vorwiegend mit der Aktivität der Fingerspitzen, doch da wo es erforderlich wird, scheint er rhythmisch auf der Klavierbank auf und ab zu hopsen, mit seinem ganzen Gewicht in die Tasten gelehnt.
Der erste Satz der siebten Sonate, Mitten im Krieg entstanden, bringt Rhythmen einer verkehrten Welt. Selbst den berühmten Precipitato-Satz spielt Geniušas so locker-flockig, dass man sich irgendeinen Widerstand herbeiwünscht, nicht aus Gehässigkeit, sondern weil sich am Widerstand bekanntlich die Kräfte entfalten – man möchte nur zu gerne wissen, wohin die volle Entfaltung noch führen könnte. Der Jubel des Publikums entlockt ihm nur ein betont entspanntes Lächeln, so als möchte er uns sagen, dass er gleich mit den nächsten zwei Sonaten weitermachen könnte. Wie die meisten jungen Pianisten dieser Liga können sich unsere vier Kandidaten damit rühmen, renommierte Wettbewerbe wie den Čajkovskij-Wettbewerb – im Falle von Geniušas auch den Chopin-Wettbewerb –, aus der Nähe erlebt oder gewonnen zu haben. Geniušas erscheint mir noch in dieser Gesellschaft als Ausnahme-Talent, vor allem aufgrund der Präzision seines Spiels.
Mit der [für Emil Gilels komponierten] achten Sonate beginnt bereits eine Retrospektive: alles scheint irgendwie im Modus des Uneigentlichen ausgesprochen. Der polternde Schluss der achten Sonate wäre gar nicht nötig gewesen, er wirkt wie angenäht. Im ersten Satz hat Prokof’ev als Schluss ein Entschweben nach oben hin – hier noch augenzwinkernd – erprobt und dann im zweiten Satz der neunten erneut angewandt. Die neunte Sonate mit ihrem nach außen gekehrten Neoklassizismus ist weder als bewusster Schlusspunkt noch als ein Ausrufezeichen konzipiert. Sie führt den Weg fort, der mit den letzten drei Sonaten eröffnet wurde, nicht unbedingt zu noch mehr Virtuosität, sondern zu noch größerer Verinnerlichung – so das nicht paradox klingt –, zu einer schlafwandlerischen Sicherheit der weiten Bögen, kurz zu größerer kompositorischer Qualität. Der Interpret dieser Glanzlichter heißt Sergej Redkin, ein ganz anderes Temperament diesmal, er wirkt wie ein schlaksiger Junge. Noch den Scarlatti spielt er mit einer Art nervöser Feinheit als handele es sich um eine der traumartigen Offenbarungs-Musiken des fin de siècle.
Im direkten Vergleich braucht es eine besondere Individualität, um sich von den anderen Pianisten, die auch alle ganz hervorragend sind, abzuheben. Sicherlich ist ein solcher Vergleich ungerecht, denn wann teilt sich ein Pianist schon ein Solo-Programm in einem Konzert mit seinem Kollegen. In einem Soloprogramm allein wären vielleicht ganz andere Qualitäten aufgefallen. Würde die Qualität von Musik an der Anstrengung für alle Beteiligten gemessen, dann wäre es ein großartiges Konzertereignis gewesen. Nicht, dass man hätte Tiefe missen müssen, dass uns mit dieser großen Musik nicht große Fragen gestellt würden, aber letzten Endes war es mehr eine Pianisten-Show als alles andere, was auch am sportlichen Zugriff der jungen Männer auf die Werke liegt. Die Mitschnitte sind auf medici.tv online, sodass sich jeder selbst ein Bild (freilich abzüglich der live vorhandenen Konzertsaalatmosphäre) machen kann.
[David Vondráček, November 2016]