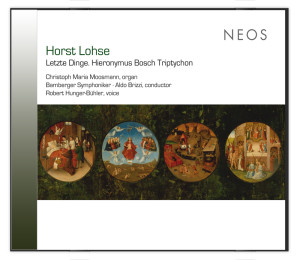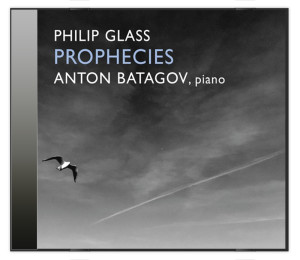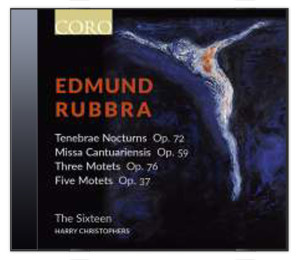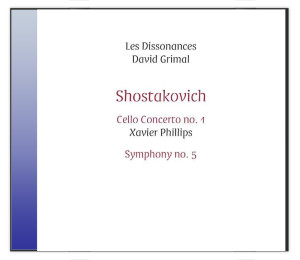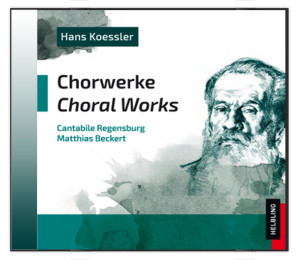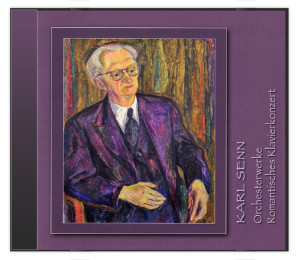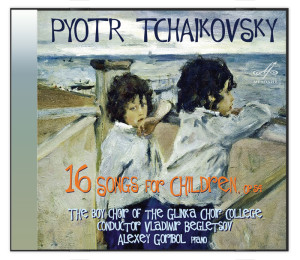Edmund Rubbra
Tenebrae Nocturns op. 72; Missa Cantuariensis op. 59; Drei Motetten op. 76; Fünf Motetten op. 37
The Sixteen, Harry Christophers
Coro CD COR 16144; EAN: 828021614422
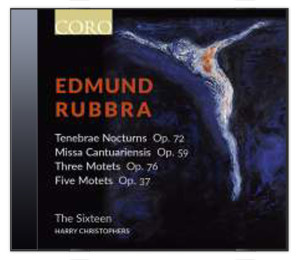
Kirchenmusik im 20. Jahrhundert – das ist ein problematisches Kapitel. Für die Chefideologen des Fortschritts ohnehin, da die Komplexität bei in der Regel mehrstimmiger Chormusik nicht so hoch sein kann wie im Instrumentalen, und die Dimensionen des Absurden nicht so ergiebig sind wie im Musiktheater. Die Kirche als potenter Geldgeber will ja auch ihren geldwerten Vorteil, und der heißt nicht Atonalität und Geräuschlaboratorium, sondern irgendwie dann doch – Verständlichkeit, eine gewisse Schönheit und Erhabenheit, und ganz allgemein Angemessenheit an den liturgischen Bedarf… Es ist aber auch von anderer Seite problematisch, denn der Glaube ist eben auch nicht mehr, was er mal war. Von Ernst Pepping, diesem führenden Vertreter von deutscher Seite, wissen wir beispielsweise, dass er gar nicht gläubig war und trotzdem Musik komponierte, die mehr Anklang fand als solche „moralisch kompatiblerer“ Zeitgenossen – na ja, er konnte eben mehr, und er verstand zu ergreifen. Da kann es doch nun wirklich egal sein, was er darüber dachte.
All dies soll nicht schmälern, welch großartige Beiträge existieren, so in Deutschland von Heinrich Kaminski, Reinhard Schwarz-Schilling, besagtem Meister Pepping, Hugo Distler und sogar Paul Hindemith, in Frankreich von Maurice Duruflé, Francis Poulenc oder Jean-Louis Florentz, in Italien von Giorgio Federico Ghedini, in der Schweiz von Frank Martin, in Polen von Krzysztof Penderecki, in Estland von Arvo Pärt, in Lettland von Peteris Vasks, in den USA von Vittorio Giannini, und natürlich in England: von Ralph Vaughan Williams, John Foulds und Benjamin Britten (mit zwei großen, überkonfessionellen Requiem-Vertonungen), Bernard Stevens, Herbert Howells oder eben Edmund Rubbra.
Edmund Rubbra (1901-86) war ein großer Meister im zeitlosen Sinne. Sieht man davon ab, dass er auch ein hervorragender Pianist und überhaupt Musiker war und obendrein ein höchst differenziert reflektierender Theoretiker, so sind es vor allem seine elf Symphonien, die manchem Leser ein Begriff sein dürften. Seine Kammermusik (darunter vier Streichquartette) ist auf keinem geringeren Niveau. Es ist freitonale Musik, die einen Löwenanteil ihrer Qualität lebenslangem intensiven Studium vorbarocker Polyphonie verdankt und diese in eine moderne harmonische Sprache mit fein ausbalanciertem Dissonanzengehalt, kühner Modulatorik und subtil lebendiger Rhythmik überführt. Rubbra, der von der anglikanischen Kirche zum Katholizismus übertrat, hat ja auch eine ‚Symphonia Sacra’ geschrieben, in welcher er das symphonische und das ekstatisch religiöse Element in unsentimental hymnischer Weise fusionierte. Hier nun tragen die vielfach preisgekrönten ‚The Sixteen’ unter Harry Christophers ein wunderbar vielseitiges Spektrum seiner geistlichen a-cappella-Chormusik vor, mit einer Ausnahme: das Credo der ‚Missa Cantuariensis’ wird von einer Orgel begleitet, was dem Ganzen eine willkommene Abwechslung beschert. Diese Chorwerke sind hier selbstverständlich minimal (16!) besetzt, was das Klangbild dem entscheidend annähert, was wir heute von alter Musik erwarten, und somit den archaischen Aspekt betont. Die Aufführungen sind von einer frappierenden Reinheit und Durchhörbarkeit der eminent kunstreichen kontrapunktischen Verschlingungen, obwohl wirklich nicht behauptet werden kann, die Phrasierung sei bewusst im Dienste der melodischen Energetik bzw. der übergeordneten harmonischen Spannungsverhältnisse verstanden. Aber es klingt fantastisch und ist ein großer ästhetischer Genuss, und je nachdem, wie der Hörer in der Lage ist, hinter das offenkundig Erscheinende zu hören, kann er sich vielleicht vorstellen, welche Wirkung diese in einer auch musikalisch idealen Aufführung entfalten könnte. So bleibt es eben beim Staunen, und dafür ist durchgehend Anlass, denn Rubbra ist ein inspirierter und gelassen tiefschürfender Meister des Fachs, der mindestens auf einer Höhe mit hierzulande viel bekannteren Gestalten wie Martin, Pepping oder Distler steht. Er hat übrigens auch ein sehr wertvolles kleines Büchlein über den Kontrapunkt, aus einer mehr freigeistig historisch bilanzierenden als analytischen Warte, geschrieben.
Hauptwerk vorliegender Aufnahme ist aus neun in drei Abteilungen zusammengefassten Motetten gegliederte ‚Tenebrae Nocturns’, von denen die ersten drei 1951, die weiteren sechs 1961 entstanden sind. Innerlich freier und zugleich als Gesamtzusammenhang bezwingender kann man in einem gebundenen Kontrapunkt nicht für Chor schreiben. Diese Musik ist voll Trauer und Verzweiflung, doch sie bleibt bei sich und führt den Hörer mitten in sein Selbst – was wohl auch die hehre Aufgabe liturgischer Musik sein sollte. Ein zeitloses Meisterwerk. Äußerlich am beeindruckendsten ist die doppelchörige ‚Missa Cantuariensis’ von 1945 (eine von fünf Messen Rubbras), und auch ist das Gesamtbild der sieben Sätze von höchster dramaturgischer Vollendung. Eine würdige Lobpreisung der göttlichen Intelligenz. Dass es nicht erst der Entwicklung des Reifestils bedurfte, um den Hörer ganz in den Bann zu schlagen, beweisen die fünf Motetten op. 37 von 1934, und hier ist der Kontrast zwischen den drei ruhigeren und den zwei dramatischeren dazwischenliegenden Sätzen mit souveräner Hand gesetzt. Nichts an dieser Musik ist ermüdend, sie geht immerzu ohne unnötiges Spektakel unbeirrbar ihren ganz eigenen Weg, der vielfach Unerwartetes enthält. Natürlich sind auch die drei Motetten op. 76 von 1952 ein wunderbar zusammenhängend empfundenes und ausgestaltetes Opus, das zugleich zeigt, wie Rubbra immer weniger äußerlich aufreizender Mittel bedurfte , um die seinem Schaffen innewohnende Dramatik zum Ausdruck zu bringen. Und doch wirkt nichts berechnend, routiniert oder überhaupt gemacht an dieser Musik. Sie fließt aus sich selbst, aus den Kräften, die ihre Keimzellen freisetzen im Dienste der substanziellen Texte, die an ihrer Wurzel ergriffen sind und keinerlei konfessionelle Einengung atmen.
Das Klangbild ist für eine Kirchenakustik (Church of St. Alban the Martyr, London) außergewöhnlich klar und durchsichtig, und der ausführliche Begleittext von Alexandra Coghlan sowohl den Komponisten als auch die Werke betreffend sehr informativ, einfühlsam und präzise. Über die Abfolge, die die Tenebrae Nocturns zweimal mit einer Packung Motetten unterbricht und mit der Messe abschließt, kann man geteilter Ansicht sein, doch misslungen ist es nicht. Eine exzellente Produktion, die auch hierzulande Chorleiter anregen sollte, es endlich mal mit Rubbra zu probieren. Eure Chöre werden es Euch danken, und das Publikum sowieso.
[Lucien-Efflam Queyras de Flonzaley, September 2016]