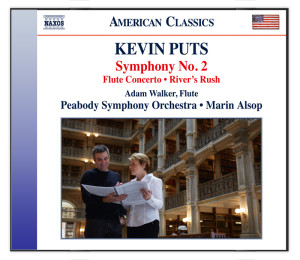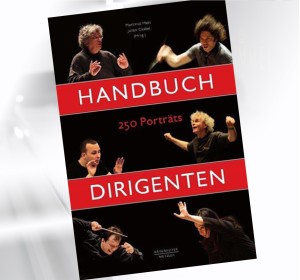Vor zwanzig Jahren, in der Nacht vom 14. auf den 15. August 1996, ist Sergiu Celibidache unweit seiner geliebten Mühle in Neuville-sur-Essonne südlich von Paris gestorben. Von unvoreingenommenen Hörern und kultiviert ausgebildeten Musikern, die die Tatsache nicht scheuen, dass seriöse Einstudierung mit intensiver Arbeit auch an vielgespielten Werken verbunden ist, geliebt, war und ist er zugleich in der Fachwelt sehr umstritten. Doch sind die Einwände, die auf musikalischer Seite gegen ihn vorgebracht werden, sei es von professionellen oder Amateur-Musikern, von Musikwissenschaftlern, Feuilletonisten oder einfachen Laien, in Mangel an Kenntnissen, irreführend konditionierter Ausbildung oder schlichten Aversionen gegen seine Persönlichkeit begründet. In Interviews trat Celibidache keineswegs zurückhaltend auf. Als Pionier einer bewussten Musizierhaltung bekämpfte er die beharrliche Ignoranz eines von Kommerz und Konsum, von eitlem Traditionsdenken und abgebrühter Routine, von spekulativen Theorien und blinder Fortschrittsgläubigkeit geprägten Milieus, dessen Akteure und Mitläufer sich als Mitwirkende einer Hochkultur verstehen, die dringender Erneuerung bedurfte und bedarf. Die Entwicklung, die die Kunst und die Musik im Besonderen im 20. Jahrhundert nahm, ist zwar in vielen historischen Abhandlungen beschrieben worden, doch ist sie keineswegs leicht zu verstehen und mit den gängigen Schlagworten nicht zu erfassen. Im 19. Jahrhundert hatte sich der Kampf zwischen der Fortschrittsmusik und einem immer mehr erstarrenden Akademismus, der alles zu einer beschaulichen Mittelmäßigkeit hin regulieren wollte, immer mehr zugespitzt. In seiner Konsequenz führte dieser Konflikt unaufhaltsam zu einer Revolution, die ihrer ursprünglichen Intention nach eine Befreiung sein sollte, was in der Epoche der ‚klassischen Moderne’, von Stiltendenzen wie Impressionismus, Expressionismus usw. getragen, in vielfältigstem individuellen Ausdruck kreativer Kräfte kulminieren sollte. Fort mit den einengenden Regeln, hinaus aus den Ummauerungen der kleinbürgerlichen Welt! Doch wie bei allen Revolutionen setzten sich dann vor allem jene Kräfte durch, die eine neue verbindliche Orientierung versprachen, ein neues Regelwerk aufstellten, das sich vor allem dadurch auszeichnete, dass es alle tradierten Gesetzmäßigkeiten ablehnte. Arnold Schönberg entdeckte 1922 eine Methode, die, wie er meinte, „der deutschen Musik die Vorherrschaft für die nächsten hundert Jahre sichern“ sollte: die Dodekaphonie, im Volksmund als Zwölftonmusik bekannt. Tatsächlich glaubte man, mit dem künstlichen Regelwerk dieser Technik, die alle Tonbeziehungen durch fortwährende Aushebelung ihrer tonalen Anziehungskräfte nivellierte, in die sogenannte ‚Atonalität’ vorgestoßen zu sein (wobei Schönberg, dessen schöpferisches Genie nicht infrage gestellt werden soll, mit diesem Terminus nicht einverstanden war und zum Ende seines Lebens eine halbgare Kehrtwende vollzog, ohne seine theoretischen Irrtümer einzugestehen). Sein fanatischer Musterschüler Anton Webern, eine singuläre sensitive Begabung, hingegen ging den Weg, den die Dodekaphonie ihrem Wesen nach verlangt, konsequent zu Ende, indem er Formspiele von aphoristisch verdichteter Kürze schuf, die seinen Nachfolgern als ideales Destillat des Wesentlichen per se erschienen.
Wie entsteht eine bezwingende große Form? Sie beruht immer auf erlebbarer Beziehung, auf rhythmischer, harmonischer und melodischer Ebene. Ungeachtet der Einfachheit oder Komplexität dieser Beziehungen sind alle anderen Parameter wie Klangfarbe oder Lautstärke nichts weiter als zusätzliche Begleiterscheinungen und eben keine selbständig strukturierbaren Aspekte des Klangs, da es im Erleben kein absolutes Maß für sie gibt. Das gleiche gilt auch für die Geschwindigkeit, die sich aus dem Charakter der Gestalten und der Dichte und Komplexität der klingenden Informationen ergibt. Hier gilt ausdrücklich: physikalische Messbarkeit steht in keinem direkten Verhältnis zum Erlebnis, denn wir können diese Aspekte nicht absolut, sondern nur in Relation zum klingenden Ganzen wahrnehmen. Da die Expansionskraft rhythmischer Kontraste allein nicht weit trägt (man vergegenwärtige sich gelungene Schlagzeugsoli in Jazz und Rock), basierte die große Expansion der Form in der westlichen Musik auf harmonischen Entfernungen, die mittels Modulation von einer Tonart in andere erreicht werden. Dies verlor natürlich in der Zwölftonmusik jegliche Bedeutung, da von Anfang an alle Töne möglichst gleichwertig da sind und dies als durchgängiger Zustand angestrebt wird. Wenn man überall gleichzeitig ist, kann man sich nirgendwo hin bewegen. Das ist nicht gleichbedeutend mit Atonalität, die sich auf die Strecke nur dadurch als Eindruck einstellt, dass die kontinuierliche Überforderung mit widersprüchlichen Eindrücken und die extreme Komplexität, die die Wahrnehmungsfähigkeit auch des geübtesten Hörers konsequent überschreitet, keine Orientierung mehr ermöglicht, die uns vom Anfang bis zum Ende ein zusammenhängendes Erleben des Ganzen ermöglichen würde.
Trotzdem hat man mit dieser Technik großformatige Werke geschrieben, die eben dann der inneren Notwendigkeit entbehren und nur dadurch existieren, dass ohne Rücksicht auf die eigenen Kapazitäten weitergeschrieben wurde. Die nächste Generation der Moderne, die in der Zeit nach dem II. Weltkrieg ans Ruder kam, übernahm diese Irrtümer und baute optimistisch auf ihnen weiter. Nun wurden alle Parameter reguliert (wie fern des ursprünglichen Wunschs nach Freiheit!), und das Zeitalter des Serialismus ausgerufen, der vollendeten künstlichen Durchorganisation des klingenden Geschehens. Natürlich bildete sich eine Gegenrevolte, die ebenso radikal die völlige Abschaffung allen Regelwerks verlangte, und es entstanden die ‚Techniken’ der freien Aleatorik, der Zufallskomposition usw. Pierre Boulez konstatierte treffend, dass im klingenden Ergebnis „totale Determination und totale Indetermination“ zum gleichen Resultat führen – was für eine totale Kapitulation vor den Gesetzmäßigkeiten des Klanges, freilich, ohne daraus Konsequenzen zu ziehen! Es ist eben alles ein sinnlich-intellektuelles Spiel. Sich aus diesen ideologischen Konstrukten zu befreien, ist keineswegs gleichbedeutend mit einer Rückwendung zu Vergangenem, auch wenn es dazu führen kann. Doch gibt es zugleich genug Komponisten (wenn auch aufgrund mangelnder Kriterien in der Ausbildung immer weniger), die fruchtbare neue Wege einschlugen (ich denke hier nur einmal aus jüngerer Zeit an Anders Eliasson, Jean-Louis Florentz, Ketil Hvoslef oder Per Nørgård, mit unterschiedlichsten Haltungen und Verfahrensweisen).
Die selbsternannte ‚Avantgarde’, die im Grunde Idealen hinterherläuft, die in den zwanziger Jahren en vogue waren, hat keineswegs den Siegeszug in die Konzertsäle angetreten, den sich sich selbst prophezeihte. Sie hat sich mittlerweile im mit historischen Fragmenten aufgemischten Dschungel der vollkommen chaotisch suchenden Postmoderne verloren und lebt nur noch dadurch weiter, dass es gelungen ist, mit verbaler Propaganda das Subventionsnetz sicherzustellen, das die Nutzung der öffentlich-rechtlich geförderten Spielplätze überhaupt ermöglicht. Kultur braucht Subvention, aber ohne ausgrenzende Ideologien.
Hätte man wirklich atonal komponieren wollen, so hätte die Umsetzung eines einfachen Gedankens genügt. Da Tonalität grundsätzlich auf Quintbeziehungen beruht, hätte man einfach die zwölftönige Einteilung der Oktave abschaffen müssen, und zwar nicht zugunsten einer Mikrotonalität, die auch wieder Quinten hervorbringt, sondern durch eine gleichstufige Aufteilung der Oktave in elf oder zehn Töne – dann gibt es keine Quinten mehr. Das Problem ist nur, dass außer Maschinen niemand diese künstlich generierten Tonschritte intonieren kann, dass man also Legionen von Spezialisten hätte züchten müssen, um dieses faszinierend utopische Niemandsland der Atonalität zu beackern. Dann hätte man auch die Grenzen des Ghettos der ‚Avantgarde’ von vornherein klar ziehen und sich dezidiert der ‚einzigen’ Zukunftsmusik widmen können – als Klang- und Geräuschforscher und nicht als Musiker. Der Begriff des Klang- und Geräuschforschers ist es denn auch, der wirklich zutreffend für die Schöpfer der sich so nennenden ‚neuen Musik’, ohne jegliche Diffamierung, am angebrachtesten wäre.
Solange diese Forschungen musikalischen Absichten dienen – also der Schaffung eines erlebbaren Zusammenhangs –, können die Entdeckungen jedoch alle musikalisch fruchtbar gemacht werden. Die Orientierungslosigkeit der Moderne, die jeder spürt, die absolute Beliebigkeit auf der Suche nach ‚Originalität’, was in diesem Fall nach dem noch nie Dagewesenen meint, gründet sich in der Abwendung von tonalen Beziehungen, egal wie dissonant und kompliziert diese sind. Tonalität ist nicht einengend als Wohlklang zu definieren (auch wenn dies ihr die eindeutigste Farbe verleiht), sondern ausschließlich als Beziehbarkeit der Phänomene zueinander in Bezug auf ein Ganzes.
Sergiu Celibidache war in diesem Sinne ein vollendeter Musiker. Sein ganzes Streben war stets darauf ausgerichtet, den einmaligen Zusammenhang des jeweils aufgeführten Werkes entstehen zu lassen. War der Komponist nicht in der Lage, diesen Zusammenhang zu erreichen, so nahm er Abstand davon – ohne ihm deshalb Genialität oder Originalität abzusprechen, und auch das Epigonale interessierte ihn nicht, denn die handwerklich beschlagene Routine der Nachahmung ist auch nur geborgte, nicht kernhafte Musikalität.
Die von Celibidache entdeckte musikalische Phänomenologie – die nur wenige Parallelen mit derjenigen Ernest Ansermets aufweist und mit deren religiösen und historischen Implikationen nichts zu tun hat – basiert auf der Erforschung der Gesetzmäßigkeiten des Klanges, des menschlichen Bewusstseins und der uninterpretablen Beziehung zwischen Klang und menschlicher Affektwelt. Dies ausführlicher darzulegen, wird an anderer Stelle geschehen. In einer Epoche der zunehmenden Orientierungslosigkeit aufgrund einer vorangegangenen der verwirrenden Manipulation ist sie notwendiger denn je, wenn wir den Kontakt mit der Essenz des Musikalischen nicht ganz verlieren wollen. Celibidache hat damit Generationen von Musikern eine Möglichkeit der Orientierung geschenkt, die ernsthaft Suchende aus der Spaltung zwischen subjektiver Willkür der ‚Interpretation’, materialistischer Buchstabentreue (sogenannter ‚Werktreue’) und philologisch orientierten Auslegungen aufführungspraktischer Detailhinweise (als ob irgendein Fisch wüsste, was das Wasser ist, in dem er selbstverständlich schwimmt) herausführen kann. Alles überkommene Verständnis von Musik, bis hin zu den brüchigen, falsch vereinfachten Fundamenten der ‚allgemeinen Musiklehre’, wie sie – falls überhaupt noch – an unseren Schulen gelehrt wird, alle Konditionierungen des Musikbetriebs dürfen – und müssen – dafür über Bord gehen. An ihre Stelle tritt aber keine ‚neue Lehre’, kein intellektuell absicherndes System, sondern eine bewusste, mithilfe von Wissen und Erfahrung sich allmählich herausbildende Haltung, die jede neue Herausforderung als einmalig, jedesmal neu versteht, basierend auf onthologisch im Wesen von Klang und menschlicher Wahrnehmung verankerten Gesetzmäßigkeiten, die wir nicht beeinflussen, sondern höchstens verdrängen können. Musik ist eine viel subtilere Kunst, als je theoretisch vermittelbar wäre.
Wer Celibidache zunächst einmal von einer anderen Seite als der öffentlich offensichtlichen kennenlernen möchte, schaue sich den folgenden Clip auf Youtube an, gespielt wird das erste der Trois pièces brèves von Jacques Ibert.
Hier arbeitet er in Kopenhagen mit dem Danish Wind Quintet, mit Musikern, die mit der Arbeitsweise der musikalischen Phänomenologie bereits vertraut sind, und in ungeteilter Gemeinsamkeit wird das Spezifische des Werks, sein Charakter und der daraus entwickelte Zusammenhang, herausgeschält. Eine taube Nuss, die keine Freude dabei haben könnte! Was ist das Wesen bewusster Arbeit, schließt sie etwas aus außer liebgewonnenen Bequemlichkeiten, eitlen Eigenwilligkeiten und zwanghaften Widerständen, könnte man fragen.
[Christoph Schlüren, August 2016]