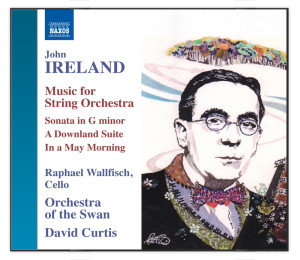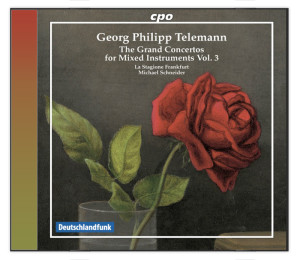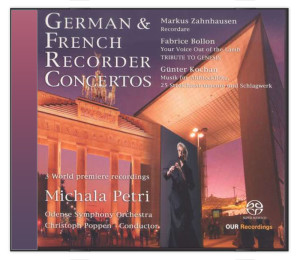Wie das Betrachten eines Sternenhimmels
Morton Feldman: Patterns in a Chromatic Field
Christian Giger, Cello
Steffen Schleiermacher, Klavier
CD 76’21 Min.,1/2014
©& MDG, 2016
MDG 613 1931-2
EAN 7 60623 19312 0
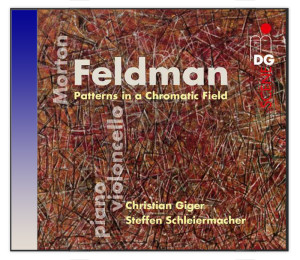
Bum Viiuuviiuviu Bum Viouvioviiu … BumzakBumzak Viviviovivi Bumzak – BumzakBumzak—Vivihioviiuviu …
Ich stelle mir einen an Neuer Musik interessierten Laien vor, der schon einmal den Namen Morton Feldman gehört hat, und der nun etwas von seiner Musik auch „hören“ („besitzen“) will. Ich stelle mir vor, er hat die erste Barriere (dieses hässliche Cover! Wollte MDG hier Gebühren für die VG Bild-Kunst sparen?) überwunden, und jetzt dieser Anfang! Ich drücke ihm die Daumen, dass er durchhält, denn schon nach eineinhalb Minuten verändert sich das Bild, allmählich (abgesehen von ein paar gelegentlichen kleinen „Störungen“ wie oben– dazu komme ich noch) kehren Ruhe und das typisch Feldmansche Schweben in Schwerelosigkeit ein. Wenn er die CD nicht vorher schon mit spitzen Fingern beiseitegelegt hat, dann kann er jetzt nacherleben, was Feldmans prominenterer Freund John Cage über diesen gesagt hat (zu finden in der deutschen Ausgabe von Silence, Bibliothek Suhrkamp 1995):
„Um die Dinge auf den neuesten Stand zu bringen, lassen Sie mich sagen, dass ich mich, wie immer, in Veränderung befinde, während mir Feldmans Musik sich eher fortzusetzen als zu verändern scheint. Es gab für mich nie, und gibt ihn auch jetzt nicht, einen Zweifel an ihrer Schönheit. Sie ist manchmal sogar zu schön. Das Aroma dieser Schönheit, das mir früher heroisch schien, berührt mich jetzt als erotisch (ein gleichwertiges Aroma, keineswegs von geringerem Rang). Dieser Eindruck rührt, glaube ich, von Feldmans Tendenz zur Zartheit her, einer Zartheit, die nur kurz, und manchmal überhaupt nicht, von Heftigkeit unterbrochen wird. […] Er besteht auf einer Aktion innerhalb der Skala von Liebe, und dies erzeugt (um nur die extremen Wirkungen zu erwähnen) Sinnlichkeit des Klanges oder eine Atmosphäre der Hingabe.“
Steffen Schleiermacher, vielleicht (neben Sabine Liebner oder Aki Takahashi) der kompetenteste bekannte und lebende Interpret für Klavierwerke der New York School, hat bei seinem jetzigen Hauslabel MDG bereits die mit vielen Preisen dotierte monumentale Complete Piano Music John Cages auf 18 CDs (dort sogar mit ansprechenden Covern) herausgebracht, danach (ab jetzt durchweg mit sehr hässlichen Covern) Morton Feldmans Late Piano Works (auf 3 CDs), und nun auch die zwei späten Schwesternwerke Feldmans (bei denen jeweils ein Streichinstrument solistisch eingesetzt wird): for John Cage (entstanden 1982) für Violine und Klavier (Andreas Seidel) und jetzt eben die Patterns in a Chromatic Field (entstanden 1981) für Cello und Klavier mit Christian Giger. Dass dabei beide Werke auch noch sekundengenau die gleiche Zeit (76’21 Minuten) beansprucht haben sollen, ist aber ein Druckfehler auf der Rückseite der „Patterns“-CD: Giger und Schleiermacher brauchen (innen im Booklet steht’s richtig) dafür 79’17 Minuten. Damit halten sie den Rekord, dicht gefolgt (mit 80’42 Minuten) von Aleck Karis (Klavier) und Charles Curtis (Cello). Alle anderen mussten das Stück auf 2 CDs aufteilen: Youtaka Oya (Klavier) und Arne Deforce (Cello) nehmen sich dafür 88’04 Minuten Zeit, Giancarlo und Marco Simonacci (Cello) 89’18 und Marianne Schroeder (Klavier) mit Rohan de Saram (Cello) gar 105’18 Minuten. Der Faktor Zeit wird von Kritikern traditionell überbewertet, ist aber hier, denke ich, doch von einiger Relevanz: Viele Werke Feldmans, und im Besonderen die „Patterns“, sind über weite Strecken von einer hochkomplexen, extrem vertrackten rhythmischen Struktur, welche bei allzu hastiger Interpretation kaum mehr gut dargestellt, geschweige denn verstanden werden kann. Umso erstaunlicher ist es, mit welcher Präzision und Luzidität Schleiermacher und Giger uns dieses wunderbare Werk nahebringen. Dazu sollte man wissen, dass Patterns in a Chromatic Field im Spätwerk Feldmans eine Sonderstellung einnimmt. Ich möchte kurz ausholen:
Morton Feldman erzählte nach der Uraufführung seines letzten Orchesterwerkes Coptic Light : „Ich habe gerade ein Stück für die Philharmoniker in New York geschrieben, und ich bekam eine sehr interessante Kritik: Der Rezensent sagte, ich sei der langweiligste Komponist in der Geschichte der Musik. […] Das ist die Hauptkritik an meiner Musik: sie sei nicht interessant. In Wirklichkeit ist damit gemeint, dass sie kein Moment von ‚Drama‘ enthält.“ Auch heute noch ist Vielen Feldmans Musik zu statisch, zu ereignislos. Vielleicht sollten sie sich dann einmal die „Patterns“ (übrigens manchmal, auch von Feldman selbst, als „Untitled Composition for Cello and Piano“ bezeichnet) anhören: Denn zu recht schreibt Walter Zimmermann (Morton Feldman Essays, Kerpen 1985) darüber: „Dieses Stück stellt sich ebenso erstaunlich quer zu den anderen längeren Stücken, wie dem Streichquartett, wie es auch das Stück für John Cage in seinem Gestaltenreichtum tat. Es ist das vitalste Stück, das Feldman je geschrieben hat. Es bröckelt und flirrt in schwierigsten rhythmischen Passagen des Cellos und erfordert in seinen 90 Minuten schier Unmögliches von den Interpreten.“ Übrigens war es sicher auch kein Zufall, dass das Michael Douglas Kollektiv für seine äußerst energetische Tanz-Performance Golden Trash (Gewinner des Kölner Tanz- und Theaterpreises 2013) genau dieses Stück Feldmans ausgewählt hat. Ich persönlich liebe ja gerade den „langweiligen“, den „hypnotischen“ Feldman, den „Trance Composer“ am meisten. Aber auch der kommt bei Schleiermacher und Giger nicht zu kurz: Herrlich die langen Pianissimo-Haltetöne des Cellos, wie Bewegung langsam in Stasis mündet und alles auf einmal zu leuchten beginnt. An dieser Stelle muss ich aber auch zugeben, dass ich die (langsamste) Interpretation von Marianne Schroeder und Rohan de Saram ganz besonders liebe. Diese CD des Kult-Labels hat ART ist leider vergriffen und deshalb inzwischen entsprechend teuer, wenn man sich nicht mit einem MP3-Download zufriedengeben will. Feldman, King of slow motion, King of silence, soll den Interpreten eines seiner Stücke einmal wütend zugerufen haben: „It’s too fuckin‘ loud, and it’s too fuckin‘ fast.“ Das kann man sicher Schroeder und de Saram am wenigsten vorwerfen. Hier trifft vielleicht am stärksten das zu, was Wilfrid Mellers in seinem Buch “Music in a New Found Land” über Feldman schreibt: „Music seems to have vanished almost to the point of extinction; yet the little that is left is, like all Feldman’s work, of exquisite musicality …” Und trotzdem gelingen auch der etwas härteren, stringenteren und strengeren Darstellung von Schleiermacher und Giger eben auch diese schwebend träumerischen Augenblicke (Ewigkeiten) ganz wunderbar. Und noch ein weiterer Aspekt von Feldmans Musik kommt in der vorliegenden Einspielung besonders gut zur Wirkung:
In den „Patterns“ benutzt Feldman sehr ausgiebig das von ihm so bezeichnete „spelling“, eine auskomponierte Mikrotonalität, bezeichnet durch Doppelkreuze und Doppel-B’s, die man aus der enharmonischen Verwechslung kennt, wo ihrer Vermeidung wegen umnotiert wird; „die er aber nicht funktional einsetzt, sondern als leichte Schwankung am Rande des gemeinten Tons verstanden wissen will“ (Walter Zimmermann in „Essays“). Lassen wir dazu Feldman selbst zu Wort kommen, der ein leidenschaftlicher Sammler alter türkischer Nomadenteppiche war (zu finden wieder in Walter Zimmermanns „Essays“): „ […] Ich benutze das, weil ich denke, es ist eine sehr praktische Art, das Hauptaugenmerk auf der Tonhöhe zu belassen. […] Aber diese Vorstellung habe ich nicht aus der Musik, überhaupt nicht. Ich habe sie von Teppichen. […] Eine der interessantesten Sachen bei einem schönen alten Teppich, der mit Naturfarben gefärbt ist, ist, dass er „abrash“ hat. […] Insofern ist die Farbe dieselbe und ist doch nicht gleich. Der Teppich hat eine Art mikrotonale Färbung. Wenn Sie ihn dann anschauen, dann hat er diesen herrlichen Schimmer, der von den sanften Abstufungen kommt.“ Und hier gebührt dem Cellisten Christian Giger ein ganz großes Lob, denn ihm gelingt der Zauber dieser feinen Subtilitäten ganz besonders gut.
Abseits aller Theorie möchte ich aber nicht vergessen, Ihnen das Hören dieser schönen CD ans Herz zu legen. Und, ein großer Vorteil, vielleicht der einzige, aber auch gravierende, eines „Heimkonzerts“: Sie können das Stück immer wieder hören, und Sie werden es mit jedem Mal besser verstehen und lieben lernen. Christian Wolff, Feldmans inzwischen einundachtzigjähriger Weggefährte aus den New-York-School-Zeiten, hat es im Booklet-Text zu Feldmans Streichquartett Nummer 2 sehr treffend zum Ausdruck gebracht: “Es geht natürlich darum, zuzuhören. Endgültige Informationen können hier nicht vermittelt werden. Diese Bemerkungen bieten einige Informationen, doch genau genommen sind sie für die Hörerfahrung dieser Musik nicht von Belang. Das Hören dieser Musik ist wie das Betrachten eines Sternhimmels bei Nacht, alles andere bleibt Material für eine Unterrichtsstunde in Astronomie.“
[Hans von Koch, April 2016]