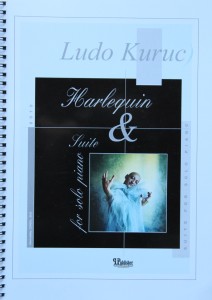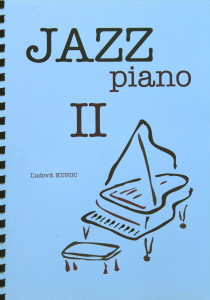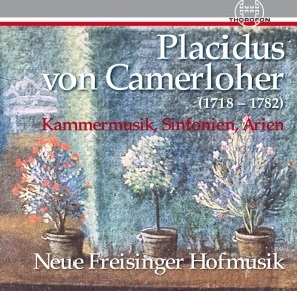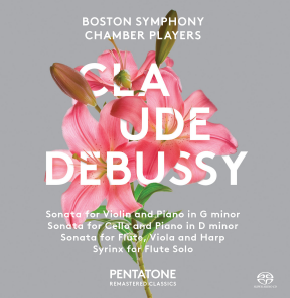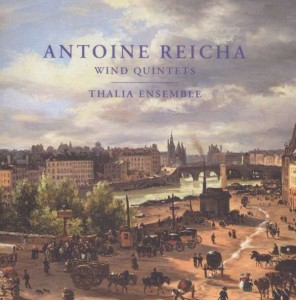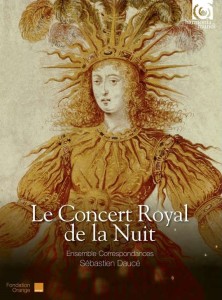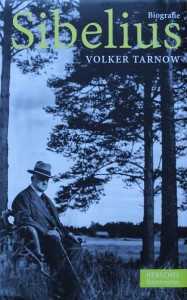Am 8. Januar 2016 erscheint die neueste CD-Einspielung des deutsch-amerikanischen Konzertpianisten Burkard Schliessmann, „Chronological Chopin“. Auf drei CDs spielt Schliessmann für Divine Art viele der Höhenpunkte aus dem Schaffen des polnischen Komponisten vom ersten Scherzo Op. 20 chronologisch aufwärts bis zur Polonaise-Fantasie Op. 61, inbegriffen alle Balladen und Scherzi, die 24 Préludes sowie einige Einzelwerke.
Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung durfte ich für „The New Listener“ das neue Tripelalbum hören und den Pianisten zu Chopin, zu seiner Art der Darbietung, zur Programmauswahl sowie natürlich auch über sich und sein Künstlertum interviewen.
[Oliver Fraenzke:]
In Ihren bisherigen Einspielungen widmeten Sie sich bereits einigen sehr zentralen Komponisten rund um Chopin, so wie Johann Sebastian Bach, der durchaus gewichtigen Einfluss auf die Musik Chopins hatte, oder Alexander Scriabin, welcher sich in seinem Frühwerk hauptsächlich den polnischen Komponisten als Idol erwählt hatte. Doch auch mit Musik Frédéric Chopins erschien bereits unter anderem 2003 eine CD von Ihnen. Nun folgt ein wahres Mammutprogramm, wo Sie auf gleich drei CDs etliche seiner Hauptwerke wie die Balladen, die Scherzi, die Préludes und weiteres veröffentlichen, teils zum wiederholten Male. Aber warum Chopin? In Ihrem Booklettext nannten Sie ihn als Ihren „Lieblingskomponisten“. Was macht ihn zu diesem und was ist so einzigartig an seiner Musik, dass Sie ausgerechnet ihn auserwählten für dieses große Projekt?
[Burkard Schliessmann:]
Chopin kann man nur verstehen und begreifen, wenn man verinnerlicht hat, dass er und seine Musik ein „ganzes Leben“ sind. So ist es eine Frage der Ästhetik, auf welch unverwechselbare Art und Weise seine Musik eine einzigartige Balance zwischen ‚Bedeutung des Moments und Forderung der Sache sind’. Hier geht es nicht um bloße ‚schöne Gefühlsduselei’, sondern um ‚kontrollierte Emotionalität’, basierend auf einem tiefen Verständnis der ‚klassischen Formen’ und deren inneren Strukturen.
In einer relativ kurzen Schaffenszeit von etwa 20 Jahren hat er die Grenzen der romantischen Musik neu definiert, wie er auch in der Beschränkung auf das Medium der 88 Tasten eine ästhetische Konzentration der Klaviermusik schlechthin sublimierte. Es war die völlige Identifizierung mit dem Instrument, welche in der radikalen Hervorbringung von Lyrik und Dramatik, Phantasie und Leidenschaft und deren einzigartiger Verschmelzung eine Tonsprache von aristokratischem Stilempfinden, formaler, klassischer Schulung und Formempfinden sowie Strenge vereinte. Chopins punktgenaues Denken erlaubte keine Experimente, weswegen er bezüglich seines stilistischen Denkens auch nicht »umherirrte«, wie Scriabin es getan hat.
Vergegenwärtigen wir uns: Alexander Scriabin äußerte einmal, dass Chopin sich in seiner gesamten Schaffenszeit so gut wie überhaupt nicht weiterentwickelt habe. Oft wurde ihm auch vielerseits die Konzentration auf das Klavier als »Einseitigkeit«, bisweilen »Einfallslosigkeit«, angeheftet und fehlgedeutet.
Alexander Scriabins innerer und äußerer Schaffensweg war der eines ausgesprochenen Kosmopoliten. Mehrere Schaffens- und Reifungsprozesse prägten sein künstlerisches Wirken als Komponist, Pianist, aber auch als Philosoph, ausgehend von einer – fast möchte man sagen – epigonalen Nachfolge der Werke Chopins bis hin zur Vorwegnahme der frühen Atonalität und seriellen Epoche, wofür seine letzten Sonaten und Préludes als Pionierleistungen die Landschaft dieses kompositorischen Denkens nachhaltig prägten und beeinflussten. So wie der von ihm auf Basis des Tritonus geschaffene »accord mystique« die Energiefelder seiner symphonischen Großwerke, aber auch der späten Sonaten als elektrisierendes Zentrum – und somit als Grundlage zur Abspaltung kompositorischer Raffinessen dienend – in den Mittelpunkt seines eigenen dodekaphonischen Denkens rückte, so wurde dieser Akkord zum Focus der tatsächlichen seriellen Idee und revoltierte somit in der gesamten kompositorischen Welt. Unter diesem Blickwinkel vermag Frédéric Chopin, der stets zurückgezogen lebte und kaum Einblicke in sein Künstler- und Privatleben gewährte, (scheinbar) zu verblassen.
Frédéric Chopins Rang als Komponist ist heute, mehr als 150 Jahre nach seinem Tod, unbestritten. Man dürfte sich auch endlich darüber einig geworden sein, dass er kein Salonkomponist, sondern ein wirklich »großer« Komponist war.
Ähnlich wie Mozart, Schubert und Verdi gehört Chopin zu den begnadeten Melodikern. Kaum ein anderer Musiker schuf Melodien von solcher Feinheit und Noblesse, von solchem Adel. Seine Balladen, Scherzi, Etüden, Polonaisen, die 24 Préludes, die b-moll- und h-moll-Sonate, mit deren Finalsatz – wie Joachim Kaiser es einmal formulierte – »ein todkrankes Genie einen herrlichen, grandios überhitzten Hymnus auf die Gewalt des Lebens komponiert hat«, gehören zum festen Konzert- und Schallplattenrepertoire.
Chopins Biographie hingegen liegt weitgehend im Dunkel. Er, der sich zeitlebens »entzog«, der Weltoffenheit eines Franz Liszt diametral entgegengesetzt, vermittelte stets den Eindruck eines Leidenden, beinahe möchte man sagen: eines Märtyrers, fast schon so, als ob dies Teil oder gar Grundlage seiner Inspiration sein sollte. Nicht umsonst stempelte die belletristische Literatur ihn zum »tuberkulösen Schmerzensmann« und »schwindsüchtigen Salonromantiker«. Nach kristalliner Vollkommenheit strebend, residierte er stets im eigenen Schneckenhaus. Seine charakterliche Kompromisslosigkeit zwang ihn letztlich auch zum Bruch seiner jahrelangen Bindung zu George Sand und deren Tochter Solange. Ein Einsamer, gewiss elitär, aber eben auch ein Leidender. Der Vergleich mit dem dänischen Philosophen Søren Kierkegaard erhellt das Gemeinte. Dieser soll als Kind den Berufswunsch »Märtyrer« geäußert haben. Zweifelsohne hatte auch Chopin etwas vom Kult dieses »Pater dolorosus«.
Obwohl bereits zu Lebzeiten eine europäische Berühmtheit, umgab ihn schon damals die Aura des Geheimnisvollen. Auch als ausübender Pianist nahm er eine Sonderstellung ein. Sein Spiel wird von allen Zeitgenossen als etwas einzigartig Individuelles geschildert. Äußerst selten erschien er auf dem Konzertpodium, fieberhaft erwartet von seinen Anhängern, »denn der, auf den man wartete, war nicht nur ein geschickter Virtuose, ein in der Kunst der Noten erfahrener Pianist; es war nicht nur ein Künstler von hohem Ansehen, er war das alles und mehr noch als das alles – es war Chopin«, schreibt Franz Liszt 1841 in der Rezension eines Chopin-Konzertes. Liszt äußert sich weiter über Chopins Zurückgezogenheit: »Was aber für jeden anderen der sichere Weg ins Vergessenwerden und in ein obskures Dasein gewesen wäre, verschaffte ihm im Gegenteil ein über alle Capricen der Mode erhabenes Ansehen. […] So blieb diese kostbare, wahrlich hohe und überragend vornehme Berühmtheit verschont von allen Angriffen.«
Den Grund für seine Zurückgezogenheit und sein seltenes Erscheinen auf dem Podium erklärt Chopin selbst, und seine Bemerkung zu Liszt, dessen Virtuosität Chopin stets bewunderte, ist entsprechend aufschlussreich: »Ich eigne mich nicht dazu, Konzerte zu geben; das Publikum schüchtert mich ein, sein Atem erstickt, seine neugierigen Blicke lähmen mich, ich verstumme vor den fremden Gesichtern. Aber Du bist dazu berufen; denn wenn Du Dein Publikum nicht gewinnst, bist Du doch imstande, es zu unterwerfen.«
Franz Liszt charakterisierte Chopin in seiner Chopin-Biographie von 1851:
»Wenn auch diese Blätter nicht ausreichen, von Chopin so zu reden, wie es unseren Wünschen entsprechen würde, so hoffen wir doch, daß der Zauber, den sein Name mit vollem Recht ausübt, all das hinzufügen wird, was unseren Worten fehlt. Chopin erlosch, indem er sich allmählich in seiner eigenen Glut verzehrte. Sein Leben, das sich fern von allen öffentlichen Ereignissen abspielte, war gleichsam ein körperloses Etwas, das sich nur in den Spuren offenbart, die er uns in seinen musikalischen Werken hinterlassen hat. Er hat sein Leben in einem fremden Lande ausgehaucht, das ihm nie zu einer neuen Heimat wurde; er hielt seinem ewig verwaisten Vaterland die Treue. Er war ein Dichter mit einer von Geheimnissen erfüllten und von Schmerzen durchwühlten Seele.«
Wesentlich ist auch für das Verständnis und die Interpretation von Chopin und seiner Musik der Begriff der „Askesis“ im Sinne der griechischen Ethoslehre: „Askesis“ nicht etwa im Sinne von “Verzicht“ oder „Entsagung“, sondern gerade dem Gegenteil, nämlich des unabingbaren „Dran-Bleibens“ an der Sache: Eine Eigenschaft, die ihn auch mit wenig anderen Großen der Musikgeschichte verband: Bach, Mozart – um nur zwei zu nennen: Niemals nachlassende Energie, die ein Kunstwerk bis zu seiner letzten Form prägte. Verfolgt man die Entstehung der großen Werke Chopins, so sieht man die ungeheure Entwicklung. Selbst an Verzierungen arbeitete er unerbittlich, entwarf mehrere Versionen, um letztendlich zu einer ganz bestimmten Version zu finden, die er als bindend ansah.
In diesem Zusammenhang ist auch seine tiefe Bindung zu Bach zu verstehen.
So hatte Chopin Das Wohltemperierte Klavier, die neue Pariser Ausgabe, mit nach Mallorca gebracht und widmete sich einem besonderen Studium des Hauptwerkes von Johann Sebastian Bach.
Die Liebe für Bach verbindet ihn mit Felix Mendelssohn, auch mit Ferdinand Hiller. Mit Hiller und Liszt hatte Chopin Bachs Konzert für drei Klaviere aufgeführt. Bach bedeutet für Chopin Größe und Ordnung und Ruhe. Bach bedeutet auch Geborgenheit in der Vergangenheit. Nach der sehnt er sich immer und überall zurück. Bereits in frühester Jugend wurde Chopin durch seinen Warschauer Lehrer Wojciech Żywny auf Bachs Werke aufmerksam gemacht – für den damaligen Zeitgeschmack höchst ungewöhnlich. Seine Schüler lässt Chopin im Wesentlichen Bachs Präludien und Fugen studieren, und in den beiden Wochen, in denen er sich einmal im Jahr auf ein Konzert im größeren Rahmen vorbereitet, spielt er ausschließlich Bach. Bereits in seinen Études hat Chopin gezeigt, wie gut er selbst jene Gesetze der Logik und Konstruktion beherrscht, die er bei Bach bewundert. Nun komponiert Chopin seine 24 Préludes op. 28 und knüpft erneut an Bachs Tradition an. Zwar folgt keinem seiner Préludes eine Fuge, dennoch ist jedes Stück in sich geschlossen und birgt eine eigene Aussage. Wie Bachs Wohltemperiertes Klavier ist Chopins Zyklus auf vierundzwanzig Einheiten angelegt und umfasst alle zwölf Töne in Dur und Moll; allerdings sind sie gemäß dem Quintenzirkel angeordnet und nicht in einer chromatischen Fortschreitung der Tonarten.
In einer Rezension in der Revue et Gazette musicale vom 2. Mai 1841 schreibt Franz Liszt über Chopins Konzert vom 26. April 1841: »Die Préludes von Chopin sind Kompositionen von ganz außergewöhnlichem Rang. Es sind nicht nur, wie der Titel vermuten ließe, Stücke, die als Einleitung für andere Stücke bestimmt sind, es sind poetische Vorspiele, ähnlich denjenigen eines großen zeitgenössischen Dichters [gemeint ist vermutlich Lamartine], die die Seele in goldenen Träumen wiegen und sie in ideale Regionen emporheben. Bewundernswert in ihrer Vielfalt, lassen sich die Arbeit und die Kenntnis, die in ihnen stecken, nur durch gewissenhafte Prüfung ermessen. Alles erscheint hier von erstem Wurf, von Elan, von plötzlicher Eingebung zu sein. Sie haben die freie und große Allüre, die die Werke eines Genies kennzeichnet.«
Robert Schumann stimmten die Préludes op. 28 hingegen ratlos: »Es sind Skizzen, Etudenanfänge, oder will man, Ruinen, einzelne Adlerfittige, alles bunt und wild durcheinander. Auch Krankes, Fieberhaftes, Abstoßendes enthält das Heft; so suche jeder, was ihm frommt.«
Möglicherweise erkannte Schumann hier bereits eigene Wesenszüge. Zumindest sah er sich Vorwürfen dieser Art auch schon ausgesetzt. So schreibt der Kritiker Rellstab 1839 in der Rezension von Schumanns Kinderszenen von »Fieberträumen« und »Seltsamkeiten«.
Chopin selbst reagierte hingegen ärgerlich, als George Sand von »nachahmender Tonmalerei« sprach, und er protestierte mit aller Kraft gegen theatralische Deutungen. »Er hatte recht«, gestand später George Sand einsichtig. Ebenso hätte ihn wütend gemacht, wie sie über das Prélude in Des-Dur schrieb und es in mystische Erlebnisse und Sphären transferierte: »Das Prélude, das er an jenem Abend komponierte, war wohl voll der Regentropfen, die auf den klingenden Ziegeln der Kartause widerhallten; in seiner Fantasie aber und in seinem Gesang hatten sich diese Tropfen in Tränen verwandelt, die vom Himmel in sein Herz fielen.« Tatsächlich komponierte Chopin auf Mallorca nicht anders als sonst: nobel, majestätisch, elegisch.
Zu meiner eigenen Interpretation: ALLE Interpretationen dieser neuen Edition sind Neu-Aufnahmen, die in mehreren recording-sessions in den teldex-studios in Berlin gemeinsam mit den Produzenten Friedemann Engelbrecht, Tobias Lehmann und Julian Schwenkner entstanden sind. Das Instrument, einer meiner eigenen Steinways ist ein ganz besonderes Instrument, das von Georges Ammann stets meisterhaft intoniert wurde. Das Arbeiten mit diesem Team vollzog sich in einer regelrechten Trance, kennen wir uns seit vielen Jahren und vertrauen einander. Bereits die Goldberg-Variationen hatte ich mit Engelbrecht und Schwenkner (erschienen 2007 auf Bayer) eingespielt, ebenso die‚ Chopin-Schumann Anniversary Edition’ von 2010 (erschienen auf MSR-Classics, USA, im Jahre 2010). Bezieht man die von Ihnen erwähnte Einspielung von 2003 der Balladen und anderen großen Werken (erschienen auf Bayer) mit ein, handelt es sich in der nun vorliegenden Edition also bereits um die dritte Version einiger Interpretationen. Beispielsweise der Balladen, der Fantaisie op. 49, der Barcarolle op. 60 und der Polonaise-Fantaisie op. 61. Gerade in der Barcarolle und der Polonaise-Fantaisie spürt man ganz besonders meine persönlich-künstlerische Entwicklung an und mit den Werken. Insgesamt ist es ein Leben ‚mit’ jenen Werken, die meine letzten Jahre der Beschäftigung mit Chopin prägten. Man kann aber hier auch deutlich die Unterschiede der Akustik und den damit verbundenen Einfluss auf Interpretation sehen: Während die Einspielung von 2003 in der Friedrich.Ebert-Halle in Hamburg entstand, wurden die Einspielungen 2010 in einem ganz besonderen Saal, dem altehrwürdigen Rundfunkzentrum in der Nalepastraße in Berlin realisiert. Auch jeweils unterschiedliche Steinways (ebenfalls mein Eigentum) sind hier zu hören. Die hier aktuell vorliegenden Einspielungen sind allesamt in den teldex-studios entstanden. Wahrheit der Musik, Wahrheit des Klanges und Wahrheit der Interpretation bilden für mich ein „untrennbares Ganzes“. Darin sehe ich die Verwirklichung meiner persönlichen „Askesis“ …
Vielen Dank für diese ausführliche und weitschweifende Antwort, die bereits einige meiner weiteren geplanten Fragen beantworten konnte und die auch vieles beinhaltet, was in Ihrem Booklettext ausgeführt wird.
Doch entsprechend bieten Ihre Worte auch viele Anknüpfungspunkte für neue Fragen. Zunächst interessant ist natürlich das Paradoxon, Chopin habe die Grenzen der Romantik neu definiert, sei aber gleichzeitig einseitig gewesen und habe sich nicht weiterentwickelt. Ist also diese Neudefinition Ihrer Ansicht nach ein spontaner Glücksgriff, ein ganz persönlich geborener Stil, der ohne Entwicklungsprozess sofort voll ausgereift und dergestalt für künftige Generationen richtungsweisend war? Anders lassen sich aus meiner Perspektive die zwei widersprechenden Thesen nicht kombinieren – oder sehen Sie eine n dieser beiden divergierenden Aussprüche als unzutreffend an?
Und was hat es mit der Beschränkung auf das Klavier auf sich? In allen Werken Chopins tritt das Klavier auf, hinzugenommenes Orchester, Cello, Singstimme oder andere Mitstreiter sind die absolute Ausnahme. War diese Einseitigkeit entscheidend für den Individualstil und die (sofern doch existierende) Entwicklung Chopins? Wäre seine Musik überhaupt für andere Besetzungen denkbar?
Man muß unterscheiden und deutlich voneinander trennen: Zum einen sehen wir uns mit Alexander Scriabin und dessen Haltung zu Chopin konfrontiert. Selbstverständlich war Scriabin (im übrigen auch einer meiner Favoriten!) in seiner ersten kompositorischen Schaffensperiode ein Epigone Chopins. Boris Pasternak, einst ein väterlicher Freund Scriabins – schrieb: „… auf den Fenstersimsen lagen die verstaubten Archive Chopins …“. Seine erste Schaffensperiode steht deutlich unter dem Einfluss Chopins. Besonders die Préludes op. 11 drücken jenes Spannungsfeld. Mit der Sonate Nr. 3 in fis-moll op. 23 schloß Scriabin die Orientierung an der „Tradition“ ab. Von nun an geht sein Denken in eine völlig andere Richtung. Ich bin sicher, ohne Scriabin und besonders der dritten Schaffensphase hätte die gesamte Musikgeschichte eine andere Entwicklung genommen. ER war es, der die Zwölftontechnik begründete: Der „accord mystique“, im Zentrum der Werke stehend, war Energieträger für sämtliche Ideen. Scriabins früher Tod – musikgeschichtlich zweifelsohne tragisch – birgt dennoch ein versöhnliches Fazit, erscheint eine kompositorische Weiterentwicklung nach seinen letzten Werken fast unmöglich. Zumindest schwer vorstellbar wie Scriabin hätte weiterverfahren sollen, wäre ihm ein längeres Leben gegönnt gewesen. Unter diesem Blickwinkel ist auch zu versehen, dass Scriabin in einem Interview vom 28. März 1910 äußerte: „Chopin ist ungemein musikalisch, und darin ist er all seinen Zeitgenossen voraus. Er hätte mit seiner Begabung zum größten Komponisten der Welt werden können; aber leider entsprach sein Intellekt nicht seinen musikalischen Qualitäten. […] Merkwürdigerweise hat sich Chopin als Komponist so gut wie überhaupt nicht entwickelt. Fast vom ersten Opus an steht er als fertiger Komponist da, mit einer deutlich abgegrenzten Individualität“. Scriabin stand für eine völlig andere kompositorische Entwicklung, nämlich derjenigen, die sich an „Experimentierung“ orientierte. Chopin hingegen vertraute der „klassischen Tradition“ und entwickelte aus deren Energiefelder jene puristische Form der Musik, die andere,,unter anderem auch Robert Schumann, in der damaligen Zeit missverstanden.
Friedrich Nietzsche beschreib in „Menschliches, Allzumenschliches II“ von 1877– 79 sehr gut das „Festhalten“ in der Tradition, welches er als „Konvention“ deutet: „Der letzte der neueren Musiker, der die Schönheit geschaut und angebetet hat, gleich Leopardi, der Pole Chopin, der Unnachahmliche – alle vor ihm und nach ihm Gekommenen haben auf dies Beiwort kein Anrecht – Chopin hatte dieselbe fürstliche Vornehmheit der Konvention, welche Raffael im Gebrauche der herkömmlichsten einfachsten Farben zeigt, – aber nicht in Bezug auf Farben, sondern auf die melodischen und rhythmischen Herkömmlichkeiten. Diese ließ er gelten, als geboren in der Etikette, aber wie der freieste und anmutigste Geist in diesen Fesseln spielend und tanzend – und zwar ohne sie zu verhöhnen“. Insofern in konkreter Beantwortung Ihrer Frage: Ja, eindeutig ein „Glücksgriff“, ein ganz persönlicher Stil, der ohne Entwicklungsprozess voll ausgereift war und für Generationen richtungsweisend war, ein Zusammentreffen vieler Parameter und Kräfteballungen sowie Energiefelder, aber auch soziologische Aspekte, die jene Konzentration ermöglicht haben.
So ist jene Beschränkung auf das Medium der 88 Tasten als eine ästhetische Konzentration zu verstehen. Durch die völlige Identifizierung mit dem Instrument, welche in der radikalen Hervorbringung von Lyrik und Dramatik, Phantasie und Leidenschaft und deren einzigartiger Verschmelzung eine Tonsprache von aristokratischem Stilempfinden, formaler, klassischer Schulung und Formempfinden sowie Strenge vereinte, ist eine „Besetzung“ für anderes Instrumentarium schwerlich vorstellbar. Chopins punktgenaues Denken erlaubte daher auch keine Experimente, weswegen er bezüglich seines stilistischen Denkens auch nicht »umherirrte«, wie Scriabin es beispielsweise getan hat. Umgekehrt gilt, dass „Transkriptionen“ seiner Werke ebenso ins Leere laufen und die innere Essenz niemals zur Geltung bringen kann.
Bezeichnend ist, dass Anton Rubinstein, selbst Pianist und Virtuose, in Die Musik und ihre Meister, 1891 jene „Konzentration“ auf das Klavier folgendermaßen charakterisierte: „Alle bisher Genannten [aufgeführt waren u. a. Mozart, Beethoven, Schubert, Weber, Schumann, Mendelssohn] haben ihr Intimstes, ja, ich möchte beinahe sagen ihr Schönstes dem Clavier anvertraut, – aber der Clavier-Barde, der Clavier-Rhapsode, der Clavier-Geist, die Clavier-Seele ist Chopin. – Ob dieses Instrument ihm, oder er diesem Instrument eingehaucht hat, wie er dafür schrieb, weiß ich nicht, aber nur ein gänzliches In-einander-Aufgehen konnte solche Compositionen ins Leben rufen. Tragik, Romantik, Lyrik, Heroik, Dramatik, Phantastik, Seelisches, Herzliches, Träumerisches, Glänzendes, Großartiges, Einfaches, überhaupt alle möglichen Ausdrücke finden sich in seinen Compositionen für dieses Instrument und alles Das erklingt bei ihm auf diesem Instrument in schönster Äußerung“.
Scriabin ist zweifelsohne ein sehr interessanter Fortführer Chopins und leitet ja tatsächlich auch direkt über in die freie Tonalität. Aber darf ich fragen, wieso ausgerechnet der mystische Akkord oder Prometheusakkord (ein von Scriabin gefundener sechsstimmiger Quartenakkord, der statt einer Grundtondefinition ein Klangzentrum bildet; auf dem Zentrum C lauten seine Töne C-Fis-Ais-E-A-D) Initiator der 12-Ton-Technik sein soll? Natürlich weicht er vom klassischen Tonalitätsempfinden ab, doch schafft er noch immer Zentren, die ja gerade im Prometheus auch lange Zeit stabil bleiben, und sucht nicht die völlige Auflösung von Bezügen, sondern das Schaffen neuer Verbindungen.
Jedoch zurück zu Chopin. Sie machten bereits einige Aussagen, wie Frédéric Chopin selber am Klavier gespielt und wie er seinen Schülern doch ganz andere Sachen beigebracht haben muss. Gibt es genauere Quellen, die auf sein Spiel und seine Lehrmethoden eingehen und was ist uns überliefert? Und wie sieht es heute aus, sollten wir uns an sein Spiel halten, oder an seine gelehrten Methoden – oder sollten wir doch davon Abstand nehmen und einen eigenen Zugang zu Chopins Musik suchen?
Wir finden bei Scriabin anfangs bei mit erstaunlich eigener Gestik eine vermengte subtile Chopin-Nachfolge, die Elemente Liszts, Schumanns und Brahms ebenso integrierte wie neutrales Salonpathos – und das alles unter Vermeidung folkloristischer Anklänge. Von hier aus gelangte er zu einem exakt kalkulierbaren harmonischen System von transponierbaren Quartenakkorden. Von hier aus erreichte sein Denkstil immer mehr elitär-arrogante Bereiche individualspekulativer Selbstüberhöhung auf der Basis einer regelrecht verformten Theosophie. Seine Tagesbuchnotizen lesen sich wie eine riesige Kluft zwischen seinem bedeutsamen künstlerischen Schaffen einerseits und jenen merkwürdigen persönlich-denkerischer Züge andererseits. Seine Charakterzüge waren geprägt von Fatalismus, Egozentrik, Aktionswahn, Idealismus, Mystik, Prophetie und Hybris. Am Ende seines Lebens sah er sich sogar als Messias, der der Menschheit mit einem geplanten musikalisch-kultischen Riesenopus das Medium zur Läuterung vermitteln sollte. Auch wenn sein Versuch, die Musik zu erhöhen, sie mit Farben, Düften und Worten zu einem im Kern tief humanen Gesamtkunstwerk von bleibender Wirksamkeit zu geschalten, gescheitert ist, gehört rein musikalisch aber zu den geistigen und erregend differenziertesten Beständen der Kulturwelt. Hierdurch weist sich Scriabin als Persönlichkeit aus, die Scriabin als Persönlichkeit der um 1870 geborenen Komponisten die stilistisch-harmonische und tonale Landschaft des anbrechenden 20. Jahrhunderts neu definierte.
Auch wenn bei Schönberg die 12-Tonreihe am Anfang eines Werkes das entscheidend-strukturelle Medium darstellt, so ist es gerade bei Scriabin der im Zentrum eines Werkes sehende Prometheusakkord, der von hier aus Energien nach vorne und hinten ausstrahlt, serielle Techniken bzw. Variations- und Montagetechniken bildet und im übrigen eine kleine Sekund nach oben – also chromatisch – transponiert alle 12 Töne der Skale repräsentiert.
Versucht man Scriabin zu „erklären“, so findet man bei Boris Pasternak folgende Zeilen: „Das war die erste Ansiedlung des Menschen in Welten, die Wagner für Fabelwesen und Mastadons entdeckt hatte, Paukensachläge und chromatische Wasserfälle aus Trompeten, die so kalt klangen wie Strahl einer Feuerspritze, scheuchten sie hinweg … über dem Zaun der Symphonie glühte die Sonne van Goghs. Auf ihren Fenstersimsen lagen die verstaubten Archive Chopins … ich konnte diese Musik nicht ohne Tränen anhören.“
Bei Chopin wissen wir über seine zahlreichen Schüler – hauptsächlich davon verdiente er sein Geld – genau, wie und was er unterrichtete. Beispielsweise Karol Mikuli: Mikuli studierte zuerst in Wien Medizin, ging aber 1844 nach Paris und wurde Schüler Chopins – später war er dessen Assistent – und Rebers in der Komposition. Die Revolution 1848 vertrieb ihn in seine Heimat. Nachdem er sich als Pianist durch Konzerte in verschiedenen österreichischen, russischen und rumänischen Städten bekanntgemacht, wurde er 1858 zum künstlerischen Direktor des Galizischen Musikvereins zu Lemberg (Konservatorium, Konzerte und so weiter) gewählt. 1888 trat er von der Leitung des Musikvereins zurück und leitete nur noch eine Privatschule. Er veröffentlichte die erste Gesamtausgabe der Werke Chopins, deren unübertroffener Interpret er bis zum Ende seines Lebens war. Mikulis Ausgabe von Chopins Werken (Kistner) enthält viele Korrekturen und Varianten nach Chopins eigenhändigen Randbemerkungen in Mikulis Schulexemplar. Sie sollten für uns bindend sein. Auch ich orientiere mich an ihnen.
Moscheles, selbst einer der bedeutendsten Pianisten des 19. Jahrhunderts, findet 1839 die vielleicht aussagekräftigsten und schönsten Worte zu Chopins pianistischem Rang und Können: »Sein [Chopins] Aussehen ist ganz mit seiner Musik identificirt, beide zart und schwärmerisch. Er spielte mir auf meine Bitten vor, und jetzt erst verstehe ich seine Musik, erkläre mir auch die Schwärmerei der Damenwelt. Sein ad libitum-Spielen, das bei den Interpreten seiner Musik in Taktlosigkeit ausartet, ist bei ihm nur die liebenswürdigste Originalität des Vortrags; die dilettantisch harten Modulationen, über die ich nicht hinwegkomme, wenn ich seine Sachen spiele, choquiren mich nicht mehr, weil er mit seinen zarten Fingern elfenartig leicht darüber hingleitet; sein Piano ist so hingehaucht, daß er keines kräftigen Forte bedarf, um die gewünschten Contraste hervorzubringen; so vermißt man nicht die orchesterartigen Effecte, welche die deutsche Schule von einem Klavierspieler verlangt, sondern läßt sich hinreißen, wie von einem Sänger, der wenig bekümmert um die Begleitung ganz seinem Gefühl folgt; genug, er ist ein Unicum in der Clavierspielerwelt.«
Viel diskutiert blieb auch die Art und Weise seines Rubatos, wo die Aussagen seiner Zeitgenossen ein völlig unterschiedliches Bild ergeben. »Sein Spiel war stets nobel und schön, immer sangen seine Töne, ob in voller Kraft, ob im leisesten piano. Unendliche Mühe gab er sich, dem Schüler dieses gebundene, gesangsreiche Spiel beizubringen. ›Il (elle) ne sait pas lier deux notes [Er (sie) weiß nicht, wie man zwei Töne miteinander verbindet]‹, das war sein schärfster Tadel. Ebenso verlangte er, im strengsten Rhythmus zu bleiben, haßte alles Dehnen und Zerren, unangebrachtes Rubato sowie übertriebenes Ritardando. ›Je vous prie de vous asseoir [Bitte, bleiben Sie sitzen]‹, sagte er bei solchem Anlaß mit leisem Hohn.« Diese Aussage einer Schülerin polarisierte ganze Generationen von Klavierprofessoren im Bemühen um den Begriff »Rubato«, vor allem aufgrund auch anderslautender, gewichtiger Worte, beispielsweise denjenigen von Berlioz, die in Chopins Spiel übertriebene Freiheit und allzugroße Willkür sahen: »Chopin ertrug nur schwer das Joch der Takteinteilung; er hat meiner Meinung nach die rhythmische Unabhängigkeit viel zu weit getrieben. […] Chopin konnte nicht gleichmäßig spielen.« Offenbar gestattete er seinen Schülern jene Freiheiten nicht, die er für sich selbst relativierte.
Weitere Schüler/Schülerinnen waren u.a. Marcelina Czartoryska, Émile Decombes, Carl Filtsch, Adolphe Gutmann, Maria Kalergis, Georges Mathias, Delfina Potocka, Charlotte de Rothschild, Jane Stirling, Thomas Tellefsen und Pauline Viardot.
Chopin selbst arbeitete am Schluß seines eigenen Lebens noch an einer eigenen Klavierschule, die, wie man nach Aufzeichnungen weiß, Methodik (er komponierte ja auch eigens „pour la Méthode des Méthodes de Moscheles et Fétis“, die in zweiseitigen Übungen 1841 von Maurice Schlesinger ohne Opuszahl veröffentlicht wurden) und Technik neu definieren sollte. Leider kam es zur finalen Fertigstellung nicht mehr …
Die Tradition und Stilistik des Chopin-Spiels hat sich ja auch stetig verändert. Paderewski, Cortot, Rubinstein, Pollini, Zimerman, Pogorelic, Schliessmann …
Sicher eine jeweilige Frage der Zeit des jeweiligen Zeitgeistes und der damit verbundenen Erkenntnisse …
Wie Sie so klar formulierten, verändert sich das Chopinspiel immer weiter und viele Pianisten bringen neue Aspekte ans Licht. Wo sehen Sie sich in dieser Tradition der Chopinrezeption? Versuchen Sie sich an das zu halten, was über Chopins eigenes Spiel bekannt ist oder doch eher an das, was er gelehrt hat? Oder wollen Sie einen neuen Weg einschlagen und die Entwicklung der sich verändernden Traditionen weiterführen?
Kaum ein Spiel bzw. eine Stilistik hat sich im Laufe der Jahre immer wieder derart stark verändert, wie diejenige des Chopin-Spiels. Tatsächlich hat man auch früher von regelrecht typischen „Chopin-Spielern“ gesprochen. Cortot war zum Beispiel ein solcher. Auch wenn ich ihn unglaublich schätze und verehre, gerade wegen seines intuitiv-inspirierten und improvisatorischen Spiels, war sein Spiel am Schluss, bestimmt auch wegen seiner Krankheit und des damit verbundenen Morphinismus, außerordentlich manieriert und entmaterialisiert. Die unmittelbare „Antwort“ darauf war Rubinstein: Sein Spiel männlich-kraftvoll, die klassizistische Note und damit Strenge von Chopin hervorhebend (Beethoven sah er als Romantiker!), war er der Gegenpol zu Cortot. Er „rückte gerade“, was Cortot entmaterialisiert hatte. Man muß sich dies ähnlich vorstellen wie die vielen Bach-Interpretationen nach der Wiederentdeckung durch die Wiederaufführung der Matthäuspassion Bachs durch Mendelssohn: Wie viele regelrechte Entstellungen mußte Bach seit diesem Zeitpunkt „erfahren“, so dass eine Wiederherstellung der Ordnung durch Rosalyn Tureck und insbesondere Glenn Gould mehr als notwendig war. „Interpretations-Kultur“ – bezeichne ich jenes Phänomen. Es ist die Verantwortung eines Interpreten, die Antwort auf die Errungenschaften eines Kollegen zu geben. Anders wären auch Persönlichkeiten in der Chopin-Tradition nach Rubinstein wie Argerich, Pollini, Zimerman, Pogorelich etc. nicht denkbar.
Sie führen viele der auf „Chronological Chopin“ eingespielten Werke bereits seit längerer Zeit im Repertoire und haben viele davon schon einmal auf einer CD festgehalten. Wie verändert der zeitliche Abstand die Art, Chopin zu spielen? Gibt es dabei Grundtendenzen, werden die Werke beispielsweise langsamer, weil nun mehr zwischen den Tönen entstehen kann, oder verändert sich die Art und Ausführung des Rubatos?
Ich selbst sehe mich in jener Tradition, Altes mit Neuem zu verbinden, lese ständig unterschiedliche Texte und setze mich extrem mit den »Verzierungen« auseinander, da diese einem ganz besonderen Augenmerk bedürfen. Im Anhang der ‚Paderewski-Edition‘ beispielsweise kann man viel lernen … Dies ist durch seine eigenen Handschriften überliefert und bindend. Am Rubato kann man auch wenig ändern: Willkürliches gibt es bei Chopin nicht, dafür hat er selbst viel zu lange an seinen Handschriften gesessen. An einem Werk wie der F-Dur Ballade saß er von 1836 – 1839. Den Schluss änderte er mehrmals: Noch Robert Schumann hörte ihn in F-Dur, bevor ihn Chopin endgültig in fahles a-moll abdunkelte und das Werk balladesk beendete.
Dennoch: Ihre Frage beantworte zumindest ich – ich denke, es steht mir zu – mit einem klaren Ja: Selbstverständlich habe ich eine Vision und möchte die Weiterentwicklung der Chopin-Interpretation vorantreiben. Insbesondere klanglich: Jener Aspekt ist mir heilig, an jener Komponente weder ich ein Leben lang arbeiten. Ich bin Synästhetiker und sehe die Welt der Klänge in Farben. Insbesondere deshalb blicke ich sowohl über 88 Tasten und über ein Orchester hinaus …
Generell denke ich über Grenzen hinweg und sehe ausschließlich jene Komponente, die als Transzendenz jenseits einer Komposition zu finden ist. Es ist eine Vision, von der ich geleitet werde, eine Vorstellung, die selbst die Kräfte (m)einer Intuition bei weitem überschreitet.
Auf keinen Fall werden die Werke im Laufe der Zeit langsamer beziehungsweise sind langsamer geworden, im Gegenteil. Heute betone ich eher sogar die virtuose Linie. Aber die „objektive Richtigkeit“ hat sich verändert. Wenn man derart intensiv wie ich das Leben mit den Werken verbringt, so weiß man auch schnell, wo die „Durchlässigkeit“ für Freiheiten liegt und wo diese gestattet sind. Ich selbst kann über mich und meine Interpretationen sagen, dass die »innere Stimmigkeit« „runder“ wird. Der angestrebte, große Bogen wird deckungsgleicher mit meiner Vision …
Auch diese Antwort bietet wieder sehr viele Anknüpfungspunkte. Dazu interessiert mich zunächst, was Sie damit meinen, es gäbe kein willkürliches Rubato? Oder anders gefragt, wie und an welchen Stellen hat dann das Rubato zu sein und wie genau sollte es ausgeführt werden?
Sie haben vor allem den Klang betont und dass Sie über den Rand des Konzertflügels hinaus blicken. Welchen Klang streben Sie denn an, wie hat dieser zu sein und an was orientiert er sich?
»Rubato« ist ein musikalisches Phänomen, was niemals „willkürlich“ sein darf, etwas, was minuziös geplant sein muß und auch exakt – falls man den Text genau liest und ihn versteht – im Text direkt und indirekt verankert ist bzw. daraus hervorgeht. Bei ‚Chopin‘ darf Rubato niemals willkürlich eingesetzt werden. Bereits Artur Schnabel (von mir hochverehrt) hat Rubato bei Chopin „gelehrt“. Gerade ER war es ja auch, der Notentexte generell intellektuell verstanden hat und erst danach seinem Gefühl vertraute. Auch für mich ist das „Chopinsche-Rubato“ klar: Die Gestaltung beruht auf der „Linienführung des Basses“: Bleibt diese gleich bzw. liegt sie auf einem repetierenden »Orgelpunkt«, so darf das Tempo in keiner Weise verändert werden. Erst mit der Veränderung der melodischen Linienführung des Basses dass (auch) das Tempo variieren. Ein Effekt von ungeheurer Wirkung, die, entsprechend eingesetzt, beklemmend sein kann.
Umso geplanter und sparsamer »Rubato» eingesetzt wird, umso bedeutungsvoller ist jedes Detail. »Rubato« unterliegt der inneren Struktur und Gesetzmäßigkeit einer Komposition.
Genauso ist es mit »Klang«: Ich habe eine absolut konkrete Vorstellung von jedem einzelnen Ton: Sowohl demjenigen, den ich selbst spiele, aber auch vom Instrument selbst. Letztlich ist es eine Einheit. Der Ton eines Instruments beruht aber auch auf dessen mechanischen Regulierungen, auch hier konvergieren alle Kräfte zu einem großen Ganzen. Der »Klang«, den ich anstrebe und bevorzuge, ist ein sonorer, runder und tragfähiger Klang ohne jegliche Härte. In jedem Ton lebt eine eigene Welt. Seit vielen Jahren (genau gesagt seit 1984) arbeite ich mit Georges Ammann, jenem berühmten Techniker von STEINWAY & SONS, der ebenso exakte Vorstellungen von Klang und Regulierung eines Instruments hat und dies als Einheit sieht. Bei meinen Aufnahmen ist er ständig an meiner Seite – wir sind ein absolut verläßliches Team …
Den Konzertflügel fasse ich als „Streichinstrument“ auf. Perkussion ist mir fremd und ein völlig methodisches Missverständnis: Einzig die »Streichergruppe« ist in der Hervorbringung eines Tones und dem Nachzeichnen des horizontalen Verlaufs eines Notentextes methodisch verwandt. Und hierin liegt das große Missverständnis, pädagogisch-methodisch insbesondere der Asiaten: Da das perkussive Element die gesamte Technik beherrscht, ist deren „Klang“ (?) metallisch hart.
Ich selbst orientiere mich am ‚Cello‘: Das Cello verfügt über jenen sonoren-tragfähigen Klang, wird ja auch als „Verlängerung der menschlichen Stimme“ bezeichnet. Hinzu kommt eine sexuell-erotische Komponente dieses Instruments.
„Wenn wir uns die vom Tanz dominierte Musik Bachs anhören, wird uns unweigerlich bewußt, dass er, wiewohl er von der barocken Sicht des Tanzes als menschliche und weltliche Ordnung ausgegangen sein mag, dessen alte religiös magische Implikationen wieder heraufbeschwor“. So beginnt das Kapitel mit der Überschrift „Stimme und Körper: Bachs Solocellosuiten als Apotheose des Tanzes“ in Wilfrid Meilers‘ Buch Bach and the Dance of God. Meilers legt in der Folge nahe, dass wir „wenn wir uns das Zeitalter des Barock als den Triumph des Humanismus nach der Renaissance vorstellen, die sexuelle Symbolik von Bogen und Saite als allumfassend akzeptieren [können]. Das Instrument ist weiblich passiv, der Bogen männlich aktiv; zusammen führen sie zur Schöpfung“. Außerdem stellt er fest, dass „Bachs Musik für Solovioline und für Solocello die vollendetste Manifestierung dieser Vermenschlichung eines Instrumentes [ist]“ und dass das Cello, noch mehr als die Violine, den gesamten Menschen widerspiegelt. Der Grund dafür ist, behauptet er, dass „sein Timbre von allen Instrumenten dem einer männlichen Stimme mit großem Umfang am ähnlichsten [ist]; was das Körperliche anbelangt, so erfordert es Bewegungen der Arme, des Rumpfes und der Schultern, was bedeutet, dass man beim Cellospielen gleichzeitig im Takt singt und tanzt“.
… und exakt so fasse ich den Konzertflügel auf. …
Bezüglich der »Methodik« meine ich die Einbeziehung des gesamten Armes (von der Handwurzel bishin zum Oberarm und der Schulter) und dessen Linienführung sowie des gesamten Körpers zur Hervorbringung eines Tones sowie des Nachzeichnens der horizontalen Linie des Notentextes.
Sie hoben hervor, die virtuose Linie mittlerweile mehr zu betonen, aber war Chopin nicht eher der vordergründigen Virtuosität abgeneigt und nutzte sie rein zum Ausdruck seiner Musikalität? Warum sollte dann eben dieses Element hervorgehoben werden?
Mit der „virtuosen Linie“ möchte ich nicht missverstanden werden: Natürlich ist hier keine „vordergründige Virtuosität“ gemeint, sondern jene Ebene der Allumfassenheit, der Selbstverständlichkeit, der alle Bereiche der objektiven, aber auch subjektiven Richtigkeit miteinschließt. Jene von mir angesprochene Virtuosität beschreibt eben jene bereits angesprochene Transzendenz, wo Schwerelosigkeit und Bedeutungsvolles sowie Ebenmäßigkeit des Ablaufs zu einer Einheit verschmelzen … Bedeutung des Moments und Forderung der Sache …
Der Pianist Artur Schnabel, ein hochgeschätzer Beethovenapologet, bezeichnete Chopin spöttisch als einen rechtshändigen Melodiker. Andererseits schätzte Brahms, bekanntlich ein ausgewiesener Kontrapunktiker, Chopin und dessen Werke außerordentlich, setzte sich für sie ein und verlegte sogar einige. Was für eine Bedeutung als Komponist würden Sie Chopin innerhalb dieses Meinungsdisputes attestieren?
Ein hochspannender Themenkomplex. Tatsächlich war Artur Schnabel ein hochgeschätzter Beethovenapologet, der in dieser Generation und in dieser Zeit eine Revolution bzgl. der Interpretation der ‚Klassischen Klaviermusik‘, insbesondere der Beethoven-Interpretation, begründete. Seine Art, »Text« zu lesen und zu verstehen, war einzigartig und bahnbrechend. Spannungsfelder nach unterschiedlichen Parametern – melodische, harmonische, metrische und rhythmische Artikulation – entsprechend zu analysieren und zu einer neuen Einheit zusammenzufügen, blieb beispiellos.
In einer früheren Frage hatte ich Ihnen unter anderem geantwortet, dass es einst „typische Chopin-Interpreten“ wie beispielsweise Alfred Cortot gab. Es ist eine regelrechte „Charakter- und Stil-Frage“. Ich bin ganz sicher, dass Schnabel ein typischer „klassischer Interpret“ war; und so war er auch insbesondere für die Interpretation der Musik von Mozart, Beethoven und Schubert berühmt. Das, was er in der Musik „suchte“ – stilistisch und charakterlich – konnte er mit seinem Verständnis bei Chopin schwerlich finden. Zumal man in „seiner“ Zeit Chopin primär als „romantischen“ Komponisten verstand und das „klassische Element“ in seinem Œuvre noch nicht erkannt hatte. Unter diesem Aspekt ist dann auch seine Abwertung, Chopin sei ein „rechtshändiger Melodiker“ gewesen, zu verstehen und zu relativieren.
Ebenso wie es immer wieder zur Diskussion kommt, ob Brahms selbst denn ein guter oder eher mäßiger bisweilen klobiger Pianist gewesen war. Zweifelsohne verfolgte Brahms eine komplett andere Stilistik, aber ich bin ganz sicher, jemand, der ein derart elegantes und hochvirtuoses Werk wie die Paganini-Variationen komponierte, muß pianistisch hochgeschult und stilistisch regelrecht revolutionär-modern gewesen sein. Insofern kann man seine Bewunderung für Chopin, der sich aus ästhetischen Gründen – wie bereits ausführlich dargelegt – auf das Medium der 88 Tasten konzentrierte, nachvollziehen und verstehen.
Wir sprachen bereits über musikalische Einflüsse und Werke, die Chopin besonders geschätzt hat. Doch wie sieht es mit persönlichen Bezügen aus? Welche Personen aus dem Leben des Komponisten haben ihn besonders inspiriert zum Komponieren? Hauptsächlich seine Liebschaften oder doch andere Begegnungen – oder hat er sich mit seiner unzweifelbar innerlichen und persönlichen Musik doch ganz von menschlichen Einflüssen gelöst?
Chopin hat Bach ganz besonders geschätzt. Das Wohltemperierte Klavier, die neue Pariser Ausgabe, hatte er mit nach Mallorca gebracht und widmete sich einem besonderen Studium des Hauptwerkes von Johann Sebastian Bach.
Alle Menschen, die Chopin nahe gestanden hatten, wußten, wie sehr er Mozarts Requiem geliebt hatte, dass er den Klavierauszug, ob auf Mallorca oder in Nohant, immer bei sich haben wollte und er in seinem Salon griffbereit auf Pergolesis Stabat Mater lag. Eugène Dalacroix war einer jener Freunde, die im Leben Chopins eine ganz besondere Rolle spielten. In einem letzten Gespräch mit ihm am 7. April 1849 war es um die Logik in der Musik gegangen: Chopin hatte damals Delacroix Harmonie und Kontrapunkt erklärt und den Aufbau einer Fuge verdeutlicht. Dann war das Gespräch auf Beethoven und Mozart gekommen. Beethoven lasse oft zeitlose Prinzipien außer Acht, hatte Chopin gesagt, Mozart niemals. Bei ihm hat jede einzelne Partie ihren Verlauf, aber immer in Zusammenhang mit den anderen; so entsteht die vollkommen gestaltete Melodie; das ist der Kontrapunkt, der punto contra punto.
So war auch sicher, dass bei Chopins Beerdigung beziehungsweise der Totenfeier in der Kirche St. Madeleine in Paris Mozarts Requiem aufgeführt werden sollte. Jeder wußte, wie sehr Chopin den weiblichen Gesang und Sängerinnen vergötterte, so hatten auch seine Schüler und Schülerinnen noch den Satz im Ohr: Sie müssen mit den Fingern singen. Viele Schülerinnen und Schüler hatte er zum Gesangsunterricht geschickt: Wenn Sie Klavier spielen wollen, müssen Sie singen lernen. Wer die vollkommen gestalteten Melodien singen sollte, stand auch schnell fest: Außer Chopins Freundin Pauline Viardot-Garcia hatten die Sopranistin Jeanne Castellan, der Tenor Alexis Dupont und der Bassist Luigi Lablache zugesagt. Siebzehn Jahre zuvor wurde Chopin von Lablache in Paris mit der Aufführung von zwei Rossini-Opern inspiriert: Otello und L’Italiana in Algeri.
Chopins engste Freunde, die ihn und sein Werk stets inspirierten, begleiteten ihn auch auf seinem letzten Weg: Auguste Franchomme, Eugène Delacroix, Adolf Gutmann, Hector Berliox, auch seine Verleger, waren gekommen und Camille Pleyel, der größte Teil des polnischen Exiladels, die Clésingers, seine Schüler und Schülerinnen … Finanziert wurde alles von Jane Starling, jener Schottin, die auch Chopin in den letzten Jahren nach der Trennung von Goerge Sand maßgeblich unterstützte und auch die Konzertreise 1848, jener „Ochsentour“, nach England sponsorte. So war es auch möglich, dass Chor und Orchester des Conservatoire zugesagt hatten und als Dirigent Narcisse Girard berufen werden konnte. Er hatte in den Jahren 1832 und 1834 in der Salle de Conservatoire am Dirigentenpult gestanden, als Chopin sein e-moll Konzert spielte.
Getragen wurde Chopins Kunst insbesondere durch eine gesellschaftliche Komponente, die maßgeblich durch George Sand und das Leben auf Nohant ermöglicht wurde. Hier traf man sich zum gegenseitigen Austausch. Zentral war hier immer wieder Augène Delacroix.
Wenn andere Komponisten der damaligen Zeit, beispielsweise Liszt, zu ihren eigenen Lebzeiten „Berühmtheits-Status“ erreichten, so war es sicherlich etwas Besonderes. Chopin allerdings erlangte zu Lebzeiten allerdings den Status von etwas „Legendärem“: Am 1. April 1847 fahren George Sand und Chopin in die Rue de Vaugirard in Paris. Sie steigen aus vor dem Renaissancepalast, den Maria de Medici als Witwe hatte erbauen lassen. Ein Palazzo mit Buckelquadern, wie sie ihn aus ihrer Kindheit in Florenz kannte. Für die Franzosen ist das seit langem nur ihr „Palais de Luxembourg“. Verschiedene Funktionen hatte er gehabt: Als Kunstausstellungen hatte er gedient, als Waffenmanufaktur, als Gefängnis für Danton, Desmoulin und David … Seit 1834 ließ ihn die Regierung erweitern, ein Parlamentsaal wurde angebaut, auch eine Bibliothek. Deren zentrale Kuppel malte Delacroix seit 1845 aus. In jenem Gemälde kommen George Sand und Chopin als Personen vor: Delacroix hatte hier Chopin als Dante verewigt, George Sand wurde als Aspasia, der zweiten Frau des Perikles, dargestellt.
Die Besonderheit jener Verkörperung kann insbesondere vor jenem Hintergrund verstanden werden, dass Marie d’Agoult sich sehr geärgert haben muß, hatte sie selbst Franz Liszt als Dante gesehen, und zwar zu jener Zeit, als sie und Liszt noch ein Paar waren … Jenen verewigten Rang nahm nun mit spielerischer Leichtigkeit Frédéric Chopin ein …
Seit Sommer 1845 leidet Chopin an einer Krankheit, die er als bereits überwunden zu haben glaubte, nun aber zu einem echten Schmerz heranwächst und fortan wesentlich sein künstlerisches Schaffen wesentlich beeinflusst, nämlich dem Heimweh. Ausgelöst wurde jene Krankheit insbesondere durch einen Besuch Ende Mai/Anfang Juni von George Sand und Chopin einer Veranstaltung in der Salle Valentino in der Rue Saint-Honoré, wo die Bilder des Amerikaners George Catlin, einen m fünfzigjährigen Juristen, der seit langem nur noch für die Rechte der Indianer kämpfte und deren Leben in Zeichnungen, Aquarellen, Stichen und schriftlichen Aufzeichnungen dokumentierte. Chopin bewegte hier vor allem das Schicksal einer der jungen Indianerinnen, dass er seiner Familie in Polen ausführlich davon berichtete. Nicht DASS sie gestorben, sondern WORAN sie gestorben war, beschäftigt ihn. Die Frau von einem, der Kleiner Wolf hieß, sie hieß Oke-we-mi … Die Bärin die auf dem Rücken einer anderen marschiert, ist an Heimweg gestorben (das arme Geschöpf) -, und auf dem Friedhof Montmartre (dort wo auch Jaṥ begrabren liegt) setzt man ihr ein Denkmal. Vor dem Tod hat man sie getauft, das Begräbnis fand in der Madelaine statt, so Chopin an seine Familie. Sogar das geplante Denkmal schildert Chopin genau im Schreiben an seine Familie. Der offiziellen Nachricht zufolge war die Indianerin zwar an Schwindsucht gestorben. Sind die Grenzen – oder auch Übergänge – zwischen Heimweh und Schwindsucht für Chopin nicht etwa fließend? Jaṥ, sein polnischer Freund, starb in der Fremde an Schwindsucht, und auch Carl Filtsch, Chopins genialster Schüler, aus Siebenbürgen stammend, ist fern seiner Heimat an derselben Krankheit gestorben. Consomption, Verzehrwerden, Auszehren, sind die Symptome. „Verzehrt“ sich auch auch Chopin in seinem Wehmut an das Ferne, Verlorene? Werden seine Kräfte für die Gegenwart durch die Trauer um das Verlorene aufgefressen? Chopin selbst weiß um seine Situation und schreibt seiner Familie: Ich bin immer mit einem Fuß bei Euch, mit einem anderen bei der Herrin des Hauses, die im Nebenzimmer arbeitet. Klar, wer Heimweh leidet, lebt nie ganz im Hier und Jetzt, sondern zu einem wesentlichen und bestimmenden Teil im Dort und Damals, in espaces imaginaires, wie Chopin selbst dies nannte.
Dass Chopins Totenfeier in der Madelaine stattfinden sollte, geht im Wesentlichen auf jene Assoziation mit der an Heimweh gestorbenen Indianerin zurück, deren Totenfeier ebenfalls hier abgehalten wurde.
Chopins Werk ist inspiriert von jenem Weltschmerz, die seine Kompositionen in einer ganz besonderen Form von Sehnsucht bestimmen. Erfüllung und Erlösung fand er erst im Tod. Ich bin jetzt an der Quelle des Glücks, waren seine letzten Worte …
Zentral für Ihren Klang wird selbstverständlich wohl auch Ihre synästhetische Wahrnehmung sein, die Sie bereits ansprachen. Als Synästhesie wird ja die Kopplung eigentlich getrennter Bereiche der menschlichen Psyche bezeichnet, meist in Form der Verbindung von zwei Sinnen. Am bekanntesten ist wohl die Form der Verbindung zwischen opischen und akustischen Phänomenen, sprich das „Hören von Farben“ zu bestimmten Tönen. Welche Ausformung hat Ihre Synästhesie beziehungsweise (da in den meisten Fällen mehrere parallel vorliegen) haben Ihre Synästhesien? Sehen Sie auch Farben beim Erklingen von Musik, gibt es dabei Besonderheiten wie unechte Farben (manche sehen anscheinend Farben, die es in der Natur auf diese Art nicht gibt) und haben Sie auch sonstige unwillkürlichen Sinnesverknüpfungen, die musikbezogen sind? Wie beeinflusst die Synästhesie Ihren Sinn für Klang und Wirkung, also auch Ihren Anschlag?
Für mich besteht die gesamte Musik und jeder einzelne Ton aus vielen einzelnen Farben. „Unechte“ Farben gibt es dabei nicht, zwar allemöglichen Mischformen, diese beruhen aber – wie allemöglichen Klänge – auf der Basis und dem Verhältnis reeller Farben. So, wie ich Musik primär unter „harmonischer Artikulation“ empfinde (das heißt, bei entsprechenden Klängen habe ich ‚Gänsehaut‘), so sind es auch „harmonische Farben“, die mich in „Einklang“ mit der subjektiven Richtigkeit einer Interpretation und eines Klanges bringen. Selbstverständlich steht dies alles in direktem Zusammenhang mit dem »Anschlag« und dem damit hervorzubringenden »Klang«. Daher resultiert ja auch mein ungeheurer Anspruch an die Instrumente bzw. Techniker: Exakte Vorstellung eines Tones → Klang → Instrument ↔ Interpretation → Werk(vollendung) → Wahrheit bilden schließlich eine untrennbare Einheit beziehungsweise ein »Gesamtkunstwerk«. Jeder Faktor baut auf den anderen auf beziehungsweise ist von ihm abhängig. Endet schließlich alles in einer »Katharsis«, so ist es ein großes Glück …
Des öfteren hörte ich davon, man könne die Synästhesie kurzzeitig „überlisten“ durch eine Art Überflutung an parallelen Höreindrücken, so beispielsweise durch eine rasche, freie Akkordfolge, wie bei Prokofieff häufig zu finden, oder eine Clustermusik wie bei Ligeti. Was sehen Sie bei solch einer diffizilen Musik? Entscheidet so auch die Synästhesie über Ihren Musikgeschmack und entsprechend Ihre Programmwahl?
»Synästhesie« ist niemals „überlistbar“ beziehungsweise „trügbar“. Es ist eine emotionale Wahrnehmung, die durch keinerlei Programmwahl oder Musikgeschmack beeinflusst werden kann. Ob man Chopin in der Interpretation von Arturo Benedetti Michelangeli oder einen Song dargestellt von Helene Fischer wahrnimmt, erlebt und erfährt: Sicher, nicht zu vergleichende Extreme, aber dennoch Gefühlswelten, die letztendlich ähnlich sein können. Ob Atonalität oder Clustermusik: Die Frage ist, ob Ihr Inneres eine neue Definierung erfährt oder nicht.
Nun möchte ich noch auf die Programmauswahl Ihrer neuen Tripel-CD „Chronological Chopin“ eingehen. Darauf befinden sich alle Balladen und Scherzi, die 24 Préludes, die Fantasie f-Moll, die Berceuse Des-Dur, die Barcarolle Fis-Dur sowie die Polonaise-Fantasie As-Dur. Aus welchen Gründen fiel Ihre Wahl gerade auf diese Stücke? Was sprach beispielsweise gegen die Aufnahme einiger bekannter Einzelstücke aus den Walzern, Nocturnes, Mazurken oder von berühmten anderen Werken wie dem Fantasie Impromptu Op. 66 oder Andante spianato und Grande Polonaise op. 24?
Auf den drei Platten sind die Werke chronologisch aufgereiht, doch ist sich ja schon lange die Kritik einig darüber, Chopin habe wenig Entwicklung durchlebt und Sie nannten sein Spiel von Anfang an einen „Glücksgriff“, der keine Herumirren nötig hatte. Wieso dann diese zeitlich geordnete Aufstellung?
Mit dieser Edition ist meine „Chopin-Orientierung/Beschäftigung“ noch lange nicht abgeschlossen. Eine nächste Einspielung wird sich insbesondere mit den »Drei Sonaten« beschäftigen – und auch die von Ihnen angesprochenen Werke einschließen.
Vor allem die Mazurken bedürfen einer eigenen Beschäftigung und Darstellung: Mit keiner anderen Form als dieser hat sich Chopin länger auseinandergesetzt und beschäftigt als mit dieser, keine andere Form ist ein längeres Spiegelbild der lebenslangen kompositorischen Beschäftigung als dasjenige der Mazurken, dem Spiegelbild der Reminiszens an seine polnische Heimat.
Die vorliegende Edition beschäftigt sich mit den außerordentlichen Werken Chopins. Werke, an denen er – wie in anderen Darlegungen bereits beschrieben – immer wieder und viele Jahre gearbeitet hatte. Ob Chopin wenig Entwicklung durchlebt hat, möchte ich bezweifeln, im Gegenteil – auch dies habe ich in meinem Booklet-Text bereits eingehend dargelegt. Sicherlich, ein „Glücksfall“: Ferruccio Busoni, in seinem Vorwort zu Bachs Wohltemperiertem Klavier, 1894: „Chopins hochgeniale Begabung rang sich durch den Sumpf weichlich-melodiöser Phrasenhaftigkeit und klangblendenden Virtuosentums zur ausgeprägten Individualität empor. In harmonischer Intelligenz rückt er dem mächtigen Sebastian [Bach] um eine gute Spanne näher.“
Und seinen Zürcher Programmen, 1916, ist zu entnehmen: „Chopins Persönlichkeit repräsentiert das Ideal der Balzacschen Romanfigur der 30er-Jahre: des blassen, interessanten, mysteriösen, vornehmen Fremden in Paris. Durch das Zusammentreffen dieser Bedingungen erklärt sich die durchschlagende Wirkung von Chopins Erscheinung, der eine starke Musikalität das Beständige verleiht.“
Die Werke Ihrer Einspielung nennen Sie die außerordentlichen Werke, an denen Chopin besonders lange arbeitete. Wie genau habe ich das Wort „außerordentlich“ zu verstehen, was hebt dieses Programm von sämtlichen anderen Stücken ab, was macht sie so außerordentlich?
Über die Kompositionsweise Chopins ist ja einiges bekannt, besonders sein minutiöses Feilen an jeder noch so unscheinbaren Note, so dass das Resultat zeitgleich improvisatorisch wie auch letztgültig in die Form gepasst erscheint. Haben Sie über diesen Vorgang noch näheres Wissen, Details oder unbekanntere Erkenntnisse, die Sie mit uns teilen könnten?
Es steht außer Frage, dass pianistisch wie auch in der kompositorischen Anlage die Vier Balladen die Krönung des Chopin’schen Schaffens bilden. Ausgehend vom Opus 23, der ersten Ballade, bishin zur vierten, dem Opus 52, erstrecken sich diese Tongedichte in ihrer Entstehung über einen Zeitraum von elf Jahren (1831–1842) und sind somit ein Spiegel hinsichtlich der Art und Weise bezüglich der Vereinigung von poetischer Ausdruckskraft mit meisterlicher, großformatiger Gestaltung sowie pianistischer Fülle. In ihrer musikalischen Aussage sind sie jeweils eine Welt für sich, wobei jede Spekulation, ob diese Werke denn durch literarische Vorlagen des polnischen Schriftstellers Mickiewicz inspiriert wurden oder nicht, sich erübrigt. Bestimmend für den gesamten Stimmungsgehalt sind nämlich die zwingenden Übergänge der jeweiligen Episoden untereinander, die in ihrer frappierend starken und überzeugenden Wirkung Betrachtungen der eigenwilligen formalen Anlage schon beinahe vergessen lassen. Während die zweite Ballade in ihrem drastisch-dramatischen Wechsel der Passagen von idyllisch-pastoraler Beschaulichkeit und plötzlich hereinbrechendem Sturm vorüberzieht, faszinieren die anderen Balladen mit ihren sanften und gleitenden Übergängen und verleihen den Werken somit eine einzigartige Organik.
Aber auch die anderen Werke zeichnen sich durch eine bislang nicht dagewesene „Dichtigkeit“ in der kompositorischen Anlage aus.
Die Musikgeschichte kennt die Gattung und Form des Scherzos seit Langem. Beethoven hatte in seinen Sonaten, Symphonien und in seiner Kammermusik bereits mehrmals das Scherzo an Stelle des bis dahin üblichen Menuetts gesetzt; und auch Schubert betitelte einige seiner kleineren Stücke mit »Scherzo«, ebenso Mendelssohn (beispielsweise op. 16 und op. 21). Chopin übernahm diesen Begriff, gestaltete ihn in Form und Struktur aber frei nach seiner Intuition. In seinen Scherzi könnte man vielleicht sein Bestreben erkennen, die herkömmliche Anlage der Sonate aufzulösen und einzelne Teile daraus zu verselbständigen.
Die anderen Werke rücken beinahe schon in Bereiche der sogenannten „Absoluten Musik“. Die „Abgrenzung“ hierbei liegt darin, dass insbesondere die Balladen literarisch inspiriert sind, wohingegen Berceuse, Barcarolle und Polonaise-Fantaisie, um nur einmal drei zu nennen, keine literarischen Vorlagen haben und als wirkliche Monolithen dastehen.
Als ein Kabinettstück von nirgends sonst erreichter Delikatesse des Klangs gilt beispielsweise die Berceuse Des-Dur op. 57. Bewundernswert der geniale Einfall, wie sich über einer ostinaten Bassfigur, einer Chaconne vergleichbar, Akkordbrechungen, Fiorituren, Arabesken, Triller und kaskadenartige Passagen als Variationen aufbauen und entwickeln, die sich aus anfänglich träumerischer Ruhe in immer schnellerer Koloratur und brillantem Schillern zu einem virtuosen Mittelteil steigern, um dann wieder zu jener visionären Ruhe zurückzufinden, wenn der Achtelrhythmus mit der wiegenden Figur der linken Hand verschmilzt.
Die Neue Zeitschrift für Musik schrieb am 16. September 1845: „Die linke Hand beginnt mit einer einfachen, wiegenden zwischen Tonica und Dominante abwechselnden Begleitungsfigur. Im 3ten Tacte setzt die rechte ein mit einer schwebenden Melodie, wie sie wohl eine Mutter, die, selbst halb wachend, halb träumend, ihren Liebling in den Schlaf lullt, vor sich hinschlummern mag. Eine zweite Stimme gesellt sich bald hinzu; und während die Linke wiegend fortfährt, variirt die Rechte das Schlaflied auf mannigfache, träumerisch spielende Weise. Die letzte graziöse und schmiegsame Veränderung zieht sich aus der Höhe, mehr nach der Mitte der Klaviatur. Allmäßig verstummt das zarte Lied. – Wohl selig mag das Kindlein träumen!“
Von sublimer Schönheit geprägt ist die Barcarolle op. 60. In ihrer Ausdrucksskala, ihrer fluoreszierenden Farbenpracht, dem wiegenden Rhythmus wie auch ihrer vollendeten formalen Gestaltung ist sie eines von Chopins Meisterwerken. Carl Tausig über die Barcarolle: »Hier handelt es sich um zwei Personen, um eine Liebesszene in einer verschwiegenen Gondel; sagen wir, diese Inszenierung ist Symbol einer Liebesbegegnung überhaupt. Das ist ausgedrückt in den Terzen und Sexten; der Dualismus von zwei Noten (Personen) ist durchgehend; alles ist zweistimmig oder zweiseelig. In dieser Modulation in Cis-Dur (dolce sfogato) nun, da ist Kuß und Umarmung! Das liegt auf der Hand! – wenn nach 3 Takten Einleitung im vierten dieses im Baß-Solo leicht schaukelnde Thema eintritt, dieses Thema dennoch nur als Begleitung durch das ganze Gewebe verwandt wird, auf diesem die Cantilene in zwei Stimmen zu liegen kommt, so haben wir damit ein fortgesetztes, zärtliches Zwiegespräch.«
Die Allgemeine Musikalische Zeitung begeisterte sich am 17. Februar 1847: „Die schaukelnde Bewegung der Barcarole lässt sich zwar nur durch ein zweitheiliges Maass, das den Schlag und Widerschlag der Wellen auszudrücken vermag, repräsentiren, jedoch erhöht es den Charakter, wenn die einzelnen Tactglieder in dreitheiligem Rhythmus, also in Triolen gehalten sind. Am Ruhigsten gleitet das Ganze aber dahin, wenn der Zwölfachteltakt den doppelten Schlag und Widerschlag ausdrückt, und besonders bei grösserer und ausgedehnterer Form des ganzen Musikstückes ist dies ein treffliches Mittel, um die Tactgruppen zu stetigem Flusse zu verbinden. Den Rhythmus, von dem das Gepräge des Ganzen abhängt, lässt Chopin zuerst als Begleitungsfigur, wie wir sie in vielen seiner Etuden finden, auftreten, und baut auf dieselbe die zweistimmige Melodie, so dass man sich die Wasserfahrt irgend eines zufriedenen und glücklichen Paares dabei wohl denken kann. In diesem ganz behaglichen Zustande belässt der Componist die Sache nicht, sondern zieht Wendungen, die der Barcarole fern liegen, herein, lässt endlich ein durch Rhythmus und Tonart scharf abstechendes Alternativ Platz greifen. Das Stück steht in Fis dur, dieses nun in A; natürlich leitet sich dies nach Fis, und damit auch in die eigentliche Barcarole wieder zurück. Doch hat sie eine neue Gestalt gewonnen. Sie wird durch Verdoppelung der Intervalle, durch mancherlei Passagenwesen ein Salonstück, das seinem ursprünglichen Wesen untreu erscheint, wenn es auch, gut, vor allen Dingen rein gespielt, recht schön klingt. Dieses wirklich und gewissenhafte rein und sauber Spielen wird durch die zahlreichen Vorzeichnungen, die Chopin, weil er so gern auf den Obertasten spielt, so häufig anzuwenden genöthigt ist, vielen Dilettanten erschwert. Zugleich aber ist dies eine nicht zu verachtende Uebung.“
Die Polonaise-Fantaisie op. 61 ist Chopins letztes großes Klavierwerk. Im Grunde kann sie nicht zu den Polonaisen im eigentlichen Sinn gezählt werden. Vielmehr ist sie eine Fantasie, deren eigenwillige Form einer symphonischen Dichtung beziehungsweise symphonischen Großanlage entspricht. Ihr musikalisch-programmatischer Gehalt ist eher balladesk als tänzerisch. Überhaupt, als Spätwerk von Chopin, ist hier die Frage statthaft, ob denn die durchgehaltene Stimmung innerer Beschaulichkeit durch Koketterien gestört werden sollte. Der einkomponierte Maestoso-Charakter (so auch die Tempobezeichnung »Allegro-Maestoso«) ist bestimmend für die Stimmung des gesamten Werkes und bedingt etwas »tragend-ebenmäßig-schwereloses«. Als Hauptrepräsentant gehört sie zu den letzten Werken Chopins, welche von fieberhafter Unruhe geprägt und keineswegs kühne und lichtvolle Bilder zu finden sind.
Franz Liszts poetische Darstellung mutet uns heute, vor allem im Zusammenhang mit seinen eigenen Werken, seltsam an: »Es sind dies Bilder, die der Kunst wenig günstig sind, wie die Schilderung aller extremen Momente, der Agonie, wo die Muskeln jede Spannkraft verlieren und die Nerven, nicht mehr Werkzeuge des Willens, den Menschen zur passiven Beute des Schmerzes werden lassen. Ein beklagenswerter Anblick fürwahr, den der Künstler nur mit äußerster Vorsicht aufnehmen sollte in seinen Bereich.«
Bewegende Worte, sicherlich, wobei ich glaube, dass Liszt mit der formalen Anlage dieses Werkes in Konflikt geriet, möglicherweise auf ähnliche Art und Weise, wie seinerzeit Eduard Hanslick die h-moll-Sonate von Franz Liszt mit derben Worten als »immer leerlaufende Genialitätsdampfmühle« aburteilte.
Daher bleibt für den Interpreten die große gestalterische Aufgabe an diesem Werk: Überzeugende, ebenmäßige Organik im gesamten Ablauf, mit Blick auf das Große, der Gefahr trotzend, sich auf die beschränkte Ausführung der wundervoll hinreißenden Einzelheiten zu verlieren.
Über sie schrieb die Allgemeine Musikalische Zeitung am 17. Februar 1847: „Ganz frei, rhapsodisch und gleichsam nur präludirend beginnt der Componist, geht dann in vagen Harmonieen in das Maass eines Alla Pollacca über, und lässt dann ein Tempo giusto (As dur) eintreten, das einen thematischen Charakter bat. Wir brauchen diesen Ausdruck, um anzudeuten, dass zu einem eigentlichen Polonaisenthema im gewöhnlichen Sinne es doch nicht kommt, so frei und phantastisch ist auch dieses zur witeren Entwickelung bestimmte Thema beschaffen. Von einer strengeren Durchführung ist auch nicht die Rede. Eine zweite Melodie in der Dominante ist schärfer begränzt, cantabler, und um so wohthätiger, als bis hieher schon sehr viel modulirt worden ist. Nun aber beginnt erst die Fantasie herumzuschweifen, aus Es geht es weiter nach B, nach G moll und H moll und nun in einen selbständigen Satz H dur, der durch ähnliche rhapsodische Figuren als im Anfange sich nach F moll und dann wieder in die Grundtonart As zurückwirft. Diese wird eigentlich erst zuletzt dauernd und planvoll festgehalten. Das ganze Stück schillert in einer gewissen Unbestimmtheit der Tonarten, die freilich bei Chopin so oft ihre Reize hat, doch aber diesmal sehr weit geht. Der Name Fantasie ist wohl eben mit Rücksicht auf die Kühnheit dieser Conturen gewählt. Die Theorie fragt hier nach den Gränzen solcher Freiheit, über der sehr leicht die Wirkung des Ganzen verloren gehen kann. Mancher wird nach zwei Seiten diese Polonaise muthlos weglegen. Bei genauerem Verweilen wird manche Einzelnheit freilich Genuss verschaffen, indessen können wir nicht umhin, zu bemerken, dass Chopin, gerade in seiner blühendsten Kraft, es auch am Meisten verstand, seine Erfindung zu beschränken, zu zügeln. Vermöchte er noch dies über sich gewinnen, so würde er durch seine oft so merkwürdigen Combinationen allgemeineren und stärkeren Eindruck erreichen. Der Gedanke, den er hinwirft, ist fast immer glücklich, warum verschmäht er nun so sehr seine feste Gestaltung, besonnene Entwickelung?“
Gerne möchte ich noch eine recht persönliche Frage zu Ihrem Spiel stellen. Wenn Sie spielen, Chopin oder andere Komponisten, wie sehen Sie „Ihre Rolle“ in der Darbietung? Steht für Sie nur das Werk im Vordergrund und versuchen Sie, sich rein als Vermittler möglichst weitgehend auszuschalten, oder beziehen Sie aktiv Ihre Persönlichkeit und Ihre subjektive Wahrnehmung mit in den Moment ein?
Ich sehe generell die Funktion eines Interpreten in der Rolle eines „Dieners am Kunstwerk“. Die großen Komponisten haben ihre Texte so eindeutig verfasst und dargelegt, dass deren Intention und Aussage unverwechselbar ist. Diese hervorzubringen, ist primär die Aufgabe eines Interpreten. Dabei ist es die große Kunst, hinter dieser Aufgabe zurückzutreten, und dennoch seine eigene Persönlichkeit als Identität miteinzubringen, ohne die einkomponierte Aussage der Komposition zu verfälschen. Wenn wir uns die Geschichte der großen Interpreten ansehen, können wir erfahren, dass exakt darin die große Kunst bestand, eben dass Interpret und Komposition zu einer großen allumfassenden Einheit verschmolzen. Schon nach wenigen Tönen war jeder Interpret mit seiner ureigenen Persönlichkeit, quasi als Visitenkarte, erkennbar. Und dennoch blieb die Aussage einer Komposition unverfälscht erkennbar. „Subjektive Wahrnehmung“ blieb als inspiratives Element für den letzten Moment der Erfahrung als „Erlebnis“ reserviert. Hierbei entstand für den Zuhörer die Situation einer „Katharsis“. Er, der Zuhörer, erfuhr, dass Musik und deren Interpretation letzten Endes eine „Sprache“ waren. Subjektivität und Objektivität bildeten eine neue Ebene der Erfahrung. An anderer Stelle habe ich bereits gesagt, dass „Bedeutung des Moments“ und „Forderung der Sache“ zu einer einzigen Komponente der Gratwanderung entwuchsen. Darin sehe ich auch meine Funktion als Vermittlung und Hervorbringung des Aspektes einer „Wahrheit“.
In Thomas Manns Alterswerk »Doktor Faustus«, „jener an das alte Deutsche Volksbuch vom Teufelsbeschwörer Dr. Faustus sich anlehnenden Künstlerbiographie, in welcher das Schicksal der Musik als Paradigma der Krisis der Kunst selbst, der Kultur überhaupt, behandelt ist …“ – so die Worte des Autors – steht im Mittelpunkt die Romanfigur Adrian Leverkühn und seine in syphilistischer Ekstase entstandenen atonalen Kompositionen als Beispiele notwendig gewordenen dodekaphonischen Denkens. Dabei wird auf geradezu bewegende Art und Weise dessen exemplarische Kunst mit der Sichtweise des deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer in Verbindung gebracht, dessen Idealvorstellung einer nach berückender Versinnlichung strebenden Interpretation im Sinne von Wahrheit darin bestand, das ureigenste Anliegen großer Musik darin verwirklicht zu sehen, deren Wesen im Jenseits des Gemüts und der Sinne zu vernehmen und anzuschauen.
Was Schopenhauer damit meinte, bezog sich letztlich auf eine »Allumfassenheit«, einer Ebene gleichend, auf der die Ausleuchtung verschiedenster Parameter in Werk und Interpretation allen Anforderungen standhielt. Einen Prozess »historischer Kreation« nannte er dies.
Gestatten wir uns hier eine Reflexion über die Bedeutung und den Grund des Wandels der Interpretation großer Kunstwerke und vor allem des (fälschlicherweise) immer mehr in den Hintergrund gedrängten Phänomens der »Emotion«:
Wenn große und zu Recht berühmte – mittlerweile leider nicht mehr unter uns weilende – Interpreten im Konzert ihre Ansichten mitteilten, erfuhren wir Musik als das, was sie eigentlich war: SPRACHE. Sprache in der Auslotung von Details, in der Hervorkehrung und Deutung einkomponierter Reibungen und Schroffheiten, quasi als Spiegelbilder in der Entstehung ihrer jeweiligen Zeit, widerspiegelt an der eigenen Identität, dem intuitiven Wissen um große Zusammenhänge und der Persönlichkeit des Künstlers. So entwuchs ein Kunstwerk, dessen Aussage stets einzigartig, charismatisch, authentisch, aber auch – im positiven Sinne – nicht wiederholbar war, einem einzigen großen Wurf gleichend, eigenwillig – bisweilen eigensinnig – jedoch stets die Balance wahrend zwischen Bedeutung des Moments und Forderung der Sache, ein Spannungsgefühl, das bisweilen ein neues Schönheitsideal entstehen ließ. Interpretation nicht aus klassisch-plakativer Draufsicht, sondern als ein sich unerbittlich dynamisch entrollender Prozess. Ein solcher Reifungsprozess setzt jedoch eine Entwicklung im ureigensten Sinne voraus, eine Entwicklung, die Zeit benötigt, Zeit, um zu einer „eigenen Spache“ zu gelangen.
In einem renommierten deutschen Musikmagazin hatte ich mich vor vielen Jahren in einem Interview der Frage zu stellen, was ich jungen Pianisten empfehle, um eine eigene Identität zu finden. Ich antwortete, dass ich große Probleme und direkt eine große Gefahr für die Kunst in der Schnelllebigkeit unserer heutigen Zeit sehe. Jungen Pianisten bleibt oft nicht die Zeit der Rückbesinnung und Ruhe für einen inneren Reifungsprozess. Bereits in der Schule setzt sehr schnell eine Spezialisierung ein (Kollegstufe), die eine eigentliche Ausweitung einer Allgemeinbildung verhindert. Diese Entwicklung stelle ich in Frage.
Dann sehe ich das Problem der internationalen Wettbewerbe, bei denen es allesamt um den Wettlauf um das schnellste und lauteste Spiel; anstelle um die Musik an sich und deren Hervorbringung geht.
Auch die Wahl eines entsprechenden Lehrers ist von höchster Wichtigkeit: Ich lehne entschieden bestimmte Talentschmieden ab, die quasi guruhaft ihre Schüler auf die vorderen Plätzen der Wettbewerbe platzieren anstelle den tiefergehenden Gehalt der Kunst zu lehren.
Ich wünsche jungen Pianisten die Kraft, dieser Maschinerie zu widerstehen und die Fähigkeit, in sich selbst hineinzuhören: Wenn sich Begabung und Talent, Fleiß und härteste Arbeit, Intelligenz und die entsprechende Ausweitung einer allumfassenden Bildung die Waage halten, dann ist die Voraussetzung für die Schaffung und Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit geschaffen.
Zu dieser Entfaltung ist eine heutzutage leider immer mehr in den Hintergrund tretende Eigenschaft notwendig: Mut. Mut, sich nicht zeitlich-kurzlebenden Strömungen zu unterwerfen oder gar unterwerfen zu lassen, Mut zur Unabhängigkeit, Mut, eigene Konzepte zu entwickeln und dahinter zu stehen. Mut zur Eigenständigkeit; Mut, sich vom Trend der Anpassung zu lösen.
Und überdies steht für mich die Bewahrung einer Natürlichkeit und menschlichen Einfachheit in Form menschlicher Größe an zentraler Stelle: Wenn die Blickrichtung über alle intellektuellen Bezüge hinaus geht, droht die Gefahr, den Blickwinkel zum Inneren, womit ich diesbezüglich das normale Leben meine, zu verlieren: Große Kunst wurde nämlich aus dem Leben, dessen Menschlichkeit , dessen Einfachheit und auch dessen Niederungen geboren. Arroganz ist hier fehl am Platz.
Interpretation als ein Aspekt humaner Wirklichkeit also, womit der Kreis der Intuition geschlossen wäre.
Ich selbst bekenne mich zu meinem künstlerischen Credo, der Ästhetik des deutschen Philosophen Hegel entstammend, welche nicht nur Überzeugung, sondern quasi Verpflichtung meines eigenen künstlerischen Wollens, Denkens und Wirkens ist: „Denn in der Kunst haben wir es mit keinem bloß angenehmen oder nützlichen Spielwerk, sondern … mit einer Entfaltung der Wahrheit zu tun.“
Sich entführen zu lassen in die inneren Bezirke großer Musik und Musik als Offen-Legung zu begreifen, vor allem auch in Kenntnis der Abgrenzung gegenüber kurzweiliger, vordergründiger Effekthascherei, dies dürfte die Aufgabe und Verpflichtung von Interpret, Hörer, Konzertagenten, Veranstaltern, Musikkritikern und insbesondere der Schallplattenindustrie, welche zum Erhalt von Kulturgut beiträgt, für die nächsten Jahre sein.
Interview geführt von: Oliver Fraenzke, Dezember 2015
Alle Antworttexte: © Burkard Schliessmann, 2015
Burkard Schliessmann: Chronological Chopin
divine art, DDC 25752
EAN: 8 09730 57522 8