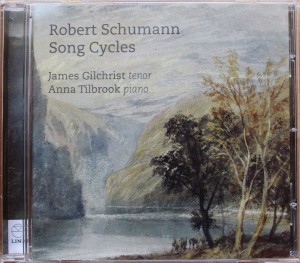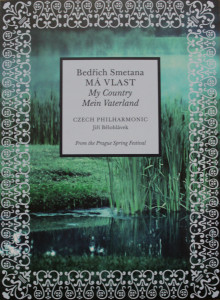Auf dem Programm des großen Festkonzertes zum zehnjährigen Bestehen der Blutenburg Kammerphilharmonie München stehen Haydns finale Symphonie Nr. 104 in D-Dur mit dem Beinamen „London“ sowie die erste Symphonie in C op. 62 von Egon Wellesz. Der Abend des 25. Oktobers 2015 fand in München im Festsaal an der Maria-Ward-Straße 5 Nähe Schloss Nymphenburg statt, als Dirigent für das Jubiläum konnte der Leiter der Gründungszeit gewonnen werden, Jörg Birhance.
Für das große Gründungsjubiläum hat sich die Blutenburg Kammerphilharmonie München ein mehr als gewagtes Programm ausgesucht und dies gleich auf mehrere Ebenen. Wird dem Publikum die unbekannte Symphonie gefallen, die an diesem Abend erst zum dritten Male aufgeführt wird? Und wird das Orchester überhaupt diesem musikalischen Schlachtschiff gerecht, dass von einem Laienorchester fordert, woran manche ausschließlich aus Berufsmusikern bestehende Klangkörper lange feilen müssten? Die Symphonie Op. 62, deren Randsätze in c-Moll notiert sind, aber jeweils in C-Dur enden, und deren Mittelsatz in g-Moll vorgezeichnet ist, ist zweifelsohne eine große Herausforderung an die Musiker und den Dirigenten: Der bei oberflächlicher Herangehensweise pompös erscheinende erste Satz mit seinem eingängigen Thema fährt ungeahnt dichte und polyphon eng geführte Unterstimmen auf, die zu verstehen und dann auch noch auszuführen eine Sisyphusarbeit darstellt; der zweite Satz wartet mit durchgehenden Quintolen auf und verlangt größte Virtuosität und Gewandtheit aller Beteiligten; das Finale schließlich, ein scheinbarer Abgesang auf allen Trubel zuvor, in dem aber doch große Kulminationen stattfinden, eröffnet ganz neue Klangsphären – offenkundig an den späten Mahler mag es erinnern oder auch etwas an Bruckners Neunte, jedoch ist er formal viel geschlossener und durch seine Kürze prägnanter als Mahler. Hier schließlich ist einmal das volle Blech gefordert, das mit vier Hörnern, je drei Trompeten und Posaunen sowie Tuba die Bühne gut ausfüllen kann. Warum dieses herausragende Erstlingswerk in Wellesz’ Symphonik sowie der Komponist selber so unbekannt blieben, ist ein wahres Rätsel. Wellesz, der sowohl im Bereich der Musikwissenschaft mit Guido Adler als auch in der Komposition mit Arnold Schönberg ausgezeichnete Lehrer vorzuweisen hat, schuf trotz seines späten Beginns innerhalb des Genres (mit knapp sechzig Jahren) neun Symphonien (wie sollte es anders sein!), konnte aber auch vorher bereits eine große Anzahl an Orchesterwerken und Opern sowie eine Fülle an Kammermusik hervorbringen. Der Stil des Wellesz, der auch auf dem Gebiet der byzantinischen Musik als Experte zu bezeichnen war, ist trotz der Studien bei Schönberg keineswegs der Dodekaphonie verpflichtet, sondern konzentriert sich auf eine höchst interessante und dennoch äußerst ansprechende freie Tonalität, die durch seine außergewöhnliche Gabe im Gebiet der Orchestration in vielfarbigem Licht erstrahlt. Zwei Jahre nach der Komposition wurde die erste Symphonie 1947 von Sergiu Celibidache und den Berliner Philharmonikern aufgeführt, ein Jahr später folgten die Wiener Symphoniker unter Joseph Krips – danach endete die Rezeptionsgeschichte abgesehen von einer sehr schwachen CD-Einspielung, der nicht einmal eine Aufführung und auch keine angemessene Einstudierung vorangingen – bis heute!
Die Blutenburg Kammerphilharmonie München spielt im Großen und Ganzen frappierend souverän. Natürlich ist manch eine Unsauberkeit oder Asynchronität zu hören oder hin und wieder einmal ein Kieksen, doch für die Verhältnisse eines Laienorchesters liegt eine überragende Leistung vor. Der große Mann des Abends allerdings ist Jörg Birhance, der das Orchester 2005 auch gegründet hat und bis 2011 leitete. In jedem Takt ist die Arbeit unverkennbar, die er mit dem Orchester verrichtet hat, so dass die nicht erreichbare technische Perfektion der Instrumentalisten durch die kammermusikalische Bewusstheit wettgemacht wird. Was dieser Dirigent aus dem Klangkörper herausholen kann, ist wahrlich mehr als erstaunlich! Beim großzügig besetzten Haydn lässt er einen sehr klaren Gestus vorherrschen, so dass die Form ganz genau ersichtlich wird und auch die satztechnischen Feinheiten der letzten Symphonie des Meisters der Wiener Klassik bloßliegen. Bei Wellesz legt er großen Wert auf die vielen Unterstimmen, von denen ein beachtlicher Anteil ans Licht treten kann, und auch hier ist die Form kristallklar: Die Fuge in der Mitte des Kopfsatzes beginnt so sprichwörtlich, dass sofort klar ist, dass nun nichts anderes hätte kommen können. Besonders bei diesem Kopfsatz wird die enorme Anstrengung bei den Proben ersichtlich und bringt reiche Ernte ein, denn das Spiel wirkt auch trotz aller Schwierigkeiten noch sauberer als beim einfacher erscheinenden Haydn. Besonders mitreißend und abwechslungsreich gelingt der Mittelsatz, der immer wieder für Überraschungen sorgt. Wenn nicht schon längst vorher, so wäre spätestens hier vor den Musikern der Hut zu ziehen, die Quintolenfiguren verlaufen bestechend sauber und die verqueren, freitonal erscheinenden Stimmen sind auf hohem Niveau mit befreitem Ausdruck ausgestaltet. Nicht zuletzt vor dem Dirigenten sollte man sich nach diesem modernsten und wohl auch eigentümlichsten Satz der Symphonie verneigen, all die rhythmisch fast wahnwitzigen Stimmpolyphonien und Wechsel der Hauptstimme teils taktweise zwischen vier Instrumenten kommen bravourös heraus. Auch die überraschenden Wendungen erscheinen spontan und frisch, unerwartet machen sich neue Klangsphären auf, die genauso plötzlich verschwinden, wie sie begannen. Leider spielt im dritten Satz das Publikum teilweise nicht mehr recht mit und immer wieder sind Störgeräusche zu vernehmen, doch bleiben Dirigent und Kammerphilharmonie konzentriert und bereiten dem großen Werk einen würdevollen Schluss.
Auffallend ist das starke Charisma, mit dem Jörg Birhance vor das Orchester tritt und das ihn von Anfang an zum Konzentrations-Mittelpunkt werden lässt. Nachdem er sich einmal hineingefunden hat in das Geschehen, bleibt er auch ganz eins mit dem Erklingenden und lenkt seine Musikern in suggestiver Weise. Birhance hat eine ausgereifte Dirigiertechnik mit gerader Haltung und ausgefeiltem Schlag, der vor allem aus dem Ellbogengelenk kommt, aber auch den ganzen Arm inklusive Schulter in Anspruch nehmen kann, womit er unweigerlich die Instrumentalisten mitnimmt und sie zur Gemeinschaft führt. Er agiert voll und ganz im Dienste der Musik und seine innige Zuwendung zu den Werken ist in jedem Moment spürbar.
So bleiben am Ende des Abends lediglich zwei Fragen offen: Warum ist Egon Wellesz noch immer so unbekannt angesichts von solch beeindruckendem Schaffen, das trotz freier Tonalität ins Ohr geht und sicherlich viele Menschen unmittelbar anspricht? Und warum ergeht es Jörg Birhance auch nicht anders als dem von ihm so liebevoll favorisierten Meister? Auch Birhance ist nach so vielen Jahren vortrefflicher Arbeit nach wie vor nur Kennern ein Begriff. Er dirigiert kleine Orchester und Laien anstelle von renommierten Orchestern, deren Programmauswahl und Ausdruckspalette er zweifelsohne mehr als nur bereichern würde.
[Oliver Fraenzke, Oktober 2015]