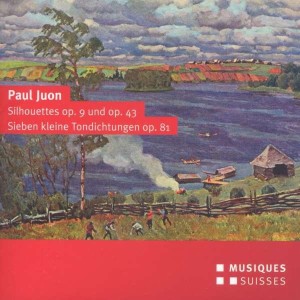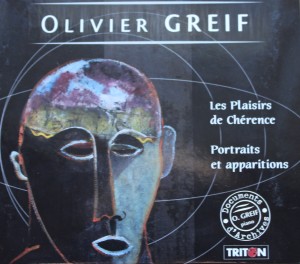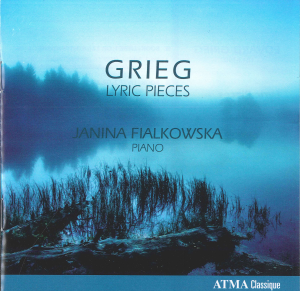Heinrich Aerni: Zwischen USA und Deutschem Reich. Hermann Hans Wetzler (1870-1943). Dirigent und Komponist
Monographie, erschienen bei Bärenreiter (ISBN 978-3-7618-2358-3)
Dieses Buch habe ich mit großer Spannung erwartet, nachdem wir in der Studienpartitur-Reihe Repertoire Explorer (www.musikmph.de) vier Orchesterwerke Hermann Hans Wetzlers erstmals nach langer Zeit wieder verfügbar gemacht hatten und Heinrich Aerni bei der Abfassung der Vorworte eine selbstlose Hilfe war. Hermann Hans Wetzler war in den 20er Jahren in Deutschland und auch – wenn auch in geringerem Maße – in den USA ein großer Name konservativer Couleur. Er ist einer der Meister jener mit maximaler äußeren Wirkung geschriebenen Musik fürs große Orchester, die wir als ‚Kapellmeistermusik’ kennen (dies ohne jeden abfälligen Beigeschmack!), also Musik, die mit immenser Beherrschung der instrumentalen Mittel im großen Maßstab verfasst wurde. Die heute prominentesten Komponisten dieser Sorte, die vor allem im deutschen Sprachraum erblühte, waren natürlich – in der Nachfolge von Wagner, Liszt und Bülow – Richard Strauss, Gustav Mahler, Hans Pfitzner, Alexander Zemlinsky, der späte Max Reger, Franz Schreker und schließlich als einer, der ganz andere Wege einschlug, Anton Webern, aber auch Paul Büttner, Hermann Suter, Emil Nikolaus von Reznicek, Max von Schillings, Siegmund von Hausegger, Wilhelm Furtwängler, Felix Weingartner, Max Fiedler, Georg Schumann, und gewiss Wetzler müssen hier, stellvertretend für viele weitere, genannt werden. Fast war es so, dass ein Dirigent, wollte er beweisen, wie tief sein musikalisches Verständnis gereichte, dies zu zeigen hatte, indem er eigene Kompositionen in die Öffentlichkeit brachte, und wer sollte schon mehr vom Orchester verstehen als er? (Auch wenn dem geringere Wirkung beschieden war wie bei Arthur Nikisch, Leopold Damrosch, Frederick Stock, Bruno Walter, Otto Klemperer, Robert Heger oder Leo Blech.)
Wetzlers Leben spielte sich zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland ab, mit einem späten, durch seine jüdische Herkunft erzwungenen Intermezzo in der Schweiz. 2006 gelangte sein umfangreicher und höchst geschichtsrelevanter Nachlass in die Zürcher Zentralbibliothek, wo Heinrich Aerni die Gelegenheit beim Schopf ergriff und sich der Sache intensiv annahm, was letztlich zur vorliegenden Buchveröffentlichung führte. Wie sehr wäre zu wünschen, dass eine derart fundiert informierende Publikation auch anderen Komponisten zugute käme! Wie schön wäre es z. B., ein Dresdner Bibliothekar nähme sich in vergleichbarer Weise Paul Büttners an, oder ein Basler Bibliothekar Friedrich Kloses oder Felix Weingartners – wenn man schon an der Quelle sitzt!
Am 8. September 1870 in Frankfurt am Main geboren, wuchs Wetzler zunächst in Chicago, dann in Cincinnati auf, wo er Violine, Klavier, Orgel und alle musiktheoretischen Fächer studierte und bald zusammen mit seiner Schwester auftrat. 1884 zog die Familie weiter nach New York, im Jahr darauf zurück nach Frankfurt. 1892 wurde Wetzlers Symphonie in Es dort am Hoch’schen Konservatorium uraufgeführt, und noch im selben Jahr übersiedelte er wieder nach New York und heiratete 1896 die Schwester eines Freundes, mit welchem er jahrelang zusammen an der Konstruktion eines ‚Luftschiffes’ arbeitete. 1898 dirigierte er sein erstes eigenes Konzert in New York, und 1902 gelang es ihm, mit geballtem Mäzenatentum im Rücken das Wetzler Symphony Orchestra zu gründen, welches zwei Spielzeiten lang für großes Aufsehen sorgte und u. a. 1904 die Uraufführung von Richard Strauss’ Sinfonia domestica spielte. Doch dann entglitt ihm das Glück. Er zog 1905 zurück nach Deutschland und trat nacheinander Kapellmeisterstellen in Hamburg, Elberfeld (ab 1929 Teil der neugegründeten Stadt Wuppertal), Riga und Halle an, bevor er 1915 in Lübeck Nachfolger Wilhelm Furtwänglers wurde und seine erfolgreichste Ära als Dirigent erleben durfte. In diese Zeit fiel auch 1917 der durchschlagende Erfolg seiner Ouvertüre (und Schauspielmusik) zu Shakespeares ‚Wie es euch gefällt’. 1919 wurde er neben Otto Klemperer erster Kapellmeister an den Städtischen Bühnen Köln, seine Symphonische Phantasie op. 10 kam zur Uraufführung, doch 1923 verlor er nach Zerwürfnissen seine Anstellung und fand auch keine andere mehr. Sein aufsehenerregendster Erfolg als Komponist gelang ihm 1923 mit den ‚Visionen’ (eigentlich ‚Silhouetten’) für großes Orchester, die ein Intermezzo ironico enthalten, in welchem in massiv grotesker Weise moderne Klischees verspottet werden. Höhepunkt seines Schaffens ist meines Erachtens freilich die symphonische Legende ‚Assisi’ op. 13, mit welcher er 1925 den 1. Preis im Kompositionswettbewerb des North Shore Festival in Michigan gewann. 1928 kam in Leipzig seine Oper ‚Die baskische Venus’ zur Uraufführung, die sehr gespaltene Reaktionen hervorrief. 1931 übersiedelte Wetzler in die Schweiz, 1932 spielte Gustav Havemann in Berlin erstmals seine Symphonie concertante für Violine und Orchester, 1933 starb Wetzlers Frau Lini in Wiesbaden, und 1935 zog Wetzler nach Ascona zu seiner Freundin Doris Oehmigen. 1937 wurde in Salzburg sein Magnificat aus der Taufe gehoben, und 1940 emigrierte er in die USA, wo er sein Streichquartett op. 18 vollendete, bei Paul Hindemith Unterricht in modernem Tonsatz in erweiterter Tonalität nahm, den ersten Satz einer American Rhapsody für Orchester schrieb und am 29. Mai 1943 in New York starb.
Als Komponist schwamm Wetzler im Fahrwasser seiner Vorgänger, mit einer immensen lyrischen und dramatischen Begabung versehen, und mit ungeheurem Ehrgeiz und Fleiß. Wagner, Strauss, vieles weitere, später auch Einflüsse jüngerer Provenienz sind omnipräsent, doch in seinen stärksten Werken, in den gelungensten Passagen gerade in ‚Assisi’, findet Wetzler zu einem magisch fesselnden Ton, der nicht nur mit grandioser Könnerschaft imponiert, sondern auch in einer Neigung zu versponnener Naturmystik fasziniert. Großartiger kann ein Orchester nicht klingen! Bei cpo ist vor sechs Jahren eine CD mit der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz unter Frank Beermann erschienen, mit den ‚Visionen’ und ‚Assisi’, die an dieser Stelle ausdrücklich empfohlen sei (natürlich stammt der fundierte Begleittext aus der Feder von Aerni).
Heinrich Aerni gibt in seinem Buch nicht nur einen höchst schattierungsreichen und spannenden Überblick über Leben und Schaffen Wetzlers, der vor allem mit seiner scharf beobachtenden, zitatenreichen Zeitzeugenschaft fesselt; er liefert zudem im zweiten Teil eine Fülle statistisch aufgeführter Fakten, die als solide Grundlage jeder weiteren Beschäftigung mit diesem vergessenen Komponisten und Dirigenten dienen werden: auf eine knappe Zeittafel folgt ein Werkverzeichnis mit allen relevanten Angaben (auch zu Wetzlers zeittypischen Bach-Bearbeitungen); ein Schriftenverzeichnis (darunter einiges Unveröffentlichte; hier dürfte noch manche wertvolle Entdeckung für die Öffentlichkeit gemacht werden, worauf auch zwei diesbezügliche Briefe Thomas Manns hinweisen); ein umfassendes Repertoireverzeichnis des Dirigenten, Pianisten und Organisten mit exakten Datierungen; eine Auflistung der Aufführungen von Wetzlers Werken zu seinen Lebzeiten (60 Aufführungen allein der Ouvertüre zu ‚Wie es euch gefällt zwischen 1917 und 1923, und 42 Aufführungen von ‚Assisi’ bis 1942); ein umfangreicher Anhang mit Notenbeispielen; drei ausgewählte Texte von Lini Wetzler und, wie erwähnt, Thomas Mann; und ein ziemlich ergiebiges Quellen- und Literaturverzeichnis.
Aerni versteht es, so zu schreiben, dass man alles mit Genuss und Gewinn liest. Gerne unterstreicht er Einzelfakten mit tabellarischen Mitteln, was sehr anschaulich ist. Auch das Bildmaterial ist bemerkenswert vielfältig. Wenn Wetzler damals als Dirigent umstritten war, so möchte ich dem einzig einen Gesichtspunkt anfügen, der bei Aerni nicht angesprochen wird. Damals war das technische Niveau der Orchester natürlich viel dürftiger als heute (jedes heutige deutsche B-Orchester wäre in dieser Hinsicht damals ein Spitzenensemble gewesen); bei den Dirigenten jedoch verhielt es sich umgekehrt: sie waren viel substanziellere Musikerpersönlichkeiten, und wir dürfen sicher sein, dass ein Mann von der Kompetenz, den Fähigkeiten und der unbändigen Energie Wetzlers heute in der allerersten Riege der Dirigenten zuhause wäre. Dies, um die Relationen über die Zeiten hinweg zurechtzurücken.
Fazit: ein exzellentes Buch, das uns nicht nur Hermann Hans Wetzler, sondern seine ganze Zeit und Zunft in einem Maße und einer authentischen Mannigfaltigkeit näherbringt, wie dies sehr selten ist.
Christoph Schlüren, August 2015